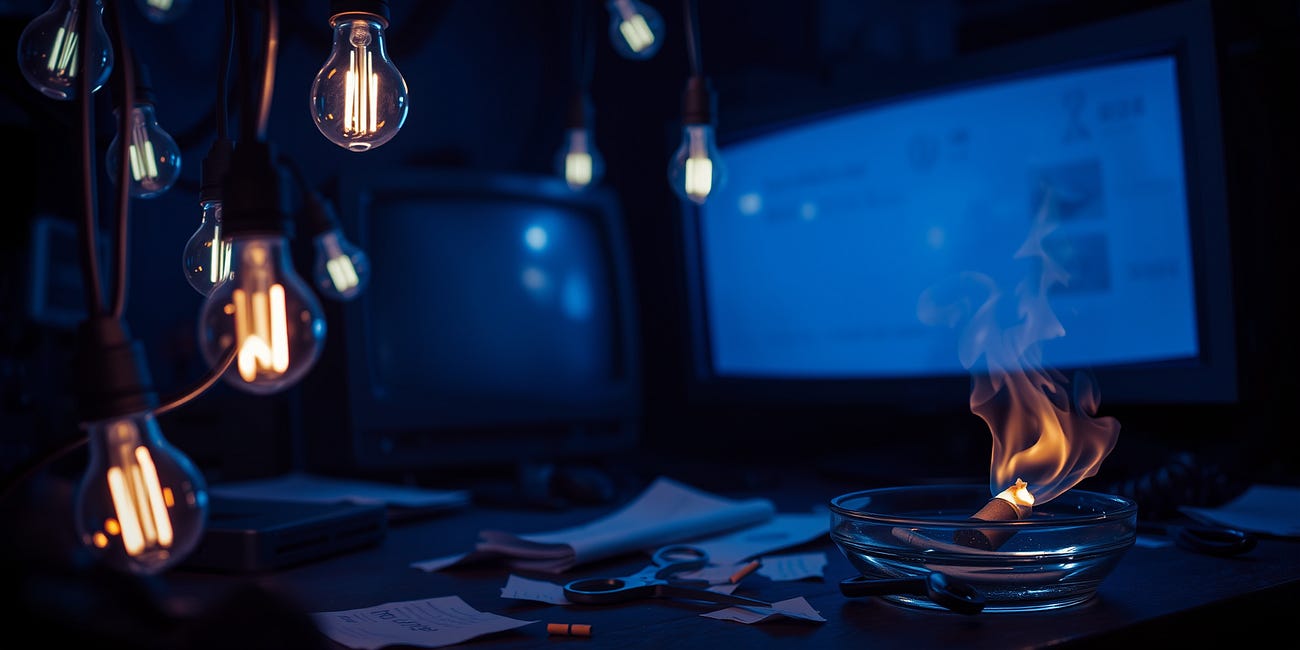Wenn ich in meinen flüchtigen Bemerkungen zur Künstlichen Intelligenz zu der Aussage gelangt bin, dass man die Digitalisierung den großen Demütigungen zuordnen muss, die Freud in seinem Unbehagen in der Kultur dingfest gemacht hat, nein, mehr noch, dass sie ärger ausfällt, weil es hier nicht bloß um das Wanken eines Weltbildes geht, sondern um eine Erschütterung, die materiell in das Leben eines jeden einzelnen Menschen eingreift, stellt sich die Frage, warum die Debatten über das Thema noch immer so überaus wolkig und ungenau sind. Vergleicht man dies mit den Beispielen, die Freud anführt (die kopernikanische Wende, die Darwinsche Evolutionslehre, das Unbewusste selbst), wird der Unterschied noch sehr viel deutlicher. Denn während die Logik der Gravitation wenig Raum für unterschiedliche Deutungen, geschweige denn für eine phantasmatische Besetzung lässt, ist dies im Falle der Digitalisierung grundverschieden. Denn wenn sich selbst ausgewiesene Kenner des Fachs (wie etwa Ray Kurtzweil) in quasi-religiösen Spekulationen verlieren, verwundert es nicht, dass der Diskurs zwischen Fluch und Segen oszilliert, dem, was der Religionswissenschaftler Rudolph Otto höchst treffend mysterium tremens und mysterium fascinans genannt hat. Das wirft die Frage auf: Wie ist es möglich, dass eine so diesseitige Technik als etwas Numinoses aufgefasst wird? Die Antwort ist, dass der Computer, als universale Maschine, kein Werkzeug im klassischen Sinne ist (was es unmöglich macht, hier mit dem Hammer zu philosophieren), sondern ein Raum, in dem mehrere Schichten sich übermalen – was dazu führt, dass einiges der Vergessenheit überantwortet wird. Aus diesem Grunde entgleisen die Diskussionen über das Thema mit schöner Regelmäßigkeit – ja, wird hier doch zusammengeworfen, was nicht zusammengehört. Weil die Maschine als Zauberkasten und black box erlebt wird, können Menschen der Meinung anhängen, dass eine primitive Markow-Kette, die doch nichts weiter darstellt als einen Trampelpfad menschlicher Entscheidungen, ein Algorithmus ist, der von einer künstlichen Intelligenz ausgeheckt worden ist. Das hier alle Kategorien wild durcheinandergehen, macht die Debatte um die sozialen Folgen der AI, die gravierend sein werden, höchst kompliziert – hat man es unweigerlich mit einer Melange aus Zauberglauben, Verwünschungsformeln und blankem Unwissen zu tun. Versuchen wir also, bevor wir uns der großen Demütigung zuwenden, die der Arbeitswelt bevorstehen wird, die einzelnen Triebfedern auseinanderzuhalten. Der erste Punkt – und der Grund, dass ich meine Geschichte der Digitalisierung damit anheben lasse – ist relativ trivial: Ausgangspunkt des Digitalen ist die Elektrifizierung der Gesellschaft. Erlaubt diese eine Form des Fernhandelns – Telematik –, so kann man sie zugleich als Initiale der Massengesellschaft begreifen, wie in einer Kindheitserinnerung dokumentiert, als ich während des WM-Endspiels 1966 durch die Straßen meiner Heimatstadt ging und zeitgleich aus allen erdenklichen Fenstern heraus ein Schrei auf die Straße hinaus gellte: Tooooor! In diesem Sinn markiert die Elektrizität den Beginn der modernen Massengesellschaft. Darüber hinaus verändert sich mit ihr das, was fortan als Schrift gelten kann. Denn wenn alles, was elektrifiziert werden kann, sich in elektromagnetischer Form speichern lässt, kann man nicht anders, als hier eine vollständige Entfesselung des Schriftbegriffs festzuhalten. Wenn Menschen heutzutage, wie die Petenten des Manifest für menschliche Sprache, der Meinung sind, dass die zeitgenössische Schrift aus den Lettern des Alphabets besteht, demonstrieren sie eine Gestrigkeit, die noch hinter das 18. Jahrhundert zurückfällt.1 Kommen wir zum zweiten Punkt. Wenn alles Erdenkliche Schrift werden kann, lassen sich durchaus komplexe Prozesse und Handlungsroutinen festhalten. Buchstabiert man dies durch, lässt sich sagen, dass die Gesellschaft hier mit dem Museum der Arbeit konfrontiert wird – lässt sich doch eine jede Arbeit, die man digitalisiert hat, in ein Programm überführen. Weil die digitale Logik, der Grundformel des x=xn gemäß, dieses Programm nach Belieben proliferieren lässt, weil man zudem auf die Telematik zugreifen ist, ist die Folge, dass sich das betreffende Programm allüberall und jederzeit aufrufen lässt: Anything Anytime Anywhere. Können unsere Musiker ein Lied davon singen, wie sich das Streaming auf die Musikproduktion und den Plattenverkauf ausgewirkt hat, ist absehbar, dass das Glaubensbekenntnis des klassischen Kapitalismus hinfällig ist (die Aussage, dass der Mensch auf dem Stern der Knappheit lebe) – dass man es hingegen mit einer Ökonomie des Überflusses zu tun hat. Der dritte Punkt, der uns langsam in die Welt der Künstlichen Intelligenz hineinführt, hat damit zu tun, dass sich eine jede menschliche Interaktion zum Datum verwandelt – und dass man all diese Daten zur Mustererkennung nutzen kann, also dazu, bestimmte Denk- und Verhaltensmuster in Modelle zu übersetzen. Trainiert man eine Maschine nur lang genug, wie verschiedene Menschen mit einem komplexen Gerät umgehen (sagen wir: einem Auto oder einer Baumaschine), wird irgendwann auch ein Roboter diese Aufgabe übernehmen können.
Und damit sind wir in der Gegenwart angelangt, die sich urplötzlich mit dieser Gemengelage beschäftigen müssen, einfach deswegen, weil die KI-Modelle überaus mächtig geworden sind, zudem so günstig, dass die menschliche Arbeit dagegen nicht zu bestehen vermag. Die Folgen sind bereits jetzt absehbar: So berichtet das Portal Stepstone, dass Positionen für Berufseinsteiger einer Einbruch erleben – und urplötzlich 45% unter dem 5-Jahres-Durchschnitt liegen. Man braucht keine allzugroße Phantasie, um sich die Verwandlung der Arbeitswelt vorzustellen. Wenn man die mühselige Recherchearbeit, die ansonsten ein Assistent übernommen hätte, an einen AI-Agenten delegieren kann, wenn die Sekretärin, die sich um Termine, Reiseorganisation etc. gekümmert hat, durch eine Künstliche Intelligenz ersetzt werden kann – wenn zuguterletzt auch der Kollege, der sich um die Protokolle, die Strategiepapiere, die Kommunikation mit der Außenwelt gekümmert hat, in ChatGPT oder Anthropics Claude einen mehr als ebenbürtigen Konkurrenten findet, mag sich der Entscheidungsträger am Ende mutterseelenallein im Home-Office wiederfinden. Und hält man sich vor Augen, dass auch die Außendarstellung einer Firma, die bis vor Kurzem noch von Grafikern, Webdesignern, Programmierern erledigt worden ist, in die Hände einer AI gegeben werden kann, ebenso wie der Kundendienst von einem Chatbot besorgt werden kann, sind Firmenkonstellationen denkbar, bei denen eine Handvoll Personen eine ungeheure Schlagkraft entwickeln. Befreit von sozialen Friktionen, von der Mühsal, die mit der Delegation von Aufgaben verbunden ist, können sich diejenigen, die man in gewisser Begriffsverlegenheit Leistungsträger genannt hat2, nun umso freier entfalten. Es ist evident, dass hier ein ganz neues Modell dessen entsteht, was man ehedem eine ›Firma‹ oder eine ›Korporation‹ genannt hat. Wenn in Berliner Büroflächen derzeit über 2 Millionen Quadratmeter leerstehen, wenn die Gewerbemieten zugleich einen Rekordstand erreicht haben, ist evident, dass eine Firma, die ihre Geschäfte vom Home Office aus betreibt, einen enormen Vorteil geltend machen kann. Hat man in der Limbo-Ökonomie der 2000er Jahre vom Standortvorteil gesprochen, müsste man heutzutage den Vorteil der Standortlosigkeit predigen, die Virtualität, welche den Ort, aber auch die menschliche Arbeitskraft hinter sich gelassen hat. Wenn die Kritiker des Silicon Valley (wie Yannis Varoufakis) von einer neuen Form des Techno-Feudalismus gesprochen haben, so hat dies damit zu tun, dass der Logik des x = xn gemäß Firmen nach Belieben skalieren können (weswegen die Formel eigentlich so aussehen müsste: x ⇒ xn), wohingegen der »natürliche Mensch« (das bedürftige Kapital, wie Marx ihn genannt hat) notwendigerweise zurückbleiben muss. Nun schreibt sich dieser Klassengegensatz der Arbeiterschaft als solcher ein – werden wir in naher Zukunft erleben, wie sich diejenigen, die persönliche Agenten für sich arbeiten lassen, von denen abheben, die in dieser Kunst nicht bewandert sind oder, ärger noch, Opfer unvermeidlicher Rationalisierungsmaßnahmen geworden sind.
Was die Situation so überaus explosiv, wenn nicht gar zu einem sozialen Pulverfass macht, ist der Umstand, dass längst überfällige Diskussionen darüber, worin genau der Sprengsatz der digitalen Revolution besteht, nicht einmal in Ansätzen geführt worden sind. Hätte man den Versuch unternommen, wäre man mit der Frage konfrontiert worden, wie und warum diese Revolution unsere Begriff davon, was eine Arbeit und eine Leistung ist und worin das Novum, ja der Schriftbegriff des Digitalen besteht, durcheinanderwirbelt. Dass man sich stattdessen Phantasmata wie einer Datensouveränität hingegeben hat und sich ansonsten im moral Grandstanding hervorgetan hat, ist nichts anderes als ein Generationsversagen ersten Ranges. Schaut man sich die gegenwärtige classe politique an, ist evident, dass man hier gänzlich unvorbereitet ist, ja, dass man es letztlich mit einer Kohorte von Schlafwandlern zu tun hat. Und dies erfüllt mich, der ich die rationale Seite der neuen Welt aus ganzem Herzen begrüße, auf einer gesellschaftspolitischen Ebene mit einem großen Schaudern – hat man es hier doch mit einer Konstellation zu tun, die noch weit gravierender ist als das, was Fließband, Finanzkrise und Depression den Gesellschaften des letzten Jahrhunderts zugemutet haben. Wenn der Anteil der Dienstleister an den Erwerbstätigen 75% übersteigt (wohingegen nur noch 1,2 % der Menschen in der Landwirtschaft arbeiten), wenn man sich klar macht, dass gut 80% der Dienstsleistungstätigkeiten im Museum der Arbeit verschwinden können – dann weiß man, dass ein Funke reicht, um eine Revolution auszulösen.
Tatsächlich hat sich eine der Autorinnen zu der verwegenen Aussage hinreißen lassen, es könne doch nicht sein, dass die digitale Welt anders funktioniere als die analoge – eine Aussage, die man, wenn man sich die Kulturgeschichte vor Augen führt, auch als Argument gegen das Alphabet ins Feld führen könnte, emittiert es doch Zeichen, die anders als die natürliche Welt, nicht vergehen. Dass man sich der zeitgemäßen Schrift so verwehrt, hat Auswirkungen auch auf den Stil und das Denkvermögen, denn das Manifest behauptet kurzerhand: Literaturübersetzende erfahren bereits jetzt, wie sich die Automatisierung von geistiger Arbeit und menschlicher Sprache auf ihre Arbeit und auch die Gesellschaft insgesamt auswirkt: Die Kunst, aber auch die Demokratie wird bedroht.
Die Bedeutungsverschiebung des Wortes durchaus erhellend. Denn ehedem war mit dem Leistungsträger eine Behörde gemeint, der beispielsweise die Auszahlung von Sozialleistungen auferlegt war, während die Fokussierung auf den Aktivposten im Arbeitsprozess erst jüngeren Datums ist.
Themenverwandt
A Short History of Digitalization
To assist our readers, both old and new, in gaining a better understanding of what makes Burckhardtian thinking so relevant to the enigmas of our current world, we’ve decided to serialize our English translation of Eine kurze Geschichte der Digitalisierung
Vom Missbrauchswert
Warum einen Vortragstext hervorkramen, der aus dem Jahr 1999 stammt? Vielleicht, weil er in struktureller Form etwas vorwegnimmt, was sich erst im Laufe der Zeit als soziales Phänomen eingestellt hat. Genau dieser Zusammenhang aber macht die Geschichte interessant: Denn wenn die Aufmerksamkeitsökonomie ihrerseits in eine Welt hineinf…
In the Working Memory
In the early 1980s, Martin Burckhardt, a young, aspiring writer, completed his Master’s thesis on Walter Mehring and Dadaism. After writing his first radio play in which he’d gathered a group of Dadaists in an old folk home and called for the death of modernity, he soon found himself working in the recording studio with Johannes Schmölling, who’d recent…
Der perfekte Sturm
Von Günter Anders stammt die schöne Beobachtung der Prometheischen Scham – jener Spaltung, bei der der Schöpfer sich für die eigene Schöpfung entschuldigt. Auf zeitgemäße Weise lässt sie sich auch den Äußerungen Geoffrey Hintons entnehmen, jenes Forschers, der um 2012 herum die Künstliche Intelligenz revolutionierte, und zwar dadurc…