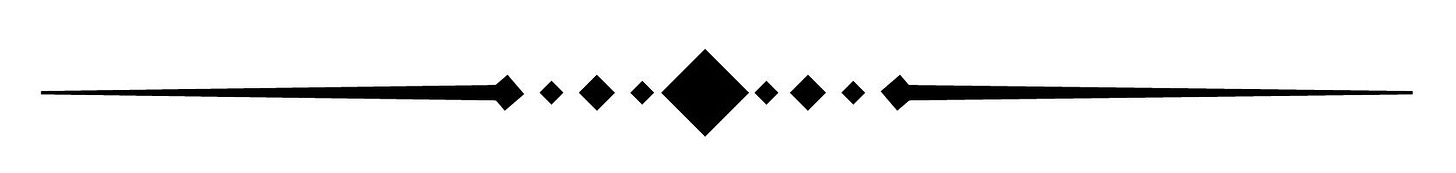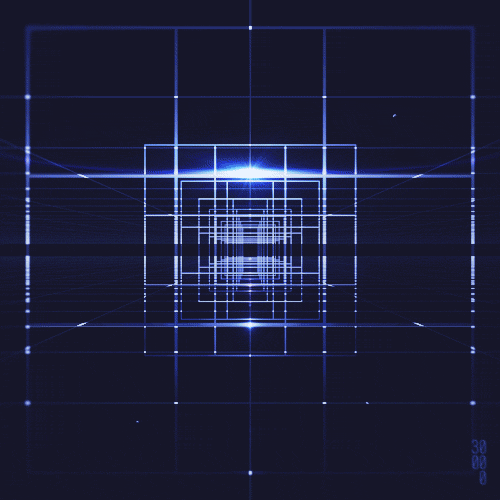Warum einen Vortragstext hervorkramen, der aus dem Jahr 1999 stammt? Vielleicht, weil er in struktureller Form etwas vorwegnimmt, was sich erst im Laufe der Zeit als soziales Phänomen eingestellt hat. Genau dieser Zusammenhang aber macht die Geschichte interessant: Denn wenn die Aufmerksamkeitsökonomie ihrerseits in eine Welt hineinführt, in der sich ein Missbrauchswert geltend machen lässt (etwas, wofür die Zeitgenossen das sinistre Wort der Victim Olympics eingeführt haben), so ist dies ein Grund, sich eingehender über diese Form der Ökonomie Gedanken zu machen.
Zeit ist Geld ist Zeit
Vortrag, Wolfgangsee 1999
Meine Damen, meine Herren,
in einem Vorbereitungsschreiben bin ich darum gebeten worden, mich vortragenderweise auf 30 Minuten zu begrenzen – und genau das werde ich tun. Ich werde 30 Minuten vortragen und dann, auf das Kommando dieses kleinen Weckers hier, abbrechen. Bei der anschließenden Diskussion werde ich auf jede Frage mit einem Hauptsatz, einem Buchtitel oder auch nur einem einzigen Wort antworten. Logistisch ist dies, aus der Veranstaltungsperspektive betrachtet, zweifellos ein seltener Glücksgriff, ob es mir auch auch inhaltlich gelingt, der Kürze Würze zu geben – nun ja, das werden Sie selbst beurteilen müssen.
In der Antizipation dieses Vortrags habe ich mir gedacht, dass es der Dramatik halber schön wäre, wenn ein Bildschirm einen Countdown anzeigen würde, also 29:10, 29:09 undsoweiter – und wenn Sie auf diese Weise, mit mir gemeinsam, auf das Finale zusteuern würden. Und wenn ich schon dabei bin, mir die Psychophysik der Vortragskunst vor Augen zu halten: Ich würde auch eine Vorrichtung begrüßen, die mir im Sekundentakt das entsprechende Honorarquantum in Form einer Münze ausbezahlte, so dass ich schließlich, nach einem letzten und einsilbigen Diskussionsbeitrag, mit einem Sack Kleingeld von dannen ziehen würde. Nun ja, das wäre vielleicht ein bisschen beschwerlich, aber ich hätte das Vergnügen, mir sprechenderweise das Äquivalent jedes Gedankens vor Augen zu führen. Darüber hinaus könnte ich, eine solche Apparatur vorausgesetzt, einfach in meinem Vortrag innehalten – und Ihnen vor Augen führen, dass die fallende Münze soundsoviele Zeitquanten honoriert – womit sich, paradoxerweise, auch die Umrechnung von Zeit zu Geld und von Geld zu Zeit niederschlägt, was den erfreulichen Nebeneffekt hat, dass ich diese Form der Konversion für sich sprechen lassen – und selber schweigen kann. Im Grunde – wenn Sie mein Vortragsthema nehmen, das da lautet: Zeit ist Geld ist Zeit – ist mit dieser Apparatur schon alles gesagt, was zu diesem Thema gesagt werden. Alles, was ich darüber hinaus noch dazu zu sagen habe, ist überflüssig und redundant. Und wenn ich, wie es in der Volkswirtschaftslehre heißt, ein ökonomischer Akteur wäre, würde ich Sie bitten, sich vielleicht ein Bier holen zu gehen oder eine Knabbermischung, oder aber der Veranstalter könnte einen Werbeblock einspielen. Aber statt dessen sehen Sie mich hier in einer gewissen Verlegenheit, bin ich doch genötigt, meine restliche Zeit hier abzusitzen – was mich, aber das ist nun wirklich eine Frage der Höflichkeit und keine des ökonomischen Kalküls, dazu bringt, gleichwohl weiterzusprechen.
Allerdings möchte ich, wenn wir an dieser Stelle schon ins Register des Überflüssigen übergehen, Sie mit Gedanken konfrontieren, die weder zu Ende gedacht sind, noch einer schlüssigen Argumentationskette folgen. Vielmehr geht es um mein Nicht-aufhören-wollendes Rätseln darüber, wie es kommt, dass Geld, die allgemeinste Sache der Welt, stets persönlich genommen wird. Wenn ich Geld persönlich nehme, aber zugleich auf der Allgemeingültigkeit dieser Sache beharre, liegt hier ein unglaublicher Widerspruch – ein Widerspruch, dem Sie überall wieder begegnen werden. Nehmen Sie das Wort: Selbstwertgefühl. Es ist evident, dass dort, wo es ums Bezahlen geht, die Gefühlswelt außen vor bleiben soll, dass Sie nicht geneigt sein werden, Preise bezahlen zu wollen, die nach Gefühl ausgepreist werden – oder dass es schwierig sein wird, eine Verhandlung mit jemandem zu führen, dessen Selbstwertgefühl narzisstisch so aufgeladen ist, dass dieser Lunatic Mondpreise für seine präsumtiven Hochleistungen einfordert. Vor diesem Hintergrund erscheint das Wertgefühl wie ein Oxymeron, oder wie eine Überblendung jener Spaltung, die der Kapitalismus uns abfordert. Diese Spaltung hat Kant ausgedrückt, als er sagte:
Im Reich der Zwecke hat alles entweder einen Preis oder aber es hat eine Würde.
Freilich, so evident es sein mag, dass diese Scheidung den Grund unseres ökonomischen Handelns ausmacht, so merkwürdig ist sie doch bei genauerem Hinsehen. Denn wenn wir das Wort selbst nehmen, valor, sind diese beiden Sphären noch ungeschieden, sind Wert und Würde eins, wie im pretium der Preis und das Preisen eins sind. Wenn der Kapitalismus eine Spaltung bewirkt hat, so ist es die Spaltung zwischen Würde und Wert. Denn derjenige, der hier auf der Nachfrageseite operiert (das sind strenggenommen Sie, die Sie mir zuhören und später nachfragen werden), wird sich nicht für meine ins Schwindelerregende hinaufgetriebene Würdegespinste interessieren, sondern für das, was an meinem Selbstwertgefühl nicht individuelles Gefühl ist, sondern objektivierbarer Wert. Das Selbstwertgefühl, so erfahren wir, beziehen wir aus der Arbeit. Nun: das frühe Mittelalter (das Mittelalter vor dem Räderwerkautomaten) hat Arbeit als die Mühsal der Enterbten aufgefasst. Wir, die wir uns die Pünktlichkeit und Perfektion der mechanischen Uhr introjiziert haben, begreifen Arbeit nicht als Entwürdigung, sondern im Gegenteil: als unsere höchste Würde. Was ein Grund ist, die Frage nach der Arbeit zu stellen? Was ist Arbeit? In der Physik: Kraft mal Zeit – und im formalen Sinn, und das ist allzuoft der soziale Unsinn, wenn ich meine Zeit absitze. Nun ist es peinlicherweise so, dass man sich dieses Zeit-Absitzen (sofern es sich um eine jener so genannten repetitiven Tätigkeiten handelt) kurzerhand sparen kann, und zwar dadurch, dass diese Arbeit mit ein paar Codezeilen in den Arbeitsspeicher gesteckt wird. Wo sie dann ohne mich läuft – was wir euphemistischerweise Rationalisierung nennen, nur dass mit dieser Rationalisierung nicht nur meine Arbeit im Museum der Arbeit verschwindet, sondern meine Würde und mein Selbstwert dazu.
Kraft mal Zeit: das könnte man auch Psychophysik nennen. In dieser Formel ist ein Begriff von Arbeit enthalten, der sich proportional zur Zeit entfaltet. Kraft mal Zeit ergibt ein Produkt – und je mehr Zeit und Mühe Sie dabei aufwenden müssen, desto teuer wird’s. Das ist der Sinn der Formel: Zeit ist Geld. Die Geburtshelferin des kapitalistischen Modells ist zweifelsohne die mechanische Uhr. Sie ist, wenn wir das so nennen wollen, das Betriebssystem des Kapitalismus – bis weit in die Tage des Taylorismus hinein. Nun ist es so, dass wir unser Betriebssystem umgestellt haben. Unser Fenster zur Welt ist nicht mehr die Zentralperspektive oder der Räderwerkautomat, sondern es heißt Windows, und unsere Instrumente sind nicht mehr schweißtreibende, Körperkraft einfordernde Apparaturen, Hardware, sondern jenes luftige Zeug namens Software, smarte Agenten, elektromagnetische Geister, die wir in die Welt gesetzt und die wir zu kontrollieren haben. Eine alte philosophische Unterscheidung spricht von aktuellem und einem potentiellen, oder wie man ebensogut sagen könnte: einem virtuellen Gehalt. In actu, wenn Sie so wollen, laufen nicht mehr Sie, sondern da läuft das Programm. Wir haben uns angewöhnt, die Medien als Erweiterungen unserer Möglichkeiten, unserer Potenz aufzufassen – aber nicht minder treffend ist die umgedrehte, spiegelverkehrte Sichtweise. Denn ökonomisch besehen ist der Akt, der von einer Maschine ausgeführt wird, bereits devalorisiert. Jeder Depp kann das, folglich ist es nichts wert – wobei, und das ist ein wichtiger Aspekt, diese Entwertung einer Arbeit ein Akt der sozialen Zuschreibung ist. Denn vom Produkt aus besehen ist es gleichgültig, ob eine Buchseite mit Bleilettern oder mit Pagemaker erstellt worden ist – dennoch ist es so, dass der Bleisetzer über die Maschine mit seiner Substituierbarkeit konfrontiert wird – und dass diese hohe Kunst fortan als nichtswürdig betrachtet wird (auch von denjenigen, die nicht das geringste davon verstehen). Der Mehrwert entsteht nur dort, wo das, was aktuell läuft, um jenes Mehr ergänzt wird, das ins Virtuelle übergreift. Oder anders gesagt: der Mehrwert entsteht im Jenseits der Maschine, dort, wo eine Arbeit nicht substituierbar ist. (Das koinzidiert, nebenbei gesagt, mit einem Marxschen Gedanken: Mehrwert schafft nur der Mensch, hat Marx in seiner tiefen Geldverachtung gesagt, oder besser: er hat dies gepredigt). Der Mehrwert entsteht somit in der Einbildung, er ist Einbildungskraft, Kraft, die sich in Hardware einformt, sich informiert, einbildet im Wort. Wenn wir diesen Gedanken als These nehmen, müsste eine moderne Formulierung der Arbeit lauten: Arbeit ist Einbildungskraft mal Zeit.
Allerdings erhebt sich hier sogleich die Frage, was das Zeitmaß der Einbildungskraft ist? Wie kommt es zu einem Gedanken, der sich den Dingen einbilden kann? Hier kommen wir auf den wesentlichen Riss, der unsere postindustrielle Gesellschaft durchzieht – wobei ich industria ganz altmodisch mit Fleiß übersetze. Die Zeit der Psychophysik, da man sich die Hacken abrennt oder seinen Hintern wundsitzt (wobei letztes schon der Anfang vom Ende sein mag), ist der Einbildungskraft heteronom. Vor allem aber: die Proportionalität von Kraft und Zeit, die in der Welt der Psychophysik galt, hat hier ihre Bedeutung verloren. Während der Transport eines Gutes stets Fortschritte macht, wenn Sie Kraft und Zeit investieren, verhält sich dies im Falle des Einbildungskraft komplizierter. Da kann es sein, dass aller Fleiß vergeblich ist. Auf Ausdauer, Fleiß und Pünktlichkeit allein kann man sich nicht sonderlich viel einbilden – und insofern ist es wahr, dass man es hier mit Sekundärtugenden zu tun hat. Ich will hier nicht einem hochgeschraubten Geniegedanken das Wort reden – als ginge es im Falle der geistigen Arbeit um jähe Eingebungen, Einflüsterungen, um den Genius, der von einer höheren Macht heimgesucht wird. Nein, worauf ich vielmehr hinauswill, ist, dass die Grundformel der Psychophysik nicht mehr gilt, dass die Zeit der Einbildungskraft nicht stetig ist, sondern zerklüftet, dass es da Höhen & Tiefen gibt, die den Gleichschritt von Zeit und Einbildungskraft stören. Anders als im Bereich der Psychophysik, wo man Kraft in Pferdestärken notiert, verfügen wir über kein Metrum der Einbildungskraft. Und vielleicht liegt hier der eigentliche Grund für das Dilemma, das die postindustriellen Gesellschaften in der Problematik der Arbeitslosigkeit heimgesucht hat: ihr Mangel an Einbildungskraft.
Kraft und Einbildungskraft gegeneinanderzustellen (oder genauer: Einbildungskraft als einen ökonomischen Faktor aufzufassen), ist ein überaus fruchtbares Unterfangen – nicht zuletzt deswegen, weil der Parallelismus seinerseits den Blick auf Analogien freimacht. Wenn Sie eine Mondperspektive einnehmen und die Welt der Psychophysik betrachten, die seit dem 13./14. Jahrhundert ihre Gültigkeit hat, so werden sie sehen, dass das Charakteristikum dieser Zeit die Entfernung der Ferne ist, die Überwindung der Raumdistanzen. Also das: was man landläufig Logistik nennt. Wir jedoch leben, schon seit der Telegraphie des 19. Jahrhunderts, im Zustand der Globalisierung, genauer: einer steten Schrumpfung der Raumdistanzen – was die Physiker zur Formulierung des Weltzustandes gebracht hat. In den Netzen und Vertriebskanälen stellt die Entfernung der Ferne das geringste Problem dar. Viel komplizierter hingegen als der Transport eines Gutes ist das Ansprechen-Können des Gegenübers. An die Stelle der Logistik ist die Psychologistik getreten – das Problem der Vermittlung, die Frage, wie ich einen Gedanken von a nach b bringen kann, nicht körperlich, sondern intellektuell. Nicht wahr, das ist ja allerorten als Desiderat formuliert: dass es gelte, eine Leistung rüberbringen, sie akzeptabel zu machen. Wo die Aufmerksamkeit des Konsumenten ein kostbares Gut ist, um das sich eine Vielzahl konkurrierender Reizproduzenten reißen, ist die Psychologistik der entscheidende Faktor. Freilich ist dieses Terrain nicht minder dunkel als die Vertriebswege unserer Vorfahren. Mussten diese sich den Widrigkeiten der Weltmeere, den Unwägbarkeiten fremder Kulturen etc. aussetzen, so ist die terra incognita nunmehr die Psyche des Konsumenten. Der Umstand, dass es keineswegs auf der Hand liegt, was ihn berührt, dass seine Psyche ein sehr viel dunklerer, komplizierter Kontinent ist als man immer gemutmaßt hat. Mögen die materiellen Wege geschrumpft sein, so gibt es doch ebensoviele Barrieren und Widerstände – nur dass sie sich in den Kopf gesetzt haben. Wo früher die Außenwelt war, liegt jetzt die Innenwelt des Phantasmas, bedarf es der Psychologistik und der Einbildungskraft, um diesen Kontinent zu durchkreuzen.
Mag sein, dass Ihnen das alles ein bisschen dunkel vorkommt, wie Nachrichten aus einer anderen Welt. Tatsächlich ist das, wovon ich rede (auch wenn es den überflüssigen Part meines Vortrages darstellt) keineswegs luxurierend, sondern berührt das, was ich über die Ökonomie weiß. Vielleicht ist ein Problem, das uns den Blick auf den tiefgreifenden Wandel verstellt, die Tatsache, dass dieser Prozess – der mit der Entwertung dessen einhergeht, was Sie als Wert verstehen mögen – sich gleichsam subkutan unserer Köpfe bemächtigt hat. Deshalb vielleicht ein kurzer Blick auf das Revolutionsjahr 1968, in dem die Protestformel der Pariser Studenten bezeichnenderweise lautete: L’imagination au pouvoir, die Einbildungskraft an die Macht. Nun kennt das Jahr 1968 eine Reihe von Revolutionen, die mehr oder minder in Vergessenheit geraten sind, die aber – für meine Begriffe – Meilensteine darstellen. 1968 war das Jahr, da der Hirntod als Todesdatum fixiert wurde, es war das Jahr, da der Software-Handel begann. Es war auch der Auftakt zu jener großen Selbstentmächtigung der alten Nationalstaaten, die später unter dem Zeichen Bretton Woods bekannt wurde: die Ablösung vom Goldstandard, die Ablösung von der Materialität. Ganz allgemein kann man sagen, dass die Gesellschaft in dieser Zeit ins free floating übergeht, dass die Dinge, die Zeit und die Arbeit sich auflösen und zu Software werden. Zu dieser Zeit redete Joseph Beuys davon, wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt, aber vor allem: dass jeder ein Künstler sei – und genau das pfeifen heute die Spatzen von den Dächern. Wir leben in der Zeit der Kreativen. Sie müssen nur den Fernseher einschalten oder den Müll von XYZ analysieren und Sie wissen: die Einbildungskraft ist an der Macht. Anders sind bestimmte (und zwar: hochökonomische, geldwerte) Phänomene gar nicht mehr zu erklären. Allerdings hat, was in der anthroposophischen Sozialutopie des Künstlers eine Entgrenzung des Menschen, seine Befreiung zu seiner Freiheit meinte, heute fast den Charakter einer Drohung angenommen. Die Einbildungskraft ist ins Reiche der Zwecke hineingeraten, und man kann nunmehr von einem Zwang der Ästhetisierung reden.
Wo die Einbildungskraft regiert, könnte man meinen, da lebten wir in der Welt der geistigen Güter. Das sagt sich leicht, aber es ist sehr schwer, etwas Unsichtbares, Immaterielles, etwas, das sich nicht wirklich festhalten lässt, als ein Gut aufzufassen. – Unsere Vorstellung von dem, was Wert hat, ist altmodisch fixiert ans Ontische, Seiende, an das, was mit den Händen zu greifen ist. Sie ist zu einem nicht geringen Teil auch an die Erfahrungen der Mangelgesellschaft gekoppelt. Die Welt der Psychophysik lässt sich nicht so einfach abschütteln. An dieser Stelle möchte ich ihnen einen allzu geringgeschätzten, man könnte sagen: von aller Welt vergessenen und verkannten Ökonomen vorstellen. Sigmund Freud. Wie man weiß, hat Freud über die Ökonomie des Witzes nachgedacht. Nun: wenn Sie den Verweis auf die Ökonomie nicht als Abseitigkeit, sondern als Betonung des zentralen Parameters auffassen, erschließt sich seine Lehre als Witz der Ökonomie. Denn der Witz ist das ideale kapitalistische Gut. Einmal erzählt, entfaltet er seine ganze Kraft – und ist sogleich vernichtet. Der Witz ist ein Gut, das mit seinem Erscheinen die eigene Selbstvernichtung besorgt – denn es ist ja nicht besonders lustig, einen Witz eines zweites Mal hören zu müsse. Zugleich vermag er, wovon all die Kühlschrankhersteller immer geträumt haben: er schafft eine Nachfrage nach einem anderen, neuen Witz. Er ist ein heißes Gut, das verglüht. In diesem Sinn verfügt der Witz (wie eine mathematische Formel) über eine maximale Zeitdichte. Er ist die Verknappung eines komplexen Zusammenhangs zur Formel.
Nimmt man den Witz als Prototyp der kapitalistischen Warenproduktion, so ist leicht einsehbar, dass eine jegliche Güterproduktion, die dieser Logik folgt, sich einer Form der Scherzartikelökonomie anverwandeln muss.
Man muss nicht weit schauen, um sich von der Stichhaltigkeit dieser ökonomischen Lehre zu überzeugen. Wenn Produkte heute nunmehr über die ihnen assoziierte Suggestivkraft, ihre Aura und ihr Flair verkäuflich sind, so deswegen, weil hier längst die Einbildungskraft thront.
Damit aber kommen wir zum Dilemma dieser Ökonomie. Es ist keineswegs leicht, Witze zu reißen. Wenn der Witz witzig ist, so deswegen, weil sich ein überaus komplexer psychischer Zusammenhang auf eine Kurzform bringen lässt, weil er’s vermag, entfernte psychische Regionen psychologistisch auf die kürzeste Art und Weise miteinander zu verbinden, so ist plausibel, dass die Aufforderung nach noch mehr Witz die härteste Arbeit bedeutet. – Ich erinnere mich, aber das ist ein Seitengedanke, an den Augenblick, als die Tagesschau die Nachricht vom Tod des Fernsehproduzenten Michael Pfleghaar verkündete. Das war noch zu einer Zeit, als die öffentlichen Sender diesen staatstragenden Ton pflegten – und da verkündete die gute Eva Hermann nach der Todesnachricht, dass Michael Pfleghaar sich auf seinem Erdenleben vor allem durch die Produktion der Sendung Klimbim große Verdienste erworben habe – und das war wirklich ein merkwürdiger Augenblick. Denn da stand ein Freund neben mir, der der aussterbenden Gattung des Bildungsbürgers angehört, und sagte ganz entsetzt: Stell dir mal vor, du stehst vor Petrus und der fragt dich, was Du auf Deinem Erdenleben gemacht hast – und alles, was Du entgegnen kannst, ist Klimbim.
Worum es letztendlich geht, ist die Tatsache, dass die Arbeit uns zu Kopfe steigt, dass es nicht mehr um Kraft, sondern um Einbildungskraft geht. Der Terminus (der auf den strengen Kant zurückgeht, dessen Wurzeln aber in der Theologie des Meister Eckhart, also im Spätmittelalter liegen) ist insoweit hilfreich, als er die Welt des Phantasmas einschließt: die Welt der Wünsche, Träume etc. Damit ist gesagt, dass auch die Arbeit am Phantasma Arbeit ist, dass Träume, insoweit sie in Traumfabriken hergestellt und vertrieben werden, auf dem Feld der Ökonomie betrachtet und verhandelt werden. Da kommen wir zu einem nächsten Punkt. Das größte Paradox, und zugleich das größte Dilemma der Einbildungskraft, liegt darin begründet, dass hier nicht im vorhinein schon auf der Hand liegt, was gut ist. Auch eine Fehlleistung – diesen Gedanken verdanken wir Freud – kann eine Leistung sein. Und weil das Gute falsch, und das falsche gut sein kann, haben wir es mit einer Umwertung aller Werte zu tun, und zwar nicht, weil uns dies der Philosoph von der Eiseskälte der höheren Gedankenregionen herab verkündet, sondern weil die Konsumenten, die dort ihre Fernbedienung bedienen, exakt das produzieren, was ihnen frei Haus geliefert wird. Und diese Produkte einer entfesselten Einbildungskraft übersteigen all das, was eine noch so verwegene Phantasie sich vor ein paar Jahren hätte ausmalen können. Die freundliche Lieschen Müller und ihr Ex-, der selige Ottonormalverbraucher, entpuppen sich als keineswegs berechenbar, als normierte Alphamännchen, sondern sind polymorph perverse Wesen, Wesen, in denen das kollektive Unbewusste pulsiert. Hier liegt eine Zäsur, die die Ökonomie der Einbildungskraft aus der Vergangenheit herauslöst. Nehmen Sie, nur als Beispiel, die Marxsche Idee vom Gebrauchswert. Das ist der Gedanke, dass in den Dingen ein Nutzen inkorporiert ist, dass sie zu etwas bestimmtem gut sind und mit Nutzen gebraucht werden können. Dahinter steckt, als versteckte Grundannahme, eine Art Nützlichkeitstheorie, der Utilitarismus und der Fortschrittsgedanke der Moderne. Nun ist es aber so, dass Wert auch dort gebildet wird, wo etwas ganz und gar Unnützes, Überflüssiges, scheinbar Sinnloses hergestellt wird. Und so kann auch das Missbrauchenlassen zum Gebrauchswert werden, wäre es ebenso zulässig, von einem Missbrauchswert zu reden (was, wenn man des Nachmittags den Fernseher einschaltet und all die beklagenswerten Opfer sieht, die da ihr Missbraucht-Worden-Sein in klingende Münze umwandeln, ein probates Gedankenwerkzeug darstellt). Ganz allgemein lässt sich sagen: unter dem Rubrum der Einbildungskraft werden wir nicht mit dem konfrontiert, was ein Ökonom ein Gut nennt, sondern mit dem, was wir selber goutieren – und das heißt: Wir werden mit uns selbst konfrontiert, unseren Perversionen, Aberrationen, unserer Gespaltenheit.
Ich habe gesagt, dass wir Geld persönlich nehmen, aber dass es zugleich die allgemeinste Sache der Welt ist – jenes tertium comparationis, das die Metamorphose von Dingen in andere Dinge, von Phantasmen in andere Phantasmen besorgt. Allerdings: und das ist das Verstörende am derzeitigen Zustand: auch das Geld ist vom Schwindel der Einbildungskraft affiziert. Mit der Ablösung vom Goldstandard hat sich das Geld von jener materiellen Ordnung abgelöst, wie sie sich seit dem 14. Jahrhundert langsam, tastend und unter großen Mühen herausgebildet hat – und genau das ist es, was in Bretton Woods intellektuell vollzogen wird. Insofern macht Bretton Woods nicht bloß Schluss mit der Golddeckung, sondern (wie ich viel umfassender sagen würde) mit der Welt des Räderwerkautomaten überhaupt, mit dem Betriebssystem der Psychophysik.
Was aber war die Funktion dieser Golddeckung? – Gold war das Äquivalent für Knappheit, es besagte, dass unser Reichtum nicht nach Belieben ausgedehnt werden kann. Um diese Funktion eines Nicht-beliebig-zu-Vermehrenden auszudrücken, gab es das Gold – gab es andererseits den Souverän, die Zentralbank, deren Funktion darin bestand, die Härte der Münze (und das Daseins) in angemessen Form widerzuspiegeln. Zwar gibt es noch immer Zentralbanken, aber im Zustand des free floating gibt es keine Instanz mehr, die das Zeichengebilde zu zähmen vermag. Das frei fließende Geld, wenn Sie so wollen, stellt so etwas wie kursierende Libido dar. Winkt irgendwo eine Objekt des Begehrens, dockt sich das Kapital an und hofft auf wundersame Selbstvermehrung – was uns in die Abgründe der bubble economy geführt hat, einer globalen Schaumschlägerei, deren Blasenwurf in mehr oder minder großen Abständen in sich zusammenfällt. – An dieser Stelle, wo sich im allgemeinen Klagestimmen und Untergangsvisionen erheben, lässt sich die Frage stellen, ob die Knappheit, die früher über das Gold besorgt wurde, nicht doch ein Substitut gefunden hat. Die Antwort ist sehr einfach und und sie lautet ja. Abermals ist es die Einbildungskraft, die hier die vorherrschende Rolle spielt. Genauer: es ist ihr allgemeiner Ausdruck: die Aufmerksamkeit, also der Zustand meiner Sinnesreizung, in dem sich ausdrückt, in welchem Maße meine Einbildungskraft mit Beschlag genommen wird. Mögen sich die Produzenten irgendeines Gutes abstrampeln, mir seine Güte vor Augen zu führen, so steht es mir frei, meine Aufmerksamkeit darauf zu richten oder nicht. Entzündet dieses Gut meine Einbildungskraft, so werde ich darauf verweilen – wenn nicht, dann eben nicht. Im Supermarkt, in der totalen Überproduktion ist das einzige, was sich nicht vervielfältigen lässt, meine Zeit und meine Aufmerksamkeit. Insofern ist es kein Wunder, dass ein regelrechter Kampf um die Aufmerksamkeit um des Konsumenten entstanden ist, dass man mit Georg Franck von einer Ökonomie der Aufmerksamkeit reden muss. Vielleicht wird Ihnen jetzt der Vortragstitel plausibler. Tatsächlich liegt hinter diesem scheinbar spielerischen Titel eine sehr klare ökonomische Logik. Anders als im klassischen Kapitalismus, der die Zeit des Räderwerkautomaten in Geld verwandelt (und im Gold jene Hemmung findet, die das Betriebssystem vor dem Leerlauf schützt), findet das Geld nicht mehr zu einem Repräsentanten. Die begrenzte Zeitmenge des Konsumenten selbst ist das Kapital, um das es geht. Setzt man dies voraus, wird das Kalkül absurd anmutender Geschenkoperationen verständlich – etwa die Offerte, frei telephonieren zu können, wenn ich mich denn bereitfinde, soundsoviel Werbezeit über mich ergehen zu lassen.
Interessanter jedoch als die Frage der Konsumption – aber das ist nur eine persönliche Macke – finde ich die Frage der Produktion. Und hier fasziniert mich das Feld, das sich der Einbildungskraft öffnet. Insofern der Computer ein Engramm meiner Arbeit speichern und beliebige, und das heißt auch: beliebig komplexe Aktionen aus dem Arbeitsspeicher hervorrufen kann, bin ich dazu imstande, der Maschine hochkomplexe Prozesse einzubilden, Prozesse, die ich freihändig niemals zu bewerkstelligen vermöchte. Allein dieser Umstand markiert eine unglaubliche Revolution. Der Begriff der Arbeit (der sich über lange Zeit in immer verästeltere, engere Tätigkeiten aufgeteilt hat) erlebt plötzlich eine unglaublich Erweiterung. Mit dem Computer, als der Universalen Maschine, ausgerüstet, lassen sich Tätigkeitsfelder wieder zusammenführen, die früher nur von arbeitsteiligen Sozialaggregaten hätten bewerkstelligt werden können. Anders gesagt: Wurde meine Einbildungskraft bislang von den Mauern des Sozialen aufgehalten, von eifersüchtigen Zunftwächtern, Geheimniskrämern und Abschottungspezialisten, so erlaubt das free floating der Information eine gedankliche und praktische Expansion, die ihresgleichen sucht.
Wenn heute nur von den Problemen des Arbeitsmarktes die Rede ist, so scheint mir vor allem ein Mangel an Einbildungskraft. Wir haben, in der Fixierung auf die Psychophysik, dieser Ressource noch gar nicht wirklich ins Auge gefasst. Insofern wäre es vielleicht wirklich passender gewesen, wenn ich Ihnen diesen durch und durch redundanten Vortrag nicht gehalten – sondern Sie mit meiner Maschine allein gelassen hätte. Andererseits hätte mich ein solch rationales Vorgehen um das Vergnügen gebracht hat, das vielleicht das Höchste ist: nämlich dass der eine oder andere unter Ihnen mir vielleicht gerne zugehört und nicht bloß meinen Wert, sondern meine Würde gebilligt hätte.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Themenverwandt
Postmoderne Etikette
Norbert Elias hat in seinem Nachdenken über Die höfische Gesellschaft das Bild des Höflings gezeichnet, der, sozial und ökonomisch entwurzelt, im höfischen Leben Versailles’ eine Art Ersatzbestimmung gefunden hat. Ruft man sich die grotesken Verrenkungen in Erinnerung, zu denen die Etikette die Höflinge ver…
Cyborg Psychology
One of the peculiarities of the Artificial Intelligence Discussion is this conviction that it's only about replacing the human being, while there's hardly a thought given to the fact that what we've put into the world is nothing other than a magic mirror reflection of ourselves- and that this instance will necessarily change our self-image as well.