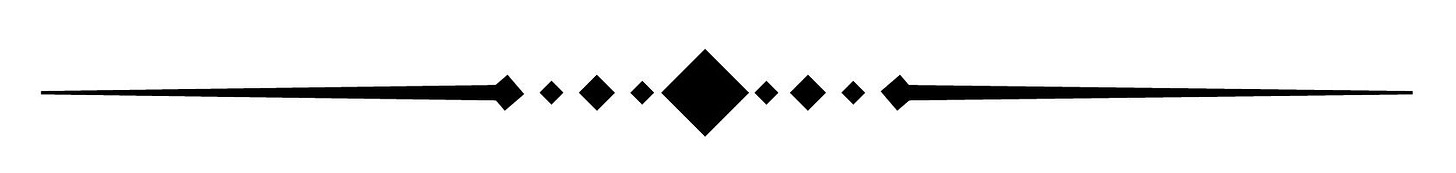Wie modern es doch war, dass sich vor langer, langer Zeit eine Band den klangvollen Namen Einstürzende Neubauten geben konnte – umsomehr als das Dach der Berliner Kongresshalle (im Berlinerischen ›Schwangere Auster‹ genannt) diesem dernier cri nachkam und kurzerhand einstürzte. Mag derlei längst Geschichte sein, hat sich das Dilemma der einstürzenden Neubauten keineswegs erledigt. Denn erst kürzlich haben die Berliner gewahren müssen, dass nicht nur eine Brücke der Stadtautobahn wegen Einsturzgefährdung abgerissen werden muss, sondern dass einem Zehntel der städtischen Brücken das nämliche Schicksal droht. Selbstverständlich stellt sich die Frage, wie es den Verantwortlichen gelingen konnte, die Augen vor einer Katastrophe mit Ansage zu verschließen. Und umgekehrt: Was wäre wohl passiert, wenn das monatliche Gehalt für die Herren Staatssekretäre ausgeblieben wäre? Hätte dies zu einem Sturm der Entrüstung geführt, bezeugt das gesammelte Schweigen der Verantwortlichen, dass man es mit einem flagranten Institutionenversagen zu tun hat.1 Begnügt man sich üblicherweise mit einem Achselzucken und dem Stoßseufzer, dass die Bürokratie ein träges Monster sei, könnte man daran erinnern, dass die preußische Bürokratie innerhalb eines halben Jahrhundert eine Stadt mittlerer Größe zu einer 2-Millionenstadt aufbauen konnte, ja, dass die preußischen Planer dabei eine geradezu beängstigende Effizienz an den Tag legten.2 Nun sind die Brücken nur das Symptom einer sehr viel tiefer gehenden Krise, die sich in allen erdenklichen Gesellschaftsbereichen artikuliert – und sie betrifft gleichermaßen Schulen, Universitäten, das Gesundheitssystem, die Arbeitsagentur, die Öffentlich-Rechtlichen Sendeanstalten, Bundeswehr, name it. Dass man mit großem Aplomb ein Bürgergeld einführte, um letztlich konstatieren zu müssen, dass bis zu 70% der dadurch entstandenen Kosten Verwaltungsaufwendungen darstellen,3 ist ein Skandalon, für das bislang niemand, und sei es auch nur in symbolischer Form, hat geradestehen müssen. Nun wäre, was man Staatsversagen nennen könnte, sehr viel treffender wohl als ein Generationenprojekt zu begreifen. Denn so wenig wie eine Brücke über Nacht gefährliche Risse aufweist, so wenig lässt sich ein Erziehungssystem mit einem Handstreich in die Dysfunktionalität überführen – dafür bedarf es schon einer gemeinsamen Anstrengung. Oder genauer: einer Ausblendung eben derselben. Haben die mittelalterlichen Theologen dafür die Todsünde der acedia ersonnen, ist in der säkularisierten Welt die Erinnerung an die Trägheit des Herzens entschwunden, ja scheint auch das Verständnis dafür entglitten zu sein, warum man die chronifizierte Unterlassungssünde ehedem den Todsünden zugerechnet hat. Und dies führt zu der Frage, um die es in diesem Text gehen soll – nämlich wie es überhaupt zu einem solchen Niedergang kommen kann: Wie ist es möglich, dass eine Institution in eine systemische Dysfunktionalität abgleitet?
Die großartige Anthropologin Mary Douglas (der sich ein ganzes Buch über die Institutionen verdankt) hat einmal die treffende Bemerkung gemacht, dass Institutionen Antworten auf Fragen sind, an die man sich nicht mehr erinnert. Folgt man dieser Deutung, ist immerhin verständlich, dass und warum mit der Institutionalisierung stets auch die Gefahr eines Stillstandes, mehr noch, die eines Rückschrittes einhergeht. Der Philosoph Heidegger hat den Begriff der Institution auf das deutsche Wort der Einrichtung zurückgeführt, nicht zuletzt deswegen, weil die darin enthaltenen Zielvorgabe (die Richtung) klar macht, dass man es letztlich mit einem gesellschaftlichen Drive zu tun hat, einem Triebwerk, das die Gesellschaft in eine bestimmte Richtung steuern soll. Von daher könnte man das Vergessen der Ausgangsfrage als eine lässliche Nebenerscheinung abtun, kann man sich dem Glauben hingeben, dass die Institution (fast im Sinne eines Luhmann’schen autopoietischen Systems) die Gesellschaft schon in die richtige Richtung treiben wird. Um ein Beispiel zu geben: Wenn heutzutage die Schule als unhinterfragte Selbstverständlichkeit gilt, vergisst man, dass die Einführung der Schulpflicht im 18. Jahrhundert keineswegs auf einhellige Begeisterung stieß. So revoltierte die Bauernschaft, welche ihren Nachwuchs zur Arbeit auf dem Felde benötigte, dagegen – weswegen die Obrigkeit für die Zeiten der Aussaat, des Jäten und Erntens Ferien einführte. So besehen markiert das Vergessen, das die Institution mit einer Aura der Selbstverständlichkeit ausstattet, geradezu einen Gewinn. Dem Newton’sche Trägheitsgesetz folgend, das besagt, dass ein Körper seinen Bewegungszustand beibehält, solange keine äußere Kraft auf ihn einwirkt, tut die Institution ihren Dienst. Problematisch wird das institutionelle Vergessen erst dann, wenn es zu einer Richtungsänderung kommt – und die Institution sich als unfähig erweist, sich auf die neuen Verhältnisse einzustellen. Damit wird die institutionelle Trägheit offenbar – und es zeigt sich, dass man es mit keiner Selbstverständlichkeit zu tun hat, sondern einem gesellschaftlichen Artefakt, der auf der Höhe der Zeit, dem state of the art entsprechend unterhalten werden muss. Gelingt dies nicht, schlägt jene Niedergangslogik durch, die Otto von Bismarck in ein Bonmot übersetzt hat:
Die erste Generation schafft das Vermögen, die zweite verwaltet es, und die dritte studiert Kunstgeschichte.
Wird die drohende Insolvenz im Wirtschaftsleben schnell ruchbar und führt dazu, dass sich das entsprechende Unternehmen aus dem Markt verabschiedet, ist die Abwärtsbewegung im Falle eine öffentlich-rechtlichen Institution einer sehr diffizilere Angelegenheit. Denn selbige ist, auf Bestand angelegt, der Peinlichkeit enthoben, sich als profitabel erweisen zu müssen.
Ein Lehrstück
Meinerseits war ich ein junger Mann, als ich mich unversehens mit dieser Problematik konfrontiert sah. Es war noch vor dem Fall der Mauer – und mir war die Aufgabe zugefallen, im Tonstudio eines öffentlich-rechtlichen Senders ein eigenes Manuskript in Szene zu setzen. Dass man, statt diese Aufgabe einem der hauseigenen, hochbezahlten Regisseure anzuvertrauen, mir dieses Privileg zugestanden hatte (und eine ganze Woche Postproduktions-Zeit noch dazu), hatte damit zu tun, dass ich zuvor schon, über eine Eigenproduktion4, meine »Medienkompetenz« unter Beweis gestellt hatte. Weil die Abteilung des Senders, schon damals ein Ausnahmefall, sich unter dem Rubrum der Klangkunst der Produktion hochwertiger audiophiler Produktionen verschrieben hatte, war ich nicht übermäßig verwundert, beim Betreten des Studios eine Mehrspurmaschine zu entdecken. Hocherfreut bemerkte ich, dass sich damit doch wunderbar arbeiten ließe. Der Toningenieur jedoch wandte hastig ein, die Maschine sei defekt – was, wie mir mein Redakteur später gestand, nichts weiter als eine Notlüge war, dem Umstand geschuldet, dass die Maschine seit ihrer Aufstellung kaum in Betrieb gewesen sei, einfach deswegen, weil niemand der Studiomitarbeiter gewillt gewesen war, sich damit auseinanderzusetzen. Weil man stattdessen auf den menschlichen Faktor setzte, war ich, statt das Material auf intelligente Weise zu montieren, die folgenden Tage damit beschäftigt, zwei Assistentinnen in einer absurden Choreographie von einem Bandgerät zum anderen zu hetzen – was den Mischvorgang zu einer wilden Improvisation werden ließ. Weil mir dies, was meine eigenen Arbeiten anbelangte, ein absurdes, nein, mehr noch: ein zutiefst kontraproduktives Theater erschien, ging ich in der Folgezeit dazu über, nurmehr die Schauspieler-Aufnahmen im Sender zu machen, das Material jedoch selber zu schneiden und zu einer Sendung zu montieren. Dass ich dennoch, über gute 7 Jahre hinweg, in den zweifelhaften Genuss kam, die absurden Tänze im Sender aufzuführen, hatte damit zu tun, dass ich mit einem Redakteur des Senders ein gemeinsames Schauspiel-Seminar an der Hochschule der Künste veranstaltete. Und weil dies in ein einstündiges Radiofeature einmündete, war ich Jahr für Jahr mit der Tonstudio-Situation konfrontiert – und konnte mithin verfolgen, wie das Personal, im Digitalisierungsverweigerungmodus eingemauert, sich zu einer Wagenburg, einer „analog besetzten Zone“ wandelte. Aber weil die digitale Welt dort draußen ihren Lauf nahm, ging auch das tabuisierte Mehrspurgerät letztlich in den Computer ein, wie der Maschinenpark des Tonstudios überhaupt – eine Metamorphose, die ich im Tonstudio von Johannes Schmölling, einem Musiker von Tangerine Dream, mit dem ich über viele Jahre hinweg an gemeinsamen Produktionen gearbeitet hatte, handgreiflich vor mir hatte. Weil ich Johannes zur Mitarbeit am Hochschulseminar überredet hatte – und wir fortan nicht nur Schauspieler, sondern auch Tonmeisterstudenten an der Hochschule der Künste betreuten, verfiel der Redakteur des Senders irgendwann auf die Idee, dass man den Studenten doch einmal vorführen könne, wie die Profis im Sender arbeiteten. Natürlich war dieser Gedanke vollkommen unsinnig, besaß die Hochschule doch schon Anfang der 90er Jahre ein digital hochgerüstetes Tonstudio. Aber weil der Redakteur darauf bestand, fanden sich irgendwann ein halbes Dutzend Tonmeisterstudenten ein, um dem Spektakel beizuwohnen. Allerdings dauerte es keine fünf Minuten, bis der erste zu mir kam und mir ins Ohr flüsterte: »Sag mal, Martin, meinen die das ernst?« War einem Studenten nach ein paar Minuten klar, dass sich hier ein digitaler Analphabetismus austobte, war die Einsicht, dass die digitale Welt nicht nur neue Produktionsformen einforderte, sondern zugleich auch eine ästhetische Revolution, ja eine enorme Erweiterung des Vokabulars darstellte, den Akteuren im Sender nicht im einmal in Ansätzen klar. Man machte einfach weiter wie bislang und wurde nicht müde zu betonen, dass man im Gegensatz zur kalten, unpersönlichen Computerwelt mit dem Menschen, dem wahren Leben beschäftigt sei. Je weiter man technologisch, aber auch ästhetisch zurückfiel, desto mehr ergingen sich die Betreffenden in einem absurden Produktivitätstheater, wurde bereits eine nicht vollends misslungene Mischung mit Applaus bedacht. Auf untergründige Weise jedoch waren den Beteiligten durchaus bewusst, dass sie sich vom Rest der Welt längst verabschiedet hatten. So fragte mich ein Tonmeister, dem ich irgendwann auf dem Flur des Senders in die Arme lief, ganz im Vertrauen, ob ich glaubte, dass man dort draußen noch jemanden wie ihn gebrauchen könne. Mochte eine solche Frage, senderintern jedenfalls, ein Tabugegenstand darstellen, waren die Redakteure, mit denen ich über die Jahre zusammengearbeitet hatte, einem Außenstehenden wie mir durchaus freimütig gegenüber. Hatte mir eine Redakteurin des Norddeutschen Rundfunk, die eine meiner außer Haus produzierten Sendung gekauft hatte, mit einem Stoßseufzer mitgeteilt, sie befände sich nicht bloß in einer Anstalt, sondern in einer großen Geldvernichtungsmaschine, war mein Redakteurs-Kollege, mit dem ich gemeinsam das Hochschulseminar machte, überzeugt, dass er der letzten Generation angehöre (und dies wohlgemerkt in den frühen 90er Jahren). Und in diesem Sinn war die Bemerkung, dass man sich in einer Anstalt befinde, eine eher milde Kritik an den Zuständen. Auch wenn man dies niemals öffentlich eingestanden hätte, war sich ein jeder darüber im Klaren, dass sich die Anstalt längst von der Welt verabschiedet hatte. Am befremdlichsten an alledem aber war, dass die sich langsam, wie Mehltau ausbreitende Dysfunktionalität der Anstalten nicht auf externe Stressoren zurückzuführen war. Weder waren die Beteiligten einer allzu übergriffigen Programmdirektion noch einer Form des Mikromanagements ausgesetzt. Auch Geld war kein Problem – wusste ein jeder festangestellter Redakteur oder Tonmeister doch, dass er mit 90% seiner Bezügen würde in Ruhestand gehen können, ein Umstand, der nur dann ein Gefühl von Peinlichkeit aufkommen ließ, wenn man den Autoren (also denjenigen, welche die Welt in den Sender hineinbrachten) die Begrenztheit der Mittel klarmachen wollte. Paradiesische Zustände, alles in allem. Gleichwohl war, der fürstlichen Bezüge und der vollständigen Absicherung zum Trotz, eine merkwürdige Leere, ja eine tiefe Unzufriedenheit spürbar. Man könnte von einem Luxusproblem sprechen, einem Ennui, der darauf zurückführen war, dass man den Glauben an die Bedeutung der eigenen Arbeit verloren hatte. Genau hier fand sich das Einfallstor für eine Innovation, die noch in der Rückschau höchst sonderbar anmutet: die Entscheidung der Sender nämlich, die eigene Arbeit der Quote unterzuordnen, ja, selbige überhaupt als das entscheidende Qualitätsmerkmal zu begreifen. Zunächst einmal gab es auch hier keinerlei Notwendigkeit. Weil die Gebühren über den Staatsvertrag abgesichert waren, weil man darüberhinaus den Auftrag hatte, »Beiträge insbesondere zur Kultur anzubieten«5, war niemand genötigt, sich auf einem wie auch immer gearteten Markt zu behaupten. Ganz im Gegenteil: So wie man dereinst sich der Förderung der Klangkunst verschrieben hatte, wäre es nur logisch gewesen, auch im Bereich der neuen Medien Pionierarbeiten zu leisten. Dass man, anstatt sich der digitalen Zukunft zuzuwenden, Anfang der 90er Jahre dazu überging, die Relevanz des eigenen Tuns an die Quote zu heften, hatte mit jenem schleichenden Bedeutungsverlust zu tun – der schockhaften Einsicht, dass bestimmte Sendungen unterhalb der Messbarkeitsschwelle lagen. Dass dies auf die geistige Bequemlichkeit, aber auch dem Verlust des Qualitätsbewusstseins hätte zurückgeführt werden können (»Meinen die das ernst?«), war sowenig Diskussionsgegenstand, wie es den Akteuren im Tonstudio je in den Sinn gekommen war, sich auf die teuer erworbene Mehrspurmaschine einzulassen. In diesem Kontext war die Quote der Ausweg, der einen jeden von der Verantwortung für das eigene Handeln freisprach.6 Konnte man fortan, mantragleich, behaupten, dass man doch nur damit beschäftigt sei, das Publikum mit dem zu beliefern, wonach es ihn dürste, lag der Kunstgriff doch darin, dass man mit dieser Argumentation sich alles vom Hals schaffen kann, was irgendwie unbequem oder unvertraut war. Und weil sich mit dem Gang in die Limboökonomie eine Gedankenträgheit breit gemacht hatte, die sich, je nachdem, auch als populistischer Ungeist oder als Intellektuellenfeindschaft gebärden konnte, fand es eine Cutterin dieser Tage keineswegs absonderlich, einen Autor wie mich dafür zu rüffeln, dass meine Gedanken doch keineswegs Mehrheitsfähigkeit für sich beanspruchen könnten. Aber der wahre Kunstgriff bestand darin, dass man sich auf diese Weise die Ratio vom Hals geschafft, die dort draußen, in der digitalen Hinterwelt, längst zum Alphabet der Audio- und Videoproduktion geworden war.
Nun mag dieses Lehrstück eine persönliche Seite aufweisen, gleichwohl steht es stellvertretend für den öffentlich-rechtlichen Raum überhaupt, genauer: für ein Institutionsversagen, das sich auf breiter Front beobachten lässt. Wann immer sich mir in der Folgezeit Einblicke in die Anatomie einer staatlichen Organisation darboten, stach mir eine Variation dieser Geschichte ins Auge.7 Wenn Mary Douglas die Institution als eine Form des gesellschaftlichen Unbewussten begriffen hat, könnte man schlussfolgern, dass jede Form der Normalität in ein Vergessen, ja in ein Trägheitsgesetz einmündet. So weit, so unspektakulär: Nichts Neues unter der Sonne! Was dieses Lehrstück jedoch vom institutionellen Trägheitsgesetz unterscheidet, ist der Umstand, dass die Institutionen in Gestalt der digitalen Revolution mit einer gesellschaftlichen Disruption konfrontiert sind, welche die überkommenen Rollen, Arbeitsweisen, ja selbst die Begriffe von Mehrwert, Effizienz und Qualität grundlegend umwälzt. Tatsächlich ist es keineswegs unangebracht, im Tonstudio eine Metapher zu sehen, die das symphonische Orchester ablöst (das Lewis Mumford bereits als eine Gesellschaftsmaschine aufgefasst hat). Arbeitet hier, einer sorgfältig ausgearbeiteten Partitur folgend, eine Versammlung der Virtuosen arbeitsteilig an einer symphonischen Klangsensation, geht mit dem Tonstudio, das sich des Samples bedient, ein Paradigmenwechsel einher. Nicht bloß, dass bereits in den frühen 90ern der Maschinenpark des Tonstudios im Computer verschwand,8 auch die Musiker selbst wurden zu Gelegenheitsgästen. Trommelte Bernard Hermann, um die Filmmusik zu Hitchcocks Psycho in Szene zu setzen, dazu noch ein ganzes Orchester zusammen, operieren die heutigen Filmkomponisten fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Nun war es keineswegs so, dass die Akteure der Anstalt sich über den Wandel im Unklaren gewesen, der ihnen ins Haus stand – war ihnen doch, wenngleich auf eher nebulösen Weise, klar, dass der Einbruch der Digitalisierung grundstürzende Veränderungen zeitigen würde. Umso verräterischer aber der Beharrungswunsch, die tiefe, entschiedene Bereitschaft, sich dem Neuen nicht aussetzen zu wollen. Demgemäß ließe sich der Stoßseufzer meines Kollegen (»Wir sind die Letzte Generation«) als eine Form der Gegenwartsverweigerung begreifen, als ein klammheimliches Ludditenwesen. Klammheimlich deswegen, weil man – anders als die Weber des frühen 19. Jahrhunderts – nicht genötigt war, die Maschinen niederzureißen, sondern sie als Fremdkörper einfach außen vor lassen konnte. Und es war niemand genötigt, sich dies selbst gegenüber einzugestehen.
Mochte sich die Belegschaft der Institution einreden, dass man, anders als die seelenlose Computerwelt, die wahre Humanität verkörpere (eine Realpräsenz-Argumentation, auf die noch die Lehrerschaft in der Corona-Zeit zurückgriff), so bekümmert sich die ausgesperrte Rationalität nicht um irgendwelche Sentimentalitäten, sondern – entwickelt sich weiter. Die Folge ist eine wachsende Kluft, eine zunehmende geistige Rückständigkeit. Die Frage ist: Wie reagieren die Zurückgebliebenen auf eine solche Drohung, die schon deswegen als brandgefährlich erlebt wird, weil sie auf eine Ratio zurückgeht, also eine Rationalisierungsdrohung darstellt? Hier kommt jener Verdrängungsmechanismus ins Spiel, der im Bild des langsamen Tankers enthalten ist, in seiner psychologischen Dimension jedoch nicht deutlich erfasst ist. Denn wenn das Kollektiv weitermacht wie bislang, vermittelt das wachsende Rationalitätsgefälle das Gefühl, dass man sich auf einem untergehenden Boot befindet. Eine Lösung, mit der man sich über das innere Vakuum hinwegzutrösten vermag, ist, dass man sich auf andere Weise einen Bedeutungszuwachs verschafft. Dies vor Augen, versteht man, dass und warum die öffentlich-rechtlichen Sender in die Quote hinein geflüchtet sind. Denn mit der Fokussierung auf das Publikum (das man, wie das Mantra lautete, dort abholen müsse, wo es sich gerade befinde) wurde das Mittelmaß, nein, wurde die Rückständigkeit selbst zum Programm, konnten sich die Programmverantwortlichen aus jeder Verantwortung stehlen. Nun ist das Dilemma der Quote, das man damit in eine Limbo-Ökonomie abgleitet, an deren Ende der Kitsch und das Groschenheft stehen, Sex & Crime. Und weil diese Selbsterniedrigung mit dem großartigen Selbstbild des Volkspädagogen nicht zusammengehen will, musste ein Ausweg her, ein Ausweg, der die Betreffenden vor der Rationalitätsdrohung der Gegenwart verschonte. Hier wird die besondere Anziehungskraft verständlich, die von der moralischen Erregung ausgeht. Sie stiftet Dringlichkeit und verleiht dem Botschafter eine höhere Legitimation. Marshall McLuhan hat dies in einem wunderbar boshaften Aperçu auf den Punkt gebracht:
Moralische Empörung ist eine grundlegende Technik, um einem Idioten Würde zu verleihen.9
»Schuld und Reue«, so fährt McLuhan fort, »sind per definitionem rückwirkend und entbinden den Schuldigen von jedem erlösenden Akt der Sühne oder schöpferischen Erneuerung. Schuld und Reue sind Formen von Verzweiflung und Trägheit.« Weil der Moralist, um der Ratio der Gegenwart zu entkommen, die Schlachten der Vergangenheit schlägt, hat man es letztlich mit einer camouflierten Form des Eskapismus zu tun, einer Wiederherstellungslogik, die dem beschädigten Narzissten ein Gefühl des Great Again! erlaubt. In diesem Sinn ist die Ausweichbewegung in die Hypermoral, die wir als »Aufstand der Anständigen« im Politischen allüberall besichtigen können, Zeugnis der Rückständigkeit - ebenso wie sie Ausdruck eines Vakuums ist. Man könnte von einem invertierten Nihilismus sprechen: Selbsthass, der nach außen projiziert wird. Und weil hier die Rollen verteilt, Gut und Böse sorgsam voneinander geschieden sind, mag sich der Moralist in einem edlen Schaustück gefallen – ist sichergestellt, dass jeder Gedanke an die schöpferische Selbsterneuerung außen vor bleibt. Ein solcher Blick auf den Nihilismus mag überraschen – widerspricht er doch dem Bild des Anarchisten, dessen Unzufriedenheit mit der Welt sich in einer Bombenexplosion entlädt, ebenso wie er nicht mit dem Nietzscheanischen Gott ist tot!-Pathos zusammengehen will. Erinnert Nietzsche bei seinem »Alles ist erlaubt!« noch daran, dass dies der Leitspruch des Assassinen-Ordens war und die Tötung der Feinde legitimierte, hat sich das Anything goes in eine postmoderne Wurschtigkeit verwandelt, ein vages Leeregefühl. So unerträglich ist diese Leere, dass man das Skandalon, das man doch selber verkörpert, auslagern muss – was die Allgegenwart des metaphysischen Nazis (Matthias Brodkorb) erklären mag. In der longue durée jedoch zeigt sich, dass die Empörung, mit der sich der Zurückgebliebene gesellschaftliches Ansehen verschafft, nicht wirklich tragfähig ist. Denn wenn die institutionelle Trägheit Brücken und Schuldgebäude einstürzen lässt, wird die Kluft zwischen moralischer Ökonomie und institutioneller Dysfunktionalität selbst zum Skandal. In diesem Sinn sind die einstürzenden Bauten nur der materielle Ausweis eines lange kultivierten, sorgsam verborgenen Vakuums. Spätesten jetzt stellt das staunende Publikum fest, dass die hochbezahlten Akteure sich einer psychischen Inflation hingegeben haben – dem Ethos der Phrase. Hier freilich kommt es zu einem Paradox. Denn weil die Verantwortlichen sich über eine lange, lange Zeit in einem phantastischen Selbst- und Weltbild eingerichtet haben, ist nicht einmal ersichtlich, was genau zu diesem Zusammenbruch geführt hat – und worin die Unterlassungssünden der Vergangenheit bestehen. Folglich ist es nicht schwer, in ein Bäumchen-wechsel-dich-Spiel einzutreten und die Verantwortung an die jeweiligen Vorgänger weg zu delegieren. Schwieriger wird es dort, wo man einsehen müsste, dass der notdürftig maskierte Nihilismus nur die Maske eine geistigen Rückständigkeit darstellt - und die schwindelnden Höhen der Hypermoral in eine abgründige Weltflucht geführt haben. Hat man sich über all die Jahre in einer Kompetenzsimulationskompetenz gefallen können – einer Potjemkinschen Logik, in der es wirklich produktive Menschen nicht lange aushalten –, nimmt es nicht wunder, dass man auch an der Beseitigung der Missstände scheitert und nur die eigene Impotenz demonstriert. Die Antwort besteht keineswegs darin, dass man sich zur Umkehr veranlasst sieht, sondern dass man die Kritiker, die auf die Missstände hinweisen, der Niedertracht, je, der moralischen Verkommenheit bezichtigt. Dies vor Augen, versteht man, wie das flagrante Staatsversagen in einen Autoritarismus, ja, einen bizarren Neo-Etatismus eingemündet ist … aber das, fürchte ich, ist eine andere Geschichte. Also: Fortsetzung folgt.
Hier eine Bitte an die verehrte Leserschaft. Wenn Sie mir Ihrerseits (und im Vertrauen) ein Beispiel des institutionellen Versagens erzählen wollen, schreiben Sie mir.
Wie desolat die Lage sein muss, wird ersichtlich daran, dass die Berliner Verkehrsverwaltung nun auf LinkedIn nach einem Statiker sucht: Vgl.Tagesspiegel vom 31.3.2025.
Im Jahr 1858 zählte Berlin 458.637 Einwohner, 1900 war die Einwohnerzahl auf fast 2 Millionen angewachsen, genauer: 1.888.848.
Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung siegen ie Kosten für die Verwaltung in den vergangenen zehn Jahren – auch wegen steigender Gehälter – um 39 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro. Das Geld zur Förderung von Bürgergeld-Empfängerinnen und -empfängern indes verharrte bei 3,8 Milliarden Euro.
Rush-hour, gemeinsam mit Hans-Peter Kuhn, 1984.
Diese Bemerkung findet sich im § 11 des Programmauftrags – wie überhaupt die Sonderstellung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sich vor allem aus dem Kulturauftrag herleiten lässt, der Förderung der Künste.
Genau dies ist die Erklärung, die Wolfgang Herles, der dem Problem der Quote ein ganzes Buch gewidmet hat, dafür gegeben hat: Bequemlichkeit. Fortan waren die Redakteure der Pflicht enthoben, sich über Qualitätsmaßstäbe auszutauschen, konnte man doch einfach auf die Quote verweisen:
Eine sehr amüsante Geschichte, die mir in den 2000ern Jahren zuteil wurde, war die eines Leiter einer Raumplanungsbehörde. Hatte dieser seine Untergebenen schon einmal damit aufgeschreckt, dass er einen Pflasterstein aus dem Versammlungsraum geworfen hatte (als eine gleichsam invertierte, revolutionäre Geste), hatte er wenig später die Belegschaft seiner Behörde auf dem Hof antreten lassen und die Frage geäußert, ob jemand glaube, dass die Öffentlichkeit es wohl bemerken würde, wenn es die Institution nicht mehr gäbe. Die Antwort war einhelliges Schweigen – aber das hinderte die Angestellten keineswegs daran, am nächsten Tag wieder im Büro zu erscheinen und sich ihrem Tagewerk zu widmen.
Die heutigen DAWs (Digital Audio Workstations), für deren Funktionalität man in den 90er Jahren Hunderttausende von DM hätte bezahlen sind, sind – wie etwa Cakewalk – ganz umsonst, bieten darüber hinaus bis dato unerhörte Klangbearbeitungswerkzeuge.
Marshall McLuhan: Media Research: Technology, Art and Communication. Routledge 2014, S. 67.
Themenverwandt
Die Abrissbirne
Weil die Frage des Geldes Martin schon in seinem ersten Buch, den Metamorphosen von Raum und Zeit, beschäftigt hat, ist es nicht verwunderlich, dass man es hier mit einem wiederkehrenden Motiv zu tun hat. Der folgende Text stammt aus der Zeit vor der großen Finanzkrise, aus dem Jahr 2005, und stellt eine gründliche Analyse des neoliberalen Denkens dar. …
The Shadow of Things
The Shadow of Things originated in 1996, at a time when museums, suddenly confronted with digital artifacts, had to undertake a re-evaluation of their own collections. And because Martin's Metamorphoses of Space and Time, published in 1994, told the cultural history of our transformation from a mechanical worldview to a digital order, the