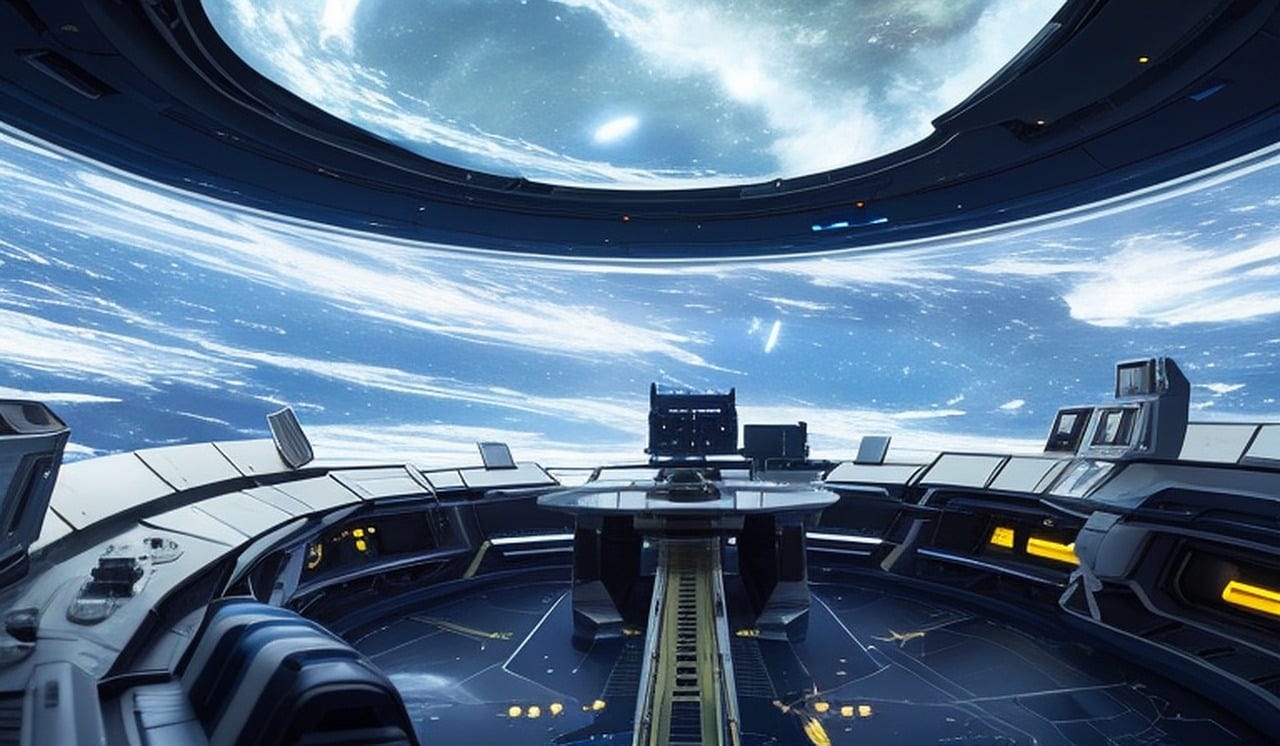Wenn mir die Maschine als eine Art Sehnsuchtsort erschienen ist, so weil sie jenen Punkt markierte, an dem, wie mir schien, die genealogische Kette durchbrochen war, die mich an die Welt meiner Väter und Vorväter gekettet hatte: ganze sieben Generationen von Pfarrern, unterbrochen nur von einem Professor der Anglistik, der ein Lehrbüchlein mit dem Titel „Der kleine Engländer“ verfasst hatte. Umso irritierender jedoch die Entdeckung, dass ich mich geirrt hatte. Ich hatte das Weite gesucht – und war jener Enge begegnet, der ich zu entfliehen gesucht hatte. In gewisser Hinsicht war es wie ein langsam anschwellendes Störgeräusch, ein ortloser Tinnitus, den man noch nicht als solchen identifiziert hat. Es hatte begonnen, als ich in der Staatsbibliothek gesessen war und mir über Stunden die Bilder der Frührenaissance angeschaut hatte. Auf kuriose Weise war schon dies ein Rückstieg in die Welt meiner Kindheit. Denn wann immer ich eine gute Schulnote nach Hause gebracht hatte, wurde ich von einem Vater mit der Postkarte eines Renaissanceporträts ›entlohnt‹ - womit er mir, en passant, klar machen wollte, dass das eigentlich Erstrebenswerte nicht im schnöden Mammon besteht, sondern auf der anderen Seite der Zahl zu finden ist: im Bild, im Inkommensurablen.
Das ging mir durch den Kopf, als ich den Blick über die Kunstbände schweifen ließ, die aufgeschlagen auf dem Tisch vor mir lagen. Zwar war mein Vorhaben, ein Kapitel über die Logik des Augenscheins (genauer: die Gesetzmäßigkeit der zentralperspektivischen Bildverarbeitungsmaschine) zu schreiben, von jener schneidenden Coolness, mit der ich mich zuvor in die Geschichte der Photographie vertieft hatte – gleichwohl wollte sich dieser schnittige Gestus nicht zu dem fügen, was ich dort zu Gesicht bekam: lauter Mariendarstellungen. Ich hatte das Denken der Renaissancephilosophen mit einem philosophischen Abräumkommando verglichen und von einem symbolischen Vatermord gesprochen – aber das Bildmaterial selbst widerstand dieser Deutung. Denn hier war nicht bloß ein theologischer Ballast am Werk, sondern es war klar, dass dem Bildmotiv der annuntiatio (und damit: dem Geist des Vaters) eine mäeutische Funktion innewohnte – ja, dass die Darstellung der Maria, der von einem Engel geweissagt wurde, den Sohn Gottes zu gebären, selbst eine Triebkraft des Neuen darstellte.
Mein Vater war gestorben, noch bevor ich mein Studium beendet hatte. Folglich gab es keine Gelegenheit mehr, ihn zu fragen, warum er ausgerechnet mich auserkoren hatte, mit ihm über theologische Fragen zu debattieren. Vielleicht hatte er die verwegene Hoffnung gehegt, dass es seinen zweitgeborenen Sohn in die Theologie verschlagen würde; wahrscheinlicher war, dass er mir die Rolle eines advocatus diaboli zugedacht hatte, eines intellektuellen Sparringpartners, dem er seine eigenen Gedankengänge würde darlegen können – Gedankenfiguren, die schon seinen Amtskollegen höchst outriert, wenn nicht vollständig kryptisch vorkamen. In jedem Falle bekam ich, kaum vierzehnjährig, die Leben Jesu Forschung des Rudolf Bultmann vorgelegt, der wiederum meinen Vater in die historische Forschung eingeführt hatte, und weil dies nur den Auftakt zu einer regelrechten Diskussionsreihe darstellte, folgte dem Hans Eberhard Mayers Geschichte der Kreuzzüge nach, eine Kriminalgeschichte, die mich heillos schockierte. Gleichwohl verfehlte diese Schocklektüre nicht ihr Ziel. Denn in dem Maße, in dem ich mit der Luther’schen Gnadenlehre und der Idee der Prädestination vertraut gemacht wurde, war mir klar, dass ich bis an Ende der Welt fliehen würde, um dieser neblichten Sprache zu entkommen, dem, was Adorno so treffend den Jargon der Eigentlichkeit genannt hatte. Und jetzt, da ich die Mariendarstellungen vor mir studierte, schien mir dies, wie ich glaubte, tatsächlich geglückt. Ich verspürte keinerlei Ressentiment, was meine Herkunft anbelangte, keinen Abgrenzungswunsch, keine Last, die es abzuschütteln galt. In dem Maße, in dem ich mich meinen eigenen Ideen gefolgt war, war ich einfach aus der Welt des Pfarrhauses herausgetreten – ohne Eifer, ohne Zorn. Umso sonderbarer also die Entdeckung, dass sich mir nun, in Gestalt der annuntiatio, die Rätselfrage auftat, was das Dogma der unbefleckten Empfängnis mit der modernen Bildverarbeitungsmaschine zu tun haben könnte.
Zwar waren meine Metamorphosen von Raum und Zeit bereits erschienen, dennoch ließ mich diese unerledigte Frage nicht los. Und weil ich dem Dogma der Unbefleckten Empfängnis auf den Grund gehen wollte, tauschte ich die Staatsbibliothek gegen die Bibliothek der Katholischen Akademie aus, die damals noch in einer Villa im Westend beheimatet war. War ich bereits zweifelnd an das Unterfangen herangetreten, war die Ausbeute von einer Schlichtheit, die fast noch deprimierender war als, was mir mein Vater zugemutet hatte. Auf eine kuriose Weise durchtönte die mariologischen Texte eine schwer zu ertragende Schwülstigkeit. Vor dem inneren Auge konnte man geradezu sehen, wie die Autoren zu einem Kniefall schritten und von einer Form der Erregung überwältigt wurden, der nurmehr Wortbrocken wie ›Mysterium‹, ›Wunder‹, ›Gnade‹ entfleuchten. Dieser Devotionalienhändel wurde bestenfalls dadurch konterkariert, dass eine wie auch immer geartete Alibifrau, sich auf eine feministische Lesart berufend, den Leser daran erinnerte, dass beispielsweise die Kathedrale von Chartres dort gebaut worden war, wo die Kelten einer Muttergottheit gehuldigt hatten – eine Erdungsmaßnahme, die mir bei der Ergründung der Jungfrauenmaschine noch weniger zupass kam als der mariologische Weihrauch. In meiner Verzweiflung hatte ich gar ein Schreiben an einen katholischen Bischof verfasst, der mir ein halbwegs passabler Partner für einen Gedankenaustausch erschien – aber in dem freundlichen Ablehnungsschreiben, das ich ein paar Tage später erhielt, klang noch immer das Kopfschütteln des Empfängers nach. Irgendwann jedoch bekam ich das Buch eines protestantischen Theologen in die Hand,1 der in positivistischer Manier, wie ein Insektenkundler geradezu, die Geschichte des Dogmas nachgezeichnet hatte. Und je tiefer ich mich in diese Geschichte versenkte, desto mehr begriff ich, dass ich in einem Geisteslabyrinth gelandet war. Merkwürdigerweise hatte es so gut wie nichts mit der biblischen Überlieferung zu tun, sondern erweckte den Eindruck eines von aller Welt entkoppelten Wahnsytems, bei dem hinter jeder Biegung, jeder Weggabelung ein Monster zu lauern schien. Und indem ich durch die einzelnen Gänge irrte, wurde mir bewusst, dass all die Fragen, die hier verhandelt wurden, nichts Besinnliches an sich hatten, sondern im Gegenteil: von einer geradezu irrsinnigen Radikalität waren. Nein, der Begriff ist grundfalsch, denn radix meint die Wurzel, wohingegen das Begehren, das sich hier artikulierte, das genaue Gegenteil davon war: Weltflucht, Ekstase, ein geistiges Himmelfahrtskommando, dessen Ziel darin bestand, den Leib der Jungfrau ins All hinaus zu katapultieren (als Frau ohne Unterleib, wenn man so will). Wenn im Hamlet das Gebaren des Dänenprinzen als Mischung aus Wahn und Berechnung charakterisiert wird (»Ist dies schon Wahnsinn, so hat es doch Methode«), so galt dies auch für die verschiedenen Winkelzüge, mit denen die Theologen die Widersprüche und Widersinnigkeiten ihres dogmatischen Bauwerks einzuhegen vermochten. All ihre abenteuerlichen Erfindungen erwiesen sich, von Nahem betrachtet, als nachgerade unerlässliche Schachzüge, ohne die sich ein historischer Fortschritt nicht eingestellt hatte.2 Als ich las, dass der Mystiker Origenes – darüber sinnierend, dass die Maria doch das Wort Gottes, den Logos, empfangen habe – die Idee einer Ohrenempfängnis propagiert hatte, und dem wie selbstverständlich das Konzept einer Ohrengeburt nachfolgen ließ, versetzte mich dies in eine nachgerade umfassende Heiterkeit – begriff ich doch, dass damit, strukturell betrachtet, das Modell eines Seminars gegeben war. So wie’s in das eine Ohr hineingeht, so kommt’s aus dem anderen wieder heraus. War damit eine wahrhaft göttliche Komödie eingeläutet, löste sich mit diesem aberwitzigen Gedanken eine Problematik, die mir, in der Gestalt des gotischen Europas, ein historisches Rätsel geblieben war. Denn nur dort, wo das Dogma der unbefleckten Empfängnis heimisch geworden war, war man zu Universitätsgründungen geschritten – während demgegenüber die byzantinische Ostkirche, in der doch das hellenische Erbe weit stärker ausgeprägt war, keine einzige alma mater in die Welt gesetzt hatte.3 Die schlichte, zugleich bestürzende Einsicht war, dass Kathedralenbau, Universität, Buchdruck und Renaissancemalerei nicht denkbar waren ohne diese Gedankenfigur, ja, dass Europa eines mariologischen Himmelfahrtskommandos bedurft hatte, um sich aus der Welt in den Orbit zu schießen. Und mit dieser Einsicht fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Wenn die Gestalt der Maria etwas vorführte, so war es die Apotheose der mechane. In der Muttergottes löste sich etwas ein, wovon die Antike nur hatte träumen können: der Betrug an der Natur, endlich in Szene gesetzt. Nur auf dieser Basis hatte man die Welt auf den Kopf stellen können, war ein Satz wie der des Gregor von Nazianz überhaupt erst verständlich:
Jungfräulichkeit ist, was die Ehe bloß bedeutet.
Weil das Göttliche primordial war, während das Weltliche nur einen schwachen Abglanz vorstellte, hatte Bernhard von Clairvaux predigen können, der Baum sei eine gefallene Säule – ja, hatten die Theologen die Himmelsleiter auf den Kopf stellten können: Wie im Himmel, so auf Erden. Das war die Batterie, aus der sich das Denken meines Vaters gespeist hatte – und weil es die gesamte Kultur erfasst hatte, gab es keine Institution, die nicht im Himmel ihren Ausgang genommen hätte.
Löste sich mit diesem Gedanken das Gewicht, ja, die Rätselhaftigkeit der Geschichte in eine heitere Schwerelosigkeit auf, war ich zugleich mit der Problematik konfrontiert, wie man in einer postmodernen Welt, in der die Kritik des Christentums gleichsam zum guten Ton gehörte, ausgerechnet dem Dogma der unbefleckten Empfängnis die Ehre würde erweisen können. Ärger noch. All das, was mit diesem Dogma verknüpft war, fühlte sich an wie eine Obszönität – und so war es fast eine Zwangsläufigkeit, dass ich meinen Essay, der in der Zeitschrift »Lettre« erschien, mit einer durchaus fragwürdigen Filmszene anheben ließ:
In einem amerikanischen Film – der von Robert Altman gewesen sein könnte, ich erinnere mich nicht mehr, sowenig übrigens wie an die Handlung –, in dem Film also gab es eine Szene, an die ich mich erinnere. Eine blonde Karrierefrau, die aussah, wie man sich eine blonde Karrierefrau vorstellen muss, auf sehr hohen Absätzen und im kurzen Nadelstreif, erfährt beiläufig, während eines Gesprächs, bei dem irgendein Deal ausgehandelt wird, dass in ihrem Privatleben eine Rivalin aufgetaucht ist. Daraufhin, so erbost wie triumphierend (man befindet sich in einem Großraumbüro und sie ihrerseits unten ohne) schwingt sie sich auf den Fotokopierer, betätigt die PRINT-Taste und fotokopiert ihr Geschlecht, dann nimmt sie die Kopie, tütet sie ein und sendet sie an ihre Rivalin. Ich erinnere mich, dass ich gelacht habe – und doch, ich weiß nicht, warum. Was ist das für eine sonderbare Botschaft? Was ist es, das hier übermittelt wird?
In der Folge dieses Aufsatzes flatterten allerlei Einladungen ins Haus – als hätte ich einer staunenden Zuschauerschar das Rätsel der Frau ohne Unterleib dekonstruiert.4 Gleichwohl haftete diesem Gedanken, wenn man seine Konsequenzen durchbuchstabierte, jene Anstößigkeit an, wie sie Freud verspürt hatte, als er eingestand, seine Vorträge hätten ein solch inständiges Schweigen bewirkt, als habe er an den Schlaf der Welt gerührt. So fand ich mich eines Tages in einem Salon einem Professor gegenüber, dem ich den Zusammengang von Maschine, Unbefleckter Empfängnis und Universitätsseminar dazulegen versuchte – und sah der vollendeten Fassungslosigkeit ins Gesicht, so als hätte ich gerade eine Begegnung der dritten Art oder die Landung eines extraterrestrischen Raumschiffs geschildert.
Nein, ich weiß nicht, was meinem Vater durch den Kopf gegangen wäre, wenn er meinen Gedankengängen gefolgt wäre. Ich weiß nur, dass ich mir in Hinsicht auf theologische Spekulationen ein freundliches, man könnte sagen: entomologisches Interesse antrainiert habe, eine zugeneigte Anteilnahme. Wie anders lässt sich eine solche göttliche Komödie auch lesen? Und so würde ich, ohne mit der Wimper zu zucken, behaupten, dass das Himmelfahrtskommando der Unbefleckten Empfängnis eine der größten und folgenreichsten Kulturleistungen ist – die Apotheose einer durch und durch Künstlichen Intelligenz. In diesem Sinne ist es kein Zufall, dass Philosophen wie Künstler der conceptio bedürfen, ja, dass man in jedem großen Werk die Evokation eines höheren Wesens finden wird. Aus diesem Grund muss selbst ein so unerschütterlicher Logiker wie Gottfried Frege darauf beharren, dass ein Gedanke etwas anderes ist als ein Hammer – nämlich eine Form der zeitlosen, höheren Eingebung. Oder wie der Maler Sigmar Polke diese Form der Ohrenbefruchtung in ein Bild übersetzt hat:
Trotzdem: Es wäre schöner, wenn man sich darüber im Klaren sein könnte, Teil einer großen göttlichen Komödie zu sein – wäre dies doch der Augenblick, da man der Enge entkommt und ins Weite hinaustreten kann, dorthin, wo man es nicht mehr mit Gottheiten und metaphysischen Gespenstern zu tun bekommt, sondern – mit Menschen.
Zum Nachlesen
Walter Delius: Die Geschichte der Marienverehrung, München / Basel 1963.
Ein schönes Beispiel ist die Art und Weise, wie man die Problematik der Erbsünde aus der Welt geschafft hatte. Denn der Augustinischen Lehre gemäß, war kein Mensch von der Erbsünde frei – also wären all die Bemühungen der Theologen, Maria ein reinen, sündloses Leben anzudichten, umsonst gewesen. Die Lösung bestand daran, dass man, abermals der Lehre des Augustin folgend, die fleischliche Vereinigung ihrer Eltern von der bösen Libido befreite – womit das göttliche Wunder (und der Kern des Dogmas) darin bestand, dass ihre Eltern Joachim und Anna in vollendeter Lustlosigkeit die Zeugung der Maria begehen konnten.
Das Athenäum in Konstantinopel, 425 gegründet, steht noch in der antiken Tradition der platonischen Akademie. Die Akademie von Mangana, die im Jahre 1045 als Hochschule für Philosophie und Rechtswissenschaften im Kloster des Heiligen Georg von Mangana neben dem Kaiserpalast gegründet wurde, lässt sich ihrerseits als Institution auffassen, mit der sich die byzantinische Elite zu reproduzieren vermochte – was ja auch für die erste Universitätsgründung auf europäischem Boden gilt: die Universität von Bologna.
Der Kampf gegen die Diskriminierung kennt keine Gnade: Nachdem die Schaubude seit den fünfziger Jahren die Wies’n des Oktoberfestes mit einer Frau ohne Unterleib beglückt, wurde dem Veranstalter im Jahr 2022 ein Aufritt auf dem Historischen Volksfest in Stuttgart mit der Begründung untersagt, man dulde keine Freakshow in der Stadt.