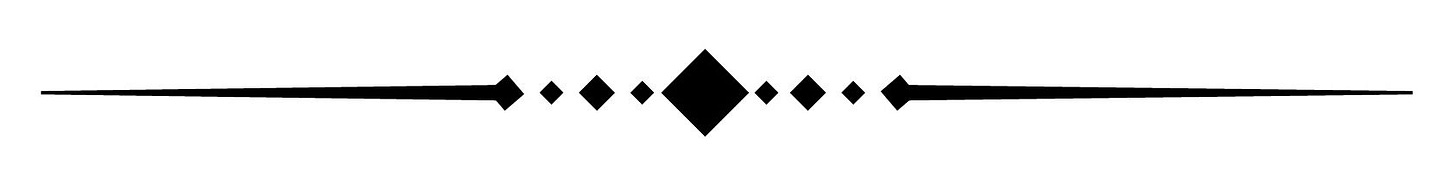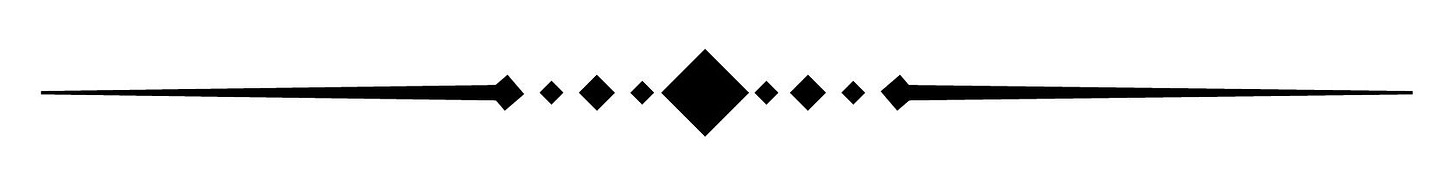Éducation sentimentale II
Vielleicht nimmt ein historisches Ereignis nur in der Ferne eine metaphorische Größe an. Von nahem betrachtet war Francis Fukuyamas Ende der Geschichte nicht viel mehr als ein flimmerndes Fernsehbild, das sich im Rauschen der Bildschirmpixel verlor. In jedem Fall fühlte sich der Fall der Mauer, die dort wenige Kilometer entfernt abgebaut wurde, weniger als finaler Triumph der westlichen Demokratien an denn als Erschütterung. Und so mischte sich in die Freude über das Ende der DDR, diesen letzten deutschen Obrigkeitsstaat, eine nicht enden wollende Serie von Haarrissen hinein, Einzelheiten, die so bizarr anmuteten wie die Szenerie beim türkischen Gemüsehändler, bei der dieser und ein sächsischer Neubürger in einen gegenseitigen Ausbürgerungswettstreit eintraten. Der Gedanke, all dies auf eine schlichte, noch dazu triumphalistische Formel zu bringen, lag so fern wie der Mond. Überhaupt war das Kind, das kurz nach dem Mauerfalls in mein Leben getreten war, sehr viel prägender als der Atem des Weltgeists. Und irgendwann bei einer dieser Nachtwachen, bei denen es nurmehr darum ging, ob man den Säugling zu beruhigen vermochte oder nicht, stand die Entscheidung fest, dass ich der Frage der Maschine ein Buch widmen würde. Und als ich, im Wartezimmer des Kinderarztes, Kants Kritik der reinen Vernunft noch im Kopf, über die Unmöglichkeit eines Vernunftgebäudes nachdachte, stand der Titel dieses Buchs vor meinem inneren Auge: Metamorphosen von Raum und Zeit. Was es erzählen würde, war die Geschichte einer kulturellen Verwandlung: nämlich wie das Mittelalter, das den lieben Gott zum Uhrmacher umgeschult hatte, in die Neuzeit, schließlich in die sich digitalisierende Gegenwart einmünden konnte. Das war die Frage, die mich schon lange vor dem Mauerfall beschäftigt und dazu gebracht hatte, mich in die Werke mittelalterlicher Denker zu vertiefen. Dass ich dabei auf Nicole Oresme verfallen war, war wenig verwunderlich: Denn er war derjenige, der als erster jenen Gottesbeweis formuliert hatte, der den Allerhöchsten als kosmologischen Uhrmacher porträtierte. Die Lektüre seiner Bücher jedoch, die (wie der Stempel der Staatsbibliothek verriet) einen langen Unberührbarkeitsschlaf hinter sich hatten, war noch verwirrender als das, was ringsum in der Stadt vor sich ging. Es war, als ob man in ein Paralleluniversum entführt worden wäre, das vordergründig vertraut wirkte, aber in dem ein anderes Gravitationsgesetz herrschte. So hatte ich lange über den Sinn der Zeichnungen in seinem De Proportionibus Proportionum gebrütet, welche lauter Dreiecke zeigten, in verschiedenen Größen. Schließlich begriff ich, dass dieser mittelalterliche Denker in einer Welt vor der Null gelebt hatte – und dass all diese Zeichnungen seine Suchbewegung nach dieser Zahl dokumentierten, die er, höchst passend, den Repräsentanten genannt hatte.
In jedem Fall wollte die Lektüre der Zeitung nicht zu dem passen, was die aus dem Tiefschlaf jäh in die Gegenwart katapultierte Stadt erlebte – und was sich in Baulücken und den pulsierenden Beats des Techno artikulierte. Manchmal, wenn ich die Stufen zu Johannes Schmöllings neuem Tonstudio hinaufstieg, begegnete ich einem Trupp von Underground-Ravern, die irgendwo in diesem Kreuzberger Gebäudekomplex (hinter dem die S-Bahn-Züge zum Gleisdreieck fuhren) ihre Parties feierten. Kurz vor der Wende, als Johannes das Studio eingeweiht hatte, war dieser Ort noch der Inbegriff der Weltabgeschiedenheit gewesen, eine Enklave, in der wir konzentriert an neuen akustischen Räumen gearbeitet hatten. Dort, wo die Natur sich der verlassenen Eisenbahngleise bemächtigt hatte, stießen nun die erste S-Bahn-Züge in die terra incognita der östlichen Stadthälfte vor. Zwar redete jeder über die Wende, aber merkwürdigerweise blieb die konkrete Lebenswirklichkeit, mehr noch, blieb die geistige Fremdheit unerwähnt, die sich binnen einer Generation zwischen den beiden Landesteilen aufgetan hatte. Wenn ich die Zeitung aufschlug, war allüberall vom DM-Nationalismus die Rede – womit Jürgen Habermas, aus der Abgeschiedenheit seines Starnberger Domizils, eine diskursive Bombe gezündet hatte. War seine Neue Unübersichtlichkeit immerhin das Eingeständnis einer gedanklichen Ortlosigkeit gewesen, erschien mir dieses Begriffsungetüm nicht bloß wie ein Widerspruch in sich selbst, sondern wie eine lustvolle Mischung aus Selbstgeißelung und Größenwahn. Dass all dies nichts mit der Wirklichkeit zu tun hatte, ja, dass zur gleichen Zeit DDR-Demonstranten aufmarschierten und zum Anschluss an diese Republik aufriefen (»Kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, geh'n wir zu ihr«), tat diesem begrifflichen Irrwisch keinen Abbruch. Plötzlich war die Nation in eine Art Dauer-Talkshow eingebunden, bei der man sich über das Vierte Reich, die böse DM und den triumphierenden Kapitalismus ausließ, während der entschiedene Wille der ostdeutschen Bevölkerung gar nicht erst auftauchte.
Während ich als Fernsehzuschauer zunehmend entgeistert verfolgte, dass die Intellektuellen der praktisch betriebenen Währungsunion nichts Besseres als ihren DM-Nationalismus entgegenzusetzen hatten, vertiefte ich mich mehr und mehr in das Werk dieses Denkers aus dem 14. Jahrhundert. Wie ich verblüfft registrierte, nahm er nicht nur in der Geschichte der Mathematik einen besonderen Platz ein, sondern hatte zudem auch ein Traktat über Geldabwertungen verfasst. Schon der Titel erschien mir wie ein Mysterium. Wie war es möglich, dass eine Gesellschaft, die doch gerade erst in protokapitalistischen Wirtschaftsweisen eingetreten war, sich mit Fragen der Inflation herumschlagen musste? Die Problematik, die in Oresmes Text aufschien, war von einer denkwürdigen, fast atavistischen Schlichtheit – und sie lautete, als Frage formuliert: Wem gehört das Geld? Der Hintergrund, auf den Oresme reagierte, konfrontierte mich wiederum mit zwei befremdlichen Wahrheiten. So verstand ich, dass das 14. Jahrhundert Geld noch nicht als Eigenwert, sondern als eine Art Thermometer begriffen hatte – welches den Wert des betreffenden Objektes abliest, wie eine Waage das Gewicht des betreffenden Objektes ermittelt. Und weil der Münze das Porträt des Königs aufgedruckt war, fiel diesem die Aufgabe zu, sich um die Prägung der Münzen zu kümmern. Genau aus dieser Monopolistenstellung jedoch rührten die Entwertungsprobleme. Denn weil die Fürsten und Könige die alleinigen Emittenten des Geldes waren, nahmen sie, von ständiger Geldnot geplagt, zu Falschmünzertechniken Zuflucht. Und das war vergleichsweise einfach. Man musste lediglich das höherwertige Geld der Nachbarn aufkaufen, es einschmelzen und es mit minderwertigen Metallen versetzt wieder auf den Markt bringen - ein Teufelskreis, der Unruhen und Währungskriege zur Folge hatte (und an dem sich die Bevölkerung, sprichwörtlich, die Zähne ausbiss). Vor diesem Prospekt gelesen war Oresmes Frage danach, wem das Geld gehört, so präzise wie seine Antwort darauf. Wenn das Geld eine Sache der Gemeinschaft ist, ein Omnibus mithin (= für alle), ist die Monopolistenstellung des Fürsten ein Widersinn. Wollte man ihm gleichwohl die Aufgabe der Münzprägung überlassen, so dürfe er nicht als Souverän, sondern nur als Abgeordneter, ja als der höchste Angestellte des Gemeinwesens wirken. Der Repräsentant, den Nicole Oresme im Falle der Null noch nicht hatte finden können, war im Falle des Geldes ganz eindeutig markiert – und so konnte Oresme die Logik eines funktionierenden Geldsystems (und damit die Logik einer Zentralbank avant la lettre) aufzeichnen. Gewissermaßen war dies der lebenspraktische Konterpart zur fehlenden Null – nur dass es weiterer zweihundertfünfzig Jahre, endloser Bürgerkriege und Opfer bedurfte, um dies mit der Bank of England in eine Gesellschaftsarchitektur überführen. Sonderbarer noch als die Verspätung war, dass der Gedankenfaden zu Oresme – und mit ihm: zur Problematik der Repräsentation, abgerissen war. Was eine hochpolitische Frage war, wurde naturalisiert – ging man einfach dazu über, in der Zentralbank eine ins Kollektive überführte Entsprechung des menschlichen Blutkreislaufs zu sehen. Mit der bevorstehenden Währungsunion jedoch stiegen die in der Tiefe der Zeit begrabenen Gespenster aus ihren Gräbern hervor. Und während die Leitartikel das Habermas’sche Begriffsungetüm hochleben ließen, wurde mir bewusst, dass die Initiale des neuzeitlichen Staates nicht im überbordenden Nationalgefühl liegt, sondern im Bedürfnis nach einer gemeinsamen, überdauernden Nullpunkt.
Sonderbar war, dass nicht einmal die ökonomischen Standardwerke diesen Bezug erwähnten. Das einzige Werk, das ich neben dem schmalen Traktat in der Staatsbibliothek hatte ausfindig machen können, war der 800-Seiten-Wälzer eines französischen Historikers, der sich im Jahr 1906 an die Aufgabe gemacht hatte, einen Überblick über die Geldtheorien des 14. Jahrhunderts Aufklärung zu erstellen.1 Was mich daran frappierte, war, dass die Problematik, die Oresme mit größter Klarheit beschrieben hatte, in den Köpfen seiner Zeitgenossen nicht bloß abwesend war, sondern sich als Gegenreaktion, als heftiger intellektueller Phantomschmerz, artikulierte. Folglich blieb die systemische Frage unberührt, während sich jeder auf die moralische Problematik stürzte. Ein ums andere Traktat erging sich darin, mit größtem Abscheu den Wucher zu geißeln und das Phantom eines gerechten Preis heraufzubeschwören – als ob allein die Bosheit der Händler dafür verantwortlich sei. Der Gedanke, dass in einer Zeit der Falschmünzerkönige und ihrer Geldentwertungsmaßnahmen es ein Ding der Unmöglichkeit war, sich mit christlichen Preise (prezzi cristiani) zu bescheiden, blieb eine Leerstelle. Und so lösten sich all die Predigten in einem Wortgeklingel auf, dessen einziger Sinn in der akustischen Überblendung jenes Zeitrisses bestand, der eine ganze Gesellschaft heimgesucht hatte. Und langsam dämmerte es mir, dass ein Großteil dessen, was über den Fernsehschirm flimmerte, nichts anderes war als – Phantomschmerz. Eine Rede, deren einziger Sinn in der Überblendung eines Verlustes bestand – genauer: dem Umstand, dass man (so wie das Mittelalter) sich mit einem fremdartigen Betriebssystem konfrontiert sah. Nun war der Begriff des Phantomschmerzes nicht leer, sondern hatte meine ganze Kindheit begleitet. Denn mein Vater hatte, als Folge einer Kriegsverletzung, nur ein Bein – und wenn ich manchmal des morgens zu ihm ins Bett kroch, konnte es passieren, dass er, von einem plötzlichen Schmerz heimgesucht, aufstöhnte. Dass auch ein abwesender Körperteil Schmerzen hervorruft – und in diesem Schmerz eine Form der Überpräsenz annimmt –, war insofern keine Metapher, sondern etwas durchaus Sinnfälliges. Beim Abendessen einer politikwissenschaftliche Zeitschrift, für die ich zu schreiben begonnen hatte, hörte ich zwei Professoren zu, die in der Akademie der Wissenschaften (Ost) eine prominente Rolle innegehabt hatten und sich nun, mit einem Statusverlust konfrontiert, in einer uferlosen Klage ergingen. Und ich begriff, dass der Verlust eines geistigen Ordnungssystems schwerer wiegt als der Verlust eines Körperteils, umsomehr, da es ja möglich ist, diesen Tatbestand nach Kräften zu verleugnen. Lag dies im Falle der ehemaligen Honoratioren und Akademiemitglieder auf der Hand, erschienen mir die Diskurse der vermeintlichen Sieger nicht minder fragwürdig. Was zuvor eine Ahnung war, wurde nun zur Gewissheit: nämlich dass auch eine postmoderne, vermeintlich vollständig aufgeklärte Gesellschaft sich über ihren Nullpunkt, ihren Gründungsmythos im Unklaren sein kann. Ein paar Jahre zuvor war mir beim Erhalt meiner Magisterarbeit als erstes eine Korrektur ins Auge gestochen, die mein Professor (der Conrady) daran vorgenommen hatte. Höchst unwirsch, wie sein schwungvoller Federstrich verriet, hatte er meine Formulierung das herrschende Irrealitätspinzip angestrichen und dekretiert, so etwas gäbe es nicht. Jetzt musste ich nur den Fernseher einschalten, und es war klar, dass all die Debatten über Werte nichts weiter waren als heiße Luft, ein Begriffsgewitter, in dem, wie in einem kollektiven Nervenschmerz, sich vor allem die Phantasmen längst vergangener Geisteswelten entluden. Die Frage hingegen, die unbeantwortet blieb, war, worin der Klebstoff einer Gesellschaft besteht. Anders als Habermas gemutmaßt hatte, war das Geld keineswegs das willfährige Instrument des deutschen Nationalismus, sondern: Es war gerade andersherum. Die Geldwirtschaft hatte die Nation auf den Plan gerufen – und es war dies die Geschichte, die Oresme erzählte.
In diesem Sinn erschien mir die Null, genauer: der Repräsentant, den dieser mittelalterliche Denker gleichsam herbeigesehnt hatte, wie eine Sehnsuchtsfigur. Dass sie im Denken seiner Zeitgenossen nicht einmal als Denkmöglichkeit sichtbar wurde, hatte damit zu tun, dass sich ihre Diskurse zu einem großen gesellschaftlichen Klagelied gesteigert hatten, einer Empörungssuada, bei der man jedwede Neuerung als Sünde und moralische Verirrung geißelte. Und während ich darüber nachdachte, geisterte mir eine Passage durch den Kopf, die ich in Rainer Maria Rilkes Malte Laurids Brigge gelesen hatte:
Ist es möglich, denkt es, dass man noch nichts Wirkliches und Wichtiges gesehen, erkannt und gesagt hat? Ist es möglich, dass man Jahrtausende Zeit gehabt hat, zu schauen, nachzudenken und aufzuzeichnen, und dass man die Jahrtausende hat vergehen lassen wie eine Schulpause, in der man sein Butterbrot isst und einen Apfel?
Ja, es ist möglich.
Ist es möglich, dass man trotz Erfindungen und Fortschritten, trotz Kultur, Religion und Weltweisheit an der Oberfläche des Lebens geblieben ist? Ist es möglich, dass man sogar diese Oberfläche, die doch immerhin etwas gewesen wäre, mit einem unglaublich langweiligen Stoff überzogen hat, so dass sie aussieht, wie die Salonmöbel in den Sommerferien?
Ja, es ist möglich.
Ist es möglich, dass die ganze Weltgeschichte missverstanden worden ist?
Was also passiert (so lautete die Frage, die mir beim Betrachten der Deutschen Dauer-Talkshow durch den Kopf schoss), wenn eine Epoche in eine Phase des Phantomschmerzes eintritt? Was also, wenn man das Missverständnis weiter noch kultiviert, einfach deswegen, weil es so überaus schmerzhaft ist, sich von einem Weltbild zu verabschieden? Anders als die Bewohner der DDR, die durch den Fall der Mauer genötigt waren, sich von ihren Gewissheiten und Lebensgewohnheiten zu verabschieden, waren die Sieger ja keineswegs genötigt, ihr Wertesystem einer Inventur zu unterziehen. Ganz im Gegenteil. Sie konnten, à la Habermas, einfach weitermachen wie zuvor – und in Ermangelung einer strengen Realitätsprüfung, war ein Einfaches, sich in den Wonnen der Phantomlust zu ergehen. In diesem Sinn wäre die Einsicht Victors Hugos (»Nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist!«) zu modifizieren:
Nichts ist stärker, als eine Idee, deren Zeit vorüber ist.
Warum? Weil man von nun an einen Gedanken unter Einkaufspreis für sich reklamieren kann.2 Oder anders gesagt: Man druckt Geld – ohne zu bedenken, dass dieses nur als ein von Staats wegen knappgehaltenes Nichts Gültigkeit und Glaubwürdigkeit besitzt.
Von diesem Augenblick an war ich überzeugt, dass auf die gleiche Weise, wie der Räderwerkautomat des Mittelalters das Gesellschaftsgefüge verändert hatte, sich das kapitalistische Betriebssystem mit der Digitalisierung verändern würde, ja, dass die Maschine soetwas wie einen Nullpunkt darstellte. Nur dass sich an die Stelle der Repräsentation die Simulation gesetzt hatte. Und als der Redakteur der Zeitschrift Leviathan nachfragte, ob ich mir vorstellen könne, eine Text über die Rationalisierung geistiger Arbeit zu schreiben (und dabei hinzufügte, dass alle bislang angefragten Professoren dieser Bitte ausgewichen seien), war mir klar, dass dies ein Text über die Abgründigkeit sein würde:
... und so taumelt, was sich eine vernunftgläubigere Zeit als ein Vernünftigwerden der Vernunft erhofft hätte, längst im Bodenlosen, ein wenig wie jene Comic-Figuren, die eine Weile noch in der Luft sich voranbewegen, ehe sie dieses Umstandes gewahr werden (was dann, der Logik des Zeichentrickfilms gemäß, zusammenfällt mit ihrem augenblicklichen Absturz).3
Irgendwann, als ich mit einem Freund (und dem Kinderwagen) um den Wandlitzer See herumspazierte, erzählte ich ihm davon, dass sich die DDR-Granden in einer Kulissenlandschaft eingerichtet hatten. Und so waren die Straßenzüge, auf denen sie tagtäglich Ostberliner Palast der Republik oder zum Staatsratsgebäude fuhren, totalmodernisiert worden – im Gegensatz zur restlichen Stadt, die vor sich hin rottete und verfiel. Und dann bemerkte ich leichthin, dass mir diese Potemkinschen Dörfer wie eine Metapher unserer eigenen Diskurse erschienen. Auf seine entgeisterte Frage, wie man auf einen solchen Gedanken verfallen könne, versuchte ich ihn in die Gedankenwelt des 14. Jahrhunderts zu entführen – aber tatsächlicher runzelte er nur die Stirn, als hätte ihm von einer extraterrestrischen Spezies erzählt. Aber je tiefer ich schreibenderweise in diese Welt eintauchte, desto mehr erschien mir diese Übergangszeit wie ein ferner Spiegel, in dem vor allem die unmittelbare Gegenwart sichtbar wurde, eine Art Gespensterhaus, das sich zum reinen Wortgeklingel aufgelöst hatte, einem Gebilde aus Wörtern, Selbstbehauptungsformeln und Wunschfiguren. Nein, ich habe das Jahr 1989 nicht als Ende der Geschichte erlebt – eher als ob man in das Innere einer neuen Geschichte eintritt. Anders als in den Schauergeschichten der Literatur hat man es nicht mit einem verwunschenen Haus, sondern mit einer neu, transparenten und überschaubaren Architektur zu tun. Nein, es sind die Bewohner selbst, die sich zunehmend in Gespenster verwandeln.
Zum Nachlesen
Émile Bridrey: La théorie de la monnaie au XIVe siècle. Paris 1906.
Tatsächlich verriet der Wahlkampf, den der Sozialdemokrat Oskar Lafontaine gegen den »Kanzler der Wiedervereinigung« Helmut Kohl führte – und in dem er sich vor allem über die vadderländischen Gefühle der Altvorderen lustig machte, eine ganz andere Lesart. Denn Lafontaine rechnete kurzerhand vor, dass die Wiedervereinigung ein höchst kostspieliges Projekt darstelle – was ihn letztlich den Sieg über einen zunehmend unbeliebten Kanzler Kohl kostete.
Martin Burckhardt: Im Arbeitsspeicher. Zur Rationalisierung geistiger Arbeit. In: Leviathan Sonderheft: Zur Sozialphilosophie der industriellen Arbeit. Wiesbaden, 11/1990.