Eigentlich war die Frage meines Gegenübers überaus einfach. Wie kommt man darauf, solche Gedanken, wie in der Philosophie der Maschine dargelegt, zu entwickeln? Und meine Reaktion darauf: »Weil ich irgendwann, Ende der Achtziger Jahre, anders abgebogen bin.« Ich kann nicht behaupten, dass dieser eingeschlagene Weg eine Entscheidung war. Eher war es wohl eine Form des allmählichen Fremdwerdens, eine wachsende Distanz meiner Umgebung gegenüber. Was immer an Ideen in der Öffentlichkeit herumschwirrte, wollte sich nicht in die in meinem Kopf heraufdämmernde Gedankenlandschaft einfügen. Zeitriss – das war der Titel des Stücks, der mich, wie auf einer Pilgerfahrt, ins Frankreich der gotischen Kathedralen, ins ›finstere Mittelalter‹ zurückgeführt hatte.1 Es war Ende Oktober 1989, und ich war bereits auf dem Rückweg zum Straßburger Flughafen. Das Autoradio des Mietwagens vermeldete Unruhen in der DDR – Nachrichten, die mich schon während meiner ganzen Reise begleitet hatten.
Und natürlich war da die Ahnung, dass sich in meiner Heimatstadt, gerade drei Kilometer von unserer Kreuzberger Wohnung entfernt, etwas Gravierendes anbahnte. Bei einem meiner ersten Besuche in Ostberlin war mir bei der Benutzung der öffentliche Verkehrsmittel aufgefallen, dass Westberlin auf der Karte der Reichsbahn nicht existierte. Da war nichts, nur eine weiße Fläche. Diese terra incognita erschien mir wie eine Metapher für diese Stadt, bei der jede Hälfte Welten von der anderen entfernt lag. War dies auf der östlichen Seite dem Verbot geschuldet, war es im Westen eher eine Form der Ermüdung. Es schien, als hätte die Gated Community in ihrer Selbstbezogenheit aufgehört, sich um die Außenwelt zu bekümmern. Mit dem Blick auf die Karte war mir die terra incognita ins Bewusstsein getreten. Auf eine schwer zu beschreibende Weise schien sie mir wie eine Erklärung, warum sich die Fernsehnachrichten wie Berichte über eine Potemkinschen Kulissenlandschaft anfühlten, darüberhinaus wurde mir klar, dass das Schisma auch in mir existierte. Sonderbarerweise hatte diese Spaltung nicht das Geringste mit politischen oder ideologischen Fragen zu tun. Sie war allein den Erfahrungen geschuldet, die ich in den Jahren zuvor mit dem Computer und den Geräten im Tonstudio gemacht hatte. Hatte mich die Frage der Künstlichen Intelligenz zunächst in die USA geführt und mit verschiedenen Forschern und Philosophen zusammengebracht2, war die Reise ins Frankreich der gotischen Kathedralen der Versuch, die sonderbare Abwesenheit der Geschichtlichkeit zu verstehen, welche die Gespräche charakterisiert hatte. Da war der Professor, der mir in der Cafeteria in der Tufts University, beim Verzehr seines Beagles, auseinanderlegte, dass die Frage Gottes doch höchst simpel zu beantworten sei: Indem man Gott denke, verwandele man ihn zu neuronalen Impulsen und speichere ihn im Hirn. Gott sei Information, so real wie der Wetterbericht oder der Gedanke an eine Zahl. Dieser Gottesbeweis erschien mir so sonderbar wie die Vorstellung, dass mein Gehirn eine informationsverarbeitende Maschine sei. Von daher war, wie ich schlussfolgerte, die terra incognita nicht der deutschen Frage geschuldet, sondern hatte sich sozusagen globalisiert. Das war es, was ich aus dem Gespräch mit dem Drogenpapst Timothy Leary mitgenommen hatte: dass der Weltgeist sich im Silicon Valley eingehaust hat und der Computer eine bewusstseinserweiternde Droge darstellt, besser noch als LSD. Die große unerledigte Frage, die sich nach all diesen Gesprächen aufgedrängt hatte, war einfach: Hat es in der Geschichte einen solch technologischen Epochenriss schon einmal gegeben? Die Antwort lautete: Ja, selbstverständlich. Auch das Räderwerk des Mittelalters lässt sich als universale Maschine begreifen. Und weil ich wissen wollte, wie diese Maschine in die Welt des Mittelalters eingeschlagen war, hatte ich Aaron Gurjewitschs Weltbild des mittelalterlichen Menschen gelesen, Arno Borst, Georges Duby und Hans Sedmlayer. Im Verlaufe der Lektüre hatte sich die Erkenntnis herausgeschält, dass der Ausgangspunkt dieser neuer Rationalität im Kathedralenbau lag. Und deswegen die Entscheidung, aus dieser Zeitreise eine Radiosendung über die Entstehung einer neuen Zeit zu machen. Dem Straßburger Münster, der letzten Station der Reise, waren die Kathedralen der Île-de-France, der Albigenser, Burgunds, aber vor allem die Zisterzienserbauten in Noirlac und Fontenay vorausgegangen. In diesem Kloster, das fernab von der Stadt, mitten im Wald gelegen war, begriff ich, was Bernhard von Clairvaux gemeint hatte, als er geschrieben hatte,
Der Baum ist eine gefallene Säule. (Bernhard von Clairvaux)
War Natur damit als Sündenfall deklariert, war andererseits postuliert, dass die Kathedrale (also das menschengeschaffene Ideal) Urbild und Ausgangspunkt aller Naturbetrachtung sein muss. Im Spätherbst war ich der einzige Besucher, der durch diese Räume wanderte – darüber sinnend, wie dieser gebaute Minimalismus sich zu einem solch gigantischen Bau wie dem Straßburger Münster auswachsen konnte.
Das war die letzte Station dieser Reise gewesen: dieser mittelalterliche Skyscraper, der von einer astronomischen Uhr und einem Puppenspiel geschmückt war (das mich, ein Kind der Popkultur, an die Animatronics in Disneyland erinnert hatte). Jetzt, auf dem Weg kurzen Weg zum Flughafen, verschwanden all diese Bilder, wurden übertönt von der Stimme des Nachrichtensprechers, der die Breaking News der Gegenwart verkündete: eine zweite Flüchtlingswelle, die in der Prager Botschafter hineinströmte, Schließung der Grenze nach Ungarn, in die Tschechoslowakei.
Es war nicht so, dass mir die andere Seite des eisernen Vorhangs unbekannt war. In den Jahren zuvor war ich immer wieder in Ostberlin gewesen, zunächst als Tourist, dann auf eigene Rechnung, zuguterletzt als Kurier, der für einen befreundeten Lektor den Kontakt zu Ostberliner Autoren unterhielt. Schlussendlich gab es eine Verabredung mit einem Redakteur des DDR-Staatsfunks, der mich um eine Kassette meiner Geräuschoper gebeten hatte – und weil er sicher war, dass die Reichspost sie einsacken würde, hatte er um eine persönliche Übergabe gebeten.
Natürlich verspätete ich mich, denn die Volkspolizisten an der Friedrichstraße hatten mich zielsicher aus dem Besucherstrom herausgefischt und die Kassette entdeckt. In der Hoffnung, staatsfeindliches, subversives Material beschlagnahmen zu können, hatte sie sich in ihre Kommandozentrale zurückgezogen und das Band durchgehört – nur um es mir eine Stunde später, kopfschüttelnd, wieder auszuhändigen. Weit mehr als das Establishment, das sich in der Akademie der Künste traf, interessierten mich die Autoren meiner Generation, die im Prenzlauer Berg eine Art Gegen- oder Untergrundkultur aufgebaut hatten. Der erste Kontakt zu dieser Szene lief über einen amerikanischen Lyriker, der einen Freund hatte, der seinerseits Kontakte zu Untergrund-Autoren unterhielt. Dieser junge Mann, Sohn eines New Yorker Invesmentbankers, den er (wie den Kapitalismus) inständig hasste, hatte Frau und Kind und war der Verfasser denkbar lieblos produzierter Reisebücher. Als wir uns in einem Kreuzberger Café trafen, ging seine erste Frage dahin, wie er finanziell von seiner Unterstützung profitieren könne – ein Ansinnen, das sein Lyrikerfreund, peinlich berührt, abwehren konnte. Und weil ich gewillt war, den Bankierssohn zum Kaffee einzuladen, ließ er sich breitschlagen – und schleppte mich auf seiner nächsten Ostberliner Tour mit. Was mich frappierte, war die Verwandlung, die mein Reiseführer binnen weniger Minuten an den Tag legte. Aus dem missgelaunten Kreuzberger Szentypen war eine Art weltläufiger Bonvivant geworden. Bevor wir eine kleine Notiz an der Tür eines abwesenden Schriftstellers hinterließen, klapperten wir eine Reihe von hübschen Krankenschwestern ab – und ich begriff, dass dieser Mann den eisernen Vorhang als eine Art Boudoir nutze, als eine Hinterwelt der Begierden, die durch kleine Mitbringsel oder ›blaue Tapeten‹ bei Laune gehalten wurden. War die Welt des Prenzlauer Bergs, aus dem westlicher Zeitungsredaktionen betrachtet, ein Hort der Avantgarde-Literatur, löste sie sich, von nahem betrachtet, in Grautöne auf. Die Lesungen, denen manchmal Hunderte von Eingeweihten beiwohnten, waren in der Regel von einer denkwürdigen Schlichtheit, ging es doch stets darum, dem Unsäglichen eine Stimme zu geben – weswegen die Regierung stets als übelwollender König porträtiert wurde und das Publikum, in der Sklavensprache trainiert, sich in der Dechiffrierung der Allegorie übte. Erwiesen sich meine Gegenüber als intellektuell beweglicher, kam häufig eine sonderbar schillernde Chamäleonsnatur hinzu. Da war der junge Dichter-Star, der einen Gedichtband mit dem Titel Jeder Satellit hat einen Killersatelliten veröffentlicht hatte – und mich, als wir durch die Straßen spazierten, darüber aufklärte, welches Lokal, da Stasi-Treffpunkt, keineswegs aufgesucht werden dürfte (was ihm wohl deshalb so klar, weil er selbst auf der Gehaltsliste der Staatssicherheit stand). Und je vertrauter mir die Welt meiner Generationsgenossen wurde, desto fremder erschien sie mir. Die Fremdheit war nichts, was sich im Gespräche thematisieren ließ, sondern bezog sich auf etwas, was sich als untergründige, viszeräre Gewalt, dem Sinnesapparat und dem Geschmack innerviert hatte. Irgendwann ging ich mit einer Malerin an einem Internet-Shop vorbei, als sie innehielt und sagte: »Sag mal, Martin, riechst du das?« Ich schaute sie verständnislos an – und versuchte, in den Gerüchen der Umgebung auszumachen, was sie wohl meinen könnte, aber da war nichts, nur der Geruch nach einem Desinfektionsmittel. Genau das aber war es. Und ihr schwärmerischer, fast enthusiasmierter Gesichtsausdruck: »Das riecht nach Westen«. Es war nicht schwer, im Ostberlin der 80er Jahre eine Gesellschaft im Niedergang zu sehen: eine Notgemeinschaft, die sich in einem Absurdistan eingerichtet hatte. So legte mir der Redakteur des DDR-Rundfunks seine Arbeitswelt auseinander und sagte, dass seine Hörspiel-Abteilung beim Staatsfunk in der Nalepastraße etwa zweihundert Angestellte unterhielt. Und als ich einwandte, dass das bundesrepublikanische Pendant bestenfalls auf dreißig Festangestellte käme, sagte er, von seinen zweihundert würden ja ohnehin nur zwanzig regelmäßig arbeiten. Und auf die Frage, womit der Rest seine Zeit so verbringe, sagte er, ohne irgendein Sensorium für die Absurdität zu verraten: Alkohol, Frauen, was immer.
Als mein Flugzeug in Straßburg abhob und ich auf das Wolkenmeer hinabschaute, das sich in der Dämmerung rot einfärbte, war mir bewusst, dass die Welt, die hinter der Mauer begann, in das letzte Stadium der Selbstauflösung hineingeschlittert hat. Und auch wenn keineswegs absehbar war, wohin diese Reise führen sollte, waren doch die Ursache klar – und sie hatten allesamt mit der enormen technischen und wirtschaftlichen Rückständigkeit des Ostens zu tun. Dieser Zusammenhang freilich, der sich in Ostberlin bei jedem Schritt geradezu aufdrängte, ja, der eine olfaktorische Qualität besaß (der Kohlegestank, der einen empfing, wenn man aus dem Ubahn-Schacht in der Friedrichstraße ins Freie hinaus trat) war auf der anderen Seite eine gedankliche Leerstelle. Just in dem Maße, in dem diese Welt unbekannt war, gaben sich die Westler einer Verehrung hin, die gelegentlich in eine Form der Idolatrie umschlagen konnte. Als seien hier, im besseren Deutschland, die Dinge auf ideale Weise geordnet: die Autoren heroisch, mutig und klar, die Literatur noch – Literatur. Psychologisch betrachtet (das war nicht schwer zu begreifen) war diese Heroisierung nichts weiter als eine Flucht aus dem schlechten Gewissen. Ganz offenbar hatte der in seinem Konsumwahn schwelgende Westler sich so tief in kognitive Dissonanzen verstrickt, dass er geneigt war, sich im Jenseits hinter der Mauer eine fremde, bessere Welt zu imaginieren. Auf eine kuriose Weise kam mir das Verhältnis der beiden Gesellschaften wie ein Spiegelkabinett vor, bei der das Gegenüber die Aufgabe hatte, die eigene Leerstelle zu verkörpern. Bei einem meiner letzten Besuch in Ostberlin hatte mich die Freundin eines Lyrikers gefragt, warum die Westberliner Autoren, wenn sie denn einen Zugriff auf Fotokopierer besäßen, nicht selbst Untergrund-Verlage initiierten – und ich hatte so ernsthaft wie vergeblich versucht, ihr die Welt des übersättigten Konsumenten auseinanderzulegen, den Umstand beispielsweise, dass mein Redakteur mir kürzlich dargelegt hatte, dass sich der Sender bei der Programmgestaltung künftig einer Quote bedienen, also auf die Masse setze werde. Meine Arbeiten hingegen, so sehr er sie schätze, lägen definitiv unterhalb der Messbarkeitsschwelle. Und natürlich kam mir Sascha Anderson in den Sinn, der mir, en passant, dargelegt, mit welchen westlichen Massenmedien er gerade ein Interview ausgehandelt hatte. Stellte die DDR-Literatur eine Form des dernier cri dar, fanden die Dinge, die mich beschäftigten, in einem Vakuum statt, das bestenfalls als ästhetische Marginalie zur Kenntnis genommen wurde, im politischen Raum jedoch keinerlei Bedeutung besaß. Und dennoch – in einem symbolischen Sinn jedenfalls – erschien mir die Arbeit im Tonstudio, auf gleich mehreren Ebenen, wie eine Offenbarung, so als ob man einen Blick in die Zukunft werfen könnte. Oder genauer: als sei dies der Weg, um zu einer Form der Geistesgegenwart zu gelangen.
Tatsächlich kann ich nicht sagen, dass ich, was Herkunft und geistige Attitüde anbelangte, besonders für die Computerwelt disponiert war. Ganz im Gegenteil. Die einzige Berührung, die ich bis zum Ende meines Literaturstudiums mit ihr hatte, war ein Steckfeld gewesen, das mir mein amerikanischer Patenonkel zu meinem zehnten Geburtstag geschenkt hatte: Im wesentlichen bestand es aus farbigen Drähten, die man nach einem Bauplan zu einem kleinen Rechenprogramm zusammenstecken konnte, welches am Ende einfache Additionen und Subtraktionen zu lösen vermochte. Ich hatte die Übung brav absolviert, aber es hatte mich nicht sonderlich beeindruckt, im Gegenteil. Und wann immer ich einen Programmierer traf oder die Frage des Computers aufkam, ließ ich mit aufreizender Arroganz die Bemerkung fallen, dass die binäre Logik keinen Schritt über die Einsicht des Evangelisten hinausgekommen sei: »Eure Rede aber sei: Ja! Ja! Nein! Nein! Was darüber ist, das ist vom Übel.« Dass die Welt zu Nullen und Einsen zerlegt wird, erschien mir wie eine Form des Neoprimitivismus – so anmaßend wie die Behauptung, dass jede menschliche Empfindung (Glück, Ehrfurcht oder Schönheitsempfinden) nichts weiter sei als ein neurochemischer Vorgang. Tatsächlich löste sich meine hochmütige Verachtung erst, als mir ein Bekannter, um 1983 herum, das Textverarbeitungsprogramm seines Joyce Amstrad Computers vorführte. Aber mehr noch als dieses praktische Werkzeug, das mir die mühseligen Tippex-Prozeduren meiner elektrischen Schreibmaschine ersparte, war es das Tonstudio, das meinen Blick veränderte, und dies gleich auf mehreren Ebenen. Als junger Mann, der über Jahre hinweg Klavier gespielt und mit dem Gedanken der Komposition geliebäugelt hatte, entdeckte ich zweierlei: Zum einen, dass sich jedes Geräusch als Instrument nutzen lässt (die Schönheit einer Toilettenspülung, die im langsamen Verrauschen die wunderbarsten Obertöne produziert), zum zweiten, dass das Persönlichkeitsideal des Hochgeschwindigkeitsvirtuosen auf eine vergebliche Liebesmüh hinausläuft – bedarf es nur einer einzige Reglerdrehung, um den Sequencer auf Touren zu bringen (und den Virtuosen vor Neid erblassen zu lassen).
Diese beiden Entdeckungen waren eine geistige Erschütterung, die über alles hinausging, was mir bei der Lektüre eines Philosophen widerfahren war – denn sie wirbelten meine Vorstellung davon, was Schrift und was Persönlichkeit sind, durcheinander. Denn wenn jedes beliebige Geräusch, in einen Sampler eingespeist, zum Instrument wird, wird die Welt selbst zum Instrument. Und damit öffnet sich ein Pluriversum denkbarer, noch unerschlossener Welten. Nicht bloß, dass dieser Möglichkeitsraum über alles hinausgeht, was die tradierte Notationsweise an Möglichkeiten vorgesehen hat, darüberhinaus verändert er die Rolle, die dem Autor dabei zukommt (und damit jener Rolle, die ich mir für mein Leben auserwählt hatte). Markiert die auktoriale Erzählhaltung eine Gottesposition, bei der der Autor über den Zeichen schwebt wie der Geist Gottes über den Wassern, ist das Weltverhältnis, das sich in der terra incognita der Klänge ergibt, eines der Immersion – die Erschließung eines Unerhörten, das man nicht selber geschaffen, sondern empfangen hat. Bedeutete der Sequencer bereits eine Depotenzierung des Virtuosen, war unübersehbar, dass das heroische Schöpferbewusstsein der Erfahrung dieser neuen Weg im Wege stand, ja, dass man im Wortsinne aufhören musste – war es kein Zufall, dass die Geräuschoper (die ich mit einem Sounddesigner gemeinsam realisierte) mit den Worten begann: Hör auf!3 In die Welt eines Klangs einzusteigen, ihn zu transponieren, zu dehnen oder in seine Wellen und Frequenzen zu spalten, war, als ob man in eigene Unbewusste der Wahrnehmung hinabstieg. So betrachtet ging die Digitalisierung der Welt mit einem Verlangsamungsmodus einher, der wiederum zu einer Schärfung der Sinne beitrug. Was mich gleichwohl irritierte – und die Begeisterung für den hinzugewonnen Sinnesapparat trübte –, war die befremdliche Einsicht, dass die Art und Weise, wie man die Klänge manipuliert, letztlich auf eine Form der Genetik hinausläuft. Wie der Genetiker eine Naturwüchsigkeit in die Welt der Clons und Mutanten überführt, war auch ich damit beschäftigt, lauter merkwürdige Zeichengebilde in die Welt zu entlassen. Obschon dies auf ein wenig schmeichelhaftes Selbstporträt hinauslief, war die ästhetische Verführungskraft doch größer als der moralische Skrupel. Ja, ich begriff, dass das Sounddesign schon immer auf eine ästhetische Intensivierung hinausgelaufen war, ein Bigger than Life, das sich herzlich wenig um Realitätstreue scherte. So besehen war die manchen Büchern oder Filmen voranstellte Warnung (Die Ähnlichkeit mit lebenden Personen ist rein zufällig) geradezu als Beweis einer gegenteiligen Logik zu fassen, einer Logik, der es nicht darum zu tun war, die Realität abzubilden, sondern die umgekehrt darauf abzielte, die Kunst zum Leben zu machen. Der Logik des mittelalterlichen Mystikers gemäß (der Baum ist eine gefallene Säule) hielten sich auch die Sounddesigner der Hollywood-Blockbuster nicht an die naturalistischen Klänge, sondern gingen von einer idealen Klangarchitektur aus, welche das Sensorium des Kinobesuchers maximal reizte.
War ich damit beschäftigt, den Genetiker mit dem verschwindenden Autor, die Welt mit der Hyperrealität zu versöhnen, war unübersehbar, dass all diese Fragen, so existenziell sie schienen, vielleicht in der schallgedämpften Atmosphäre des Tonstudios oder im Kopf des Autors Sinn machten, in der Außenwelt jedoch nichts auf das geringste Verständnis hoffen konnten. In diesem Sinn erschien mir mein Tun zunehmend wie eine Expedition in ein unwegsames, unerschlossenes Gelände. Und während der politische Raum mit anderen Fragen beschäftigt war (es war die Zeit des Nato-Doppelbeschlusses und der Strategic Defense Initiative), vertiefte ich mich in die Geschichte der Arktis-Expeditionen. Sonderbar jedoch war, dass auch die Tonmeister in den Sendern, in die es mich damals noch regelmäßig verschlug, nicht das geringste Sensorium für diese Fragen aufbrachten – oder wenn, dass sie die nahende Digitaltechnik nur als Anschlag auf ihren Arbeitsplatz auffassten. In diesem Sinn war digital das Synonym für eine computergenerierte, unwirtliche Welt – als stünde hier nicht der eigene Kopf und sein ästhetischer Sinn auf dem Spiel, sondern als wäre diese Welt (wie über einen Nürnberger Trichter) dem Kopf eingeflößt worden. Und so nahm in dem Maße, in dem ich in die Welt der Klänge vordrang, die Distanz zur Außenwelt zu – als ob man ins Innern der Stille vordringen könnte. Aber wenn eines klar war, so dass der Computer bei dieser Wandlung des ästhetischen Vokabulars und des Autorenbildes eine entscheidende Rolle spielte – und dass dies die Art und Weise verändert, wie eine Gesellschaft sich künftig ihre Geschichten erzählt. Von daher erschien mir das Tonstudio wie ein Experimentierfeld, ein Labor, in dem die postmoderne Gesellschaft neue Produktionstechniken einübte (Produktionstechniken, die über kurz oder lang in jeden Industriezweig, in jeden Arbeitsbereich einwandern würden). Bei der Vertiefung in die Literatur freilich war unübersehbar, dass dieser Standpunkt weitgehend ausgespart blieb. Wenn man sich mit dieser esoterischen Materie beschäftigte, kreiste die Debatte vor allem um die Frage der künstlichen Intelligenz (also der Ersetzung des menschlichen Geistes durch einen Computer), wohingegen der mentalen Veränderung, der Verschiebung des geschichtlichen Raumes, keinerlei Beachtung geschenkt wurde. Während ein Jürgen Habermas die Neue Unübersichtlichkeit und die Erschöpfung utopischer Energien predigte4, breitete sich im Zeichen der Digitalisierung eine neue Utopie aus. Und es war dieser neuartige, fremder Geisteskontinent, der mich (als geistige terra incognita) zu meinem ersten selbständigen Denkversuch veranlasste, einem Essay, der den Titel ›Digitale Metaphysik‹ trug. Was sich ästhetisch als Aufhorchen, als ein Hör auf! artikuliert hatte, läutete hier den Abschied von der Frankfurter Schule, ja vom altväterlichen Denken der Philosophen überhaupt ein: »Wenn es ein Bild gibt für das, was der Philosoph Neue Unübersichtlichkeit nennt, für diesen Zustand der Verflüssigung und Aufweichung des Verfestigten, so ist es das elektronische Wabern des Videoclips, jene Farbengrelle, wo, im Rhythmus des Herzens, die Dinge den Aufstand proben, wo Äpfel sich zu Birnen und schließlich zur Physiognomie irgendeines herausragenden Zeitgenossen mutieren, wo die Objekte zusammengeschrumpelt, zerdrückt und zerknautscht ihre Form verlieren und sich in etwas anderes verwandeln – nämlich in frei flottierende Zeichen, die einer anderen Gesetzmäßigkeit folgen als in der Realität.« Liest man die Zeitenwende des Jahres 1989 vor diesem Hintergrund, lässt sich sagen, dass das, was Fukuyama das Ende der Geschichte genannt hat, der Eintritt in eine andere Geschichte war – und dass diese sich, klandestin und unbemerkt, über Jahre hinweg angebahnt hatte. Und letztlich war es dies, was mich in das Frankreich der gotischen Kathedralen, oder geistesgeschichtlich gedacht, ins finstere Mittelalter zurückkatapultiert hatte – die Einsicht, dass die Geschichte vielleicht menschengemacht ist, aber dass dies keineswegs bedeutet, dass man sich über die eigenen Beweggründe im Klaren sein muss.
1 Es wurde, um der Masse zu entsprechen, zu Die Zeit läuft umbenannt und wurde im Jahr 1990 vom SFB ausgestrahlt
2 Aus dieser Reise wurde die Sendung Change Program Please, die im SFB gesendet wurde, viele Jahre später aber, im Jahr 2008, bei parlando/Random House als Audiobook herauskam.
3 Rush Hour. Ein Hörstück (zus. mit Hans-Peter Kuhn).
4 In: Merkur, Nr. 431, Januar 1985.











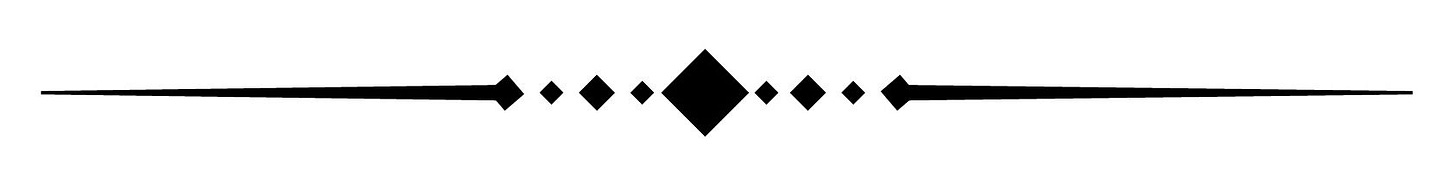

Originelle Gedankengänge, frei von (ideologischen) Vorurteilen und dennoch durchaus provokant