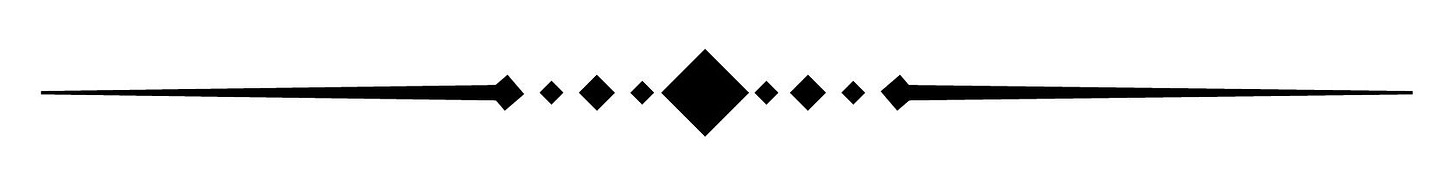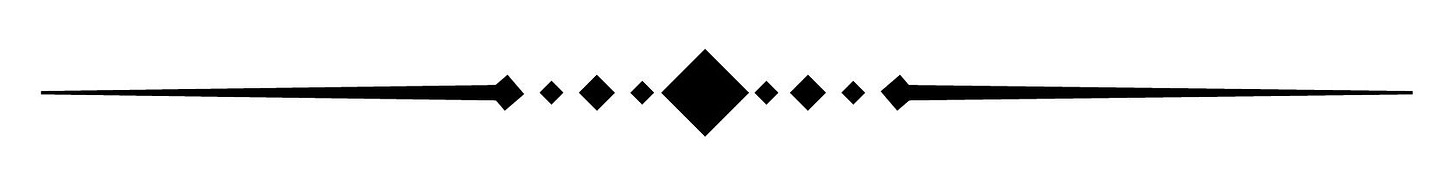English Version
Wer kennt das nicht? Diesen Augenblick, da der RECORD-Schalter zu blinken beginnt und signalisiert, dass die Aufnahme läuft. Und nicht selten, in einer professionellen Umgebung zumal, geht dies mit einem Moment der Panik einher: Zu wissen, dass von nun an jeder Lapsus, jeder Versprecher festgehalten wird. Folglich beginnt die Stimme zu zittern, kann man hören, wie der Sprecher von einer Nervosität durchpulst wird, ja, passiert es nicht selten, dass der Kloß im Hals groß und größer wird und sich zu einem globus hystericus auswächst.
Wenn mein Chirurgenfreund, als ich ihn kennenlernte, bemerkte, er säße auf der richtigen Seite des Messers, könnte man meinen, dass der Regisseur, der dort, erhöht noch dazu, auf der anderen Seite der Glasscheibe sitzt, in einer privilegierten Position sich befindet. In Wahrheit war es alles andere als angenehm. Vielmehr kam es mir so vor, als ob all die jungen Schauspielstudenten, die dort einer nach dem anderen sich ans Mikrofon setzten, über die Gegensprechanlage mit der „Regie“ kommunizierten und darauf warteten, dass das Rotlicht aufflammen würde, eine Art symbolischer Exekution durchlitten. Ich hatte es Dutzende Male zuvor schon erlebt: ein junger Mensch, der den Aufnahmeraum betritt – und sich bei mir, dem Regisseur, danach erkundigte, wie ich denn Text denn haben möchte, ob er den Cowboy oder das Sensibelchen geben solle. Aber dann dauert es keine Minute. Denn flammt das Rotlicht auf, bricht das aufgesetzte Selbstbewutssein zusammen, sitzt da nur noch das Nervenbündel, das mit sich, der Welt, vor allem dem Regisseur dort oben hadert. Und weil ich das in diesem Seminar Dutzende Male zuvor erlebt hatte, hatte ich mir dieses Mal vorgenommen, jedes Moment der Einschüchterung aus dem Spiel zu nehmen. Jeder würde den Text lesen können, den er sich aus einer Textsammlung herausgesucht hatte, es würde keine Intervention und keine Unterbrechung geben – und auf die unweigerliche Frage »Wie war ich?« würde die Aufforderung folgen, doch hinauf in die Regie zu kommen und sich das Resultat selbst anzuhören. Was folgte, war eine erstaunlich gleichförmige Parade, bei der man den Schauspielstudenten, die unter dem Kopfhörer ihrer Darbringung lauschen, ihre Verzweiflung ansehen konnte – wenn sie sich nicht überhaupt in wortreichen Selbstgeißelungen ergingen. Und natürlich bat jeder darum, die Aufnahme noch einmal machen zu dürfen, wobei diese Bitte, sonderbarerweise, von dem Argument gestützt wurde: »Das bin nicht ich!«
Und weil auch das nicht neu war, war mir die Frage durch den Kopf gegangen, was passieren würde, wenn jeder der eigenen Stimme im „Naturzustand“ lauschen würde. Um dem Sprecher jede Form der Verantwortung abzunehmen, hatte ich mir einen vollkommen idiotischen Text zurechtgelegt: eine Art Gebrauchsanweisung, welche die Studenten erst zu Gesicht bekamen, wenn sie sich vor dem Mikrofon aufgebaut hatten. Auf dem Tisch lagen Papier und Bleistift – und die Aufgabe bestand darin, diesen Text abzuschreiben und das Geschriebene, wie bei einem Grundschul-Diktat mitzulesen (mit samt Punkt und Komma): Das ist ein Tex-t. Punkt. Und wieder das Prozedere: Komm hinauf in die Regie, hör es dir an! Was mich und meinen Kollegen überraschte, mit dem ich gemeinsam dieses Intensivseminar ausrichtete (das sich über drei Wochen und acht Stunden täglich erstreckte), war die Reaktion der Studenten: Denn jeder, der unter dem Kopfhörer seiner Buchstabierübungs-Performance lauschte, war zutiefst angetan von der eigenen Stimme – sah man (wo zuvor eine Form des physiognomischen Abscheus geherrscht hatte) eine Form des Beseligt-Seins, ja, der Beglückung, »auch wenn, zugegebenermaßen, der Text vollständig idiotisch ist«.
Auf eine kuriose Weise markierte dieses unverhoffte Resultat das Ziel des Seminars: dass die Studenten mit ihren wiedererlangten Stimme die Künstlichkeit der Aufnahmesituation würden abschütteln und frei für die eigentliche Aufgabe sein können. Was mich gleichwohl beschäftigte, war das Moment der Spaltung, ja, die Schizophrenie, die die Studenten an den Tag gelegt hatten. Denn dort, wo man ihnen alle Freiheiten der Welt eingeräumt hatte (die Auswahl des Textes, die Art der Interpretation) stand am Ende eine trotzige Selbstverneinung, wohingegen das Diktat, das sie in eine Form der kindlichen Verantwortungslosigkeit zurückversetzt hatte, wie eine Befreiung, ja, ein beglückendes Zu-sich-selbst-Findens erlebt worden war. Und während das Wochenendes dachte ich darüber nach, woher dieser Widerspruch rührte. Ganz offenkundig stellte die Künstlichkeit der Situation einen massiven Stress-Faktor dar – und das galt auch für diejenigen, die diesen Job schon über Jahre hinweg gemacht hatten. So war der Schauspieler, der im schallisolierten Hörspielstudio des Senders einen langen Text für mich gesprochen hatte, verschwitzt und körperlich erschöpft hervorgekommen. In der Tat riefen all die technischen Gerätschaften den Eindruck hervor, als ob man sich in einem Raumschiff befände, das jeden Augenblick abheben würde. Folglich dachte ich darüber nach, was es bedeuten würde, wenn man das ganze Setting, so weit es ginge, ausblendete, wenn also der Betreffende, in jedem Augenblick, der Meister der Situation bleiben würde. Mit diesem Desiderat ergab sich das Setting des folgenden Experiment wie von selbst, ging es nurmehr darum, meinen Kompagnon Wolfgang Bauernfeind von der Sinnhaftigkeit dieses Versuchs zu überzeugen. Als langjähriger Hörfunkredakteur, der zudem unzählige Male selbst Regie geführt hatte, war ihm die Problematik zutiefst vertraut – trotzdem stutzte er doch, als ich ihm meinen Plan auseinanderlegte. »Lass mich rekapitulieren«, sagte er schließlich. »Du willst einen Raum, in dem nichts anderes steht als ein Aufnahmegerät. Und dann, was dann?« Die Aufgabe der Studenten, so legte ich ihm dar, bestünde darin, sich in diesen Raum zu begeben, die RECORD-PLAY-Taste zu drücken und dann zehn Minuten etwas aufs Band zu sprechen – egal was. Es könnte ein vorbereiteter Text, eine Improvisation oder ein Stream of Consciousness sein – aber ebenso sollten sie auch die Option haben, diese Zeitdauer schweigend vor dem Mikrofon auszuharren. Die einzige Bedingung sei, dass mein Kollege und ich das Resultate anhören und den einen oder anderen Take auch der Gruppe vorstellen würden – weswegen man sich das Ganze auch als eine Form der zeitversetzten Ansprache denken könnte.
Es dauerte nicht lange und es war ein geeigneter Raum gefunden: ein kleines, karges Übungszimmer, das üblicherweise von den Musikern genutzt wurde. Neben dem Klavier fanden sich ein Sessel und ein Tischchen, auf dem man Bandgerät und Mikrofon platzieren konnte. Tatsächlich bekam ich, da ich im Studio damit beschäftigt war, weiter Texte aufzunehmen, nichts von dem Aufnahmeprozess mit. Die Assistentin geleitete den jeweiligen Kandidaten in den Raum – und irgendwann am Abend wurden mir drei, vier Kassetten ausgehändigt. Als mein Kollege und ich am Tag darauf die Bänder anhörten, hatten wir nicht die geringste Vorstellung von dem, was uns erwarten würde. Tatsächlich war jeder Auftritt unverwechselbar. Da war jemand, der einen Text vorbereitet hatte, aber schon nach ein, zwei Minuten, offenbar im Gefühl vollendeter Absurdität, abbrach und sich danach wortreich entschuldigte. Da war eine junge Frau, die darüber sprach, worüber sie hätte sprechen wollen, aber dann sagte sie, sie hätte gerade fürchterliche Regelschmerzen und es ginge ihr heute einfach nicht gut. Und da war schließlich der angry young man, der, nachdem er die Record-Taste gedrückt hatte, eine Bemerkung fallen ließ, wie schwachsinnig er diesen Versuch fände, aber wenn wir’s denn hören wollen, sei’s drum. Womit er das Klavier aufklappte und dann mit der Faust auf den Tasten herumhämmerte, ganze zwanzig Minuten lang. Auf kuriose Weise erlaubte jede dieser Performances einen Blick in die Tiefe der Seele, ja, war von einer hypnotischen Intimität, bei der selbst das vermeintliche Versagen von einer geradezu entwaffnenden Aufrichtigkeit war – etwas, was an den Versuch mit den Kindheitsgeräuschen erinnerte, den wir in einem der vorangegangenen Seminare durchgeführt hatten.1 Und obwohl wir die Möglichkeit des Schweigens eingeräumt hatten, machte niemand davon Gebrauch. Ganz im Gegenteil: gerade die Einladung zur Verweigerung hatte bewirkt, dass die Sprecher ihren Auftritt genau bedacht und damit Verantwortung übernommen hatten. Was mich jedoch am allermeisten überraschte, war, dass das Versprechen, dass all diese Aufnahmen von uns abgehört würden, eine Form des gedanklichen Dialogs in Gang gesetzt hatte. Was man in der Psychoanalyse Übertragung nennt, entfaltete sich fast in Reinform vor unseren, nein, nicht Augen, sondern Ohren.
Und weil ich nach ein paar dieser Takes sonderbar hypnotisiert war, setzte der folgende Auftritt eine gedanklichen Kataklysmus in mir frei, einen Gedankenstrom, in den gleich eine Reihe von Fragen einflossen. Am Anfang war nicht viel zu hören, nur ein Räuspern, dann einige schwere Atemzüge. Ganz offenkundig war der Betreffende hypernervös – was er nach einer Weile tatsächlich auch artikulierte: »Ich weiß nicht, warum ich nervös bin, ich bin doch ganz allein hier im Raum«. Und dann, nach einer langen Pause: »Komisch, ich hab das Gefühl, die Wände kommen auf mich zu.« Um sich die Situation vor Augen zu führen, begann er nun, den gesamten Prozess in seine Einzelheiten zu zerlegen: wie jedes seiner Worte sich, einmal artikuliert, in eine Schallwelle auflöste, wie diese auf die Membran des Mikrophons traf, in elektromagnetische Informationen übersetzt wurde und von einem Schreibkopf auf das Magnetband geschrieben wurde. Und der Abhörprozess würde ebenso verlaufen: Irgendwann würde jemand die Kassette einschieben, die elektromagnetischen Spannungen würden vom Lesekopf eingelesen und zu Schall zurückverwandelt werden, und nun würde ein anderer Mensch dem Klang seiner Stimme lauschen. Die Art und Weise, wie er diesen Prozess analysierte, war gleichermaßen bedächtig – oder so, als ob sich jemand eine geistige Schutzweste zurechtspinnen würde. Nach einer langen Pause folgte ein Popgeräusch – ganz offenkundig hielt er nun das Mikrophon in der Hand, jedenfalls war seine Stimme ganz nah, als sie sagte: »Komisch, das sieht ja aus als hätte es Haare«. Mein Kollege prustete los – aber dann folgte jener Satz, der mir vorkam, als ob unversehens ein Schleier vor meinem inneren Auge hinweggezogen worden sei. »Das sieht aus wie damals, als ich durch das Gitter die Haare im Ohr des Priester entdeckt habe«. Das war es! Nicht bloß, dass dieser Prozess eine Form der Übertragung darstellte, im technischen als auch psychoanalytischen Sinne, darüber hinaus nahm der Apparat hier die Rolle eines symbolischen Vaters ein. Und mit diesem Satz hatte sich der Raum, den wir für unsere Studenten eingerichtet hatten, in einen Beichtstuhl verwandelt, so wie jede Aufnahme eine Beichte darstellte, von der sich der Akteur eine Absolution erhoffte.
Noch bevor sich diese Schlussfolgerungen meinem Hirn einbrannten, kam mir eine Geschichte in den Sinn, die mir Joseph Weizenbaum über sein Eliza-Programm erzählt hatte, das sich in den 60er den Nimbus einer Künstlichen Intelligenz verdiente hatte – und dies, obwohl dieser Chatbot von einer Künstlichen Intelligenz so weit entfernt war wie die Erde vom Mond. Wenn er in etwas brillierte, so darin, dass er das, was der Nutzer als Aussage eingetippt hatte, in Frageform zurückspiegelte. »Mir geht es nicht heute!« »Ach, Ihnen geht es nicht gut? Was bedrückt Sie denn?« Während der Arbeit an dieser Paraphrase-Maschine war Weizenbaum aufgefallen, dass seine Sekretärin, wann immer er das Vorzimmer durchschritt, tief in die Arbeit versenkt, etwas in ihr Computerterminal eintippte. Sonderbar an diesem Hyper-Engagement war, dass sich Weizenbaum nicht entsinnen konnte, ihr überhaupt soviel Arbeitsaufträge gegeben zu haben – so dass er einiges Tages an sie herantrat, um einen Blick auf den Bildschirm vor ihr zu erhaschen. Und was sah er? Dass seine Sekretärin vor seinem Eliza-Programm saß und ihm ihre Befindlichkeit übermittelte: »Ach, Ihnen geht es nicht gut? Wer weiß, vielleicht kann ich Ihnen ja helfen.« In der Tat, Eliza war da – und es störte nicht weiter, dass die Sekretärin wusste, dass Eliza nichts war als eine Maschine zur Paraphrasierung, hatte sie sie doch längst zu einem mechanischen Analytiker umfunktioniert.
All das schoss mir durch den Kopf, während der Klang dieses Satzes nachhallte – und lauter Gedanken-Puzzlestücke sich vor meinem inneren Auge zu einem Bild zusammensetzten. Und dieses Bild erklärte alles. Es erklärte nicht bloß, dass und warum die Schauspielstudenten sich vor dem Mikrofon seelisch entblößten, sondern es machte mir deutlich, dass das ganze Setting, zu dem wir uns hier zusammengefunden hatten, auf diesen Satz und diese Einsicht zugesteuert hatte. Denn es gab nichts, aber auch gar nichts an diesem Satz auszusetzen. Nichts von dem, was Goethe gemeint hatte, als er so treffend schrieb: »So fühlt man Absicht, und man ist verstimmt«. Selbst die Präsenz des Adressaten, der irgendwann dieses Band abhören würde, hatte sich in Luft aufgelöst – genauer: in diese Stimme, die sich über die Behaarung des Mikrofonschutzes verwunderte und übergangslos zu dieser Kindheitserinnerung zurückgefunden hatte: wie es war, durch die Gitter des Beichtstuhls die Haare im Ohr des Priesters sehen zu können. Ego me absolvo. Hatten die Schauspieler in der Inszenierung ihr verstimmtes Nicht-Ich entdecken müssen, so war diese Stimme im Zustand der Selbstvergessenheit etwas, was weit über diesen Augenblick hinausreichte. Noch Wochen später, als ich mir den Gedankengang eines mittelalterlichen Theologen vor Augen führte, wusste ich, dass dieser Satz ein Schlüssel war, machte er doch unmissverständlich klar, warum das Mittelalter die Maschine und den Gottesbeweis zusammengebracht hatte. Und er lag mir auf der Zunge, als ich versuchte, meinem Lektor meine Behauptung begreiflich zu machen, dass die Maschine das Unbewusste sei – während er mich, gleichermaßen skeptisch wie belustigt, anschaute, wie ein Entomologe eine seltene Spezies betrachtet. Und mag sein, dass man nur deswegen Bücher schreibt: weil man eine Begriffslosigkeit in die richtigen Worte einzukleiden versucht.
Zum Nachlesen
Das wird im dritten Teil dieser kleinen Reihe erzählt