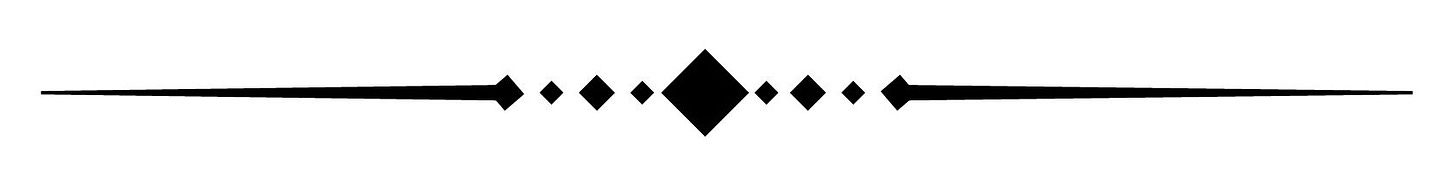Das ist ein Vortrag - noch in der alten Rechtschreibung verfasst - , den ich im Jahr 2000 in der Evangelischen Akademie in Tutzing gehalten habe. Da geht es um den Sinneswandel vom Auge zum Ohr, von der zentralperspektivischen Bildüberwachung hin zu den immersive environments unserer Computerwelt. Oder wenn man das etwas abstrakter fassen wollte: den Wandel des Weltbildes, von der Repräsentation hin zur Simulation.
Meine Damen, meine Herren,
Sie werden über meinen Vortrag sagen können, was Sie wollen – aber Sie werden mir, zumindest was den ersten Teil anbelangt, nicht nachsagen können, daß ich nicht die Wahrheit gesagt hätte. Das ist natürlich ein großer Vorzug: daß ich hier nicht über einen »eingebildeten«, sondern über einen ganz offensichtlichen Makel reden werde. Anderseits liegt hier ein gewisses Dilemma: denn man kann, wenn man denn bereit ist, in die Offensive zu gehen, sich auch auf einen Makel einiges einbilden – womit man denn eine Einbildung zweiter Instanz und das Paradox vor sich hätte, daß auch das Ohr zur »Einbildung« taugt. Und ich glaube, das war, insgeheim, die Befürchtung, die ich in Bezug auf meinen Vortragstitel hatte. Daß er der beliebt gewordenen „Politik der Sinne“ souffliert, daß man die Videoten kritisiert, um mit großem, allverstehenden Ohr dazustehen. Als ob das Hören der tiefere, edlere, der innigere Sinn wäre (und die Lösung darin bestünde, ganz Ohr zu sein). Nun ist es zweifellos so, daß es, was die Praktiken von Auge und Ohr anbelangt, tiefgreifende Differenzen gibt – und um diese Differenzen soll es im folgenden gehen -, aber diese sind nicht der Natur, sondern geschichtlichen Techniken geschuldet.
Nur in großen Umrissen: seitdem die Bildverarbeitungsmaschine der Zentralperspektive das Primat des Auges durchgesetzt hat, haben wir es mit der Sichtigkeit der Neuzeit zu tun, den Parametern des »Überblicks«, der »Durchsicht«, dem Nexus von Standpunkt und Fluchtpunkt, Horizont und Perspektive. Da denkt Leonardo da Vinci ganz ernsthaft über einen Sinnestausch nach - daß er, wenn’s denn darauf ankommen sollte, das Ohr fürs Auge hergeben würde. Die neuzeitliche Philosophie, so könnte man sagen, ist panoptisch von Grund auf. Wenn die Philosophie, aber auch das politischen Denken, zu den Metaphern des Auges gegriffen hat, war nicht eigentlich das Auge, sondern zuvorderst diese Technik gemeint: Subjekt, Objekt, die Art und Weise, wie man vor einem Rahmen Position bezieht und sich ein »Weltbild« erschafft. Nicht dem unbewaffneten Auge, dem Unschuldsblick der Natur begegnen sie hier, sondern einer hochgerüsteten, komplexen Projektionsapparatur: einer Weltbildmaschine.
Nun: ich kann mir gut vorstellen, daß irgendwann, in hundert Jahren vielleicht, die je avancierteste Weltbildmaschine nicht mehr panoptisch, sondern panakustisch funktioniert – daß Wörter wie Schwingung, Oberton, Rauschen etc. eine ganz eigentümliche Aufladung erleben werden. In gewisser Hinsicht ist das schon jetzt absehbar (eigentlich müßte ich sagen: zu erhören), denn die Navigation durch den Wissensraum läßt sich auf der Ebene der grafischen Oberflächen nicht mehr adäquat fassen. Vor dem Bildschirm sehen Sie nicht mehr, wie der darunter liegende Raum beschaffen ist – Sie sehen den abstrahlenden Schein, nicht aber die Strukturen, die diese Oberfläche erzeugen. Um verstehen zu können, wie dieser gesamte Raum funktioniert (die verborgenen Strata und das, was sie auf der Oberfläche erzeugen), gilt es, die Schichten und Layers zu durchqueren und ihre Logik zu verstehen.
Schon hier wird ein Vorteil des Hörens deutlich: denn der Prozeß der Schichtung läßt sich (anders als im Optischen, wo ein Element stets das andere, dahinterliegende verdeckt) im Akustischen sehr viel leichter und präziser nachvollziehen. Wenn eine Stimme hinzukommt, muß sie nicht notwendigerweise eine andere verdecken – wir haben diese besondere Fähigkeit zur Polyphonie. Akustisch ist möglich, was in der Physik, in Gestalt des Pauly-Problems, ein Unding ist: daß zwei Dinge zur gleichen Zeit am selben Ort sein können. Dieses Unding der physikalischen Theoriebildung ist uns längst zur Lebenswirklichkeit geworden: ragen doch entfernte Fernen in unsere unmittelbare Umgebung hinein, haben wir es – selbst dort, wo wir nicht auf unsere Computerbildschirme starren – mit der Überlagerung von Räumen zu tun. Was wir – darin hoffnungslos anachronistisch - Hier und Jetzt nennen, ist mit einem Jederzeit und Anderswo vermengt. Weil wir eine Fernbedienung und eine REPLAY-Taste in der Hand halten, kommt es zu einer Überlagerung von verschiedenen Raum- und Zeitschichten, die vor gar nicht langer Zeit vollkommen undenkbar gewesen wäre.
Wie aber erfassen wir diese Räume? Nun: Die Übereinanderschichtung verschiedener Raum- und Zeitdimensionen (der n-dimensionale Raum, wie das in der Mathematik heißt) läßt sich visuell kaum mehr vorstellen. Jedoch läßt sich dieser Raum hören. Unser Gehör ist nicht durchs Gesichtsfeld begrenzt, es umfaßt das, was hinter unserem Rücken passiert, über und unter uns. Nicht von ungefähr ist das Ohr der Sitz unseres Gleichgewichtssinns, ein Ortungsorgan. Dieser Zusammenhang ist mir wichtig: Weil die Räume komplexer werden, ist das Ohr dazu prädestiniert, zum Leitmedium der Zukunft zu werden, wird man eines Tages statt von Visualisierung von Sonifikation sprechen. Freilich (und das ist der Sinn dieser ganzen Präliminarien): wenn das Denken eines Tages zum Panakustikum werde sollte, so werden wir auch hier nicht der Natur, sondern einer hochgerüsteten Apparatur gegenüberstehen. Und auf diese Apparatur wird man sich ebensoviel einbilden, wie man sich heute auf die Optik einbildet. Wenn ich heute über das Ohr als den Ort der Scham sprechen möchte, so nicht, weil das Ohr von Natur aus ein solcher Ort ist, sondern weil dies unter den gegenwärtigen Bedingungen so ist – den Bedingungen einer durchvisualisierten, optisch hochgestylten Gesellschaft.
Was ist das für eine merkwürdige Verbindung – das Ohr und die Scham? Im Sinne einer allgemeinen Körpersymbolik, könnte man behaupten, daß wir hörenderweise durchweg effeminiert sind. Denn wir können’s nicht verhindern, daß wir allerlei penetranten Störgeräuschen ausgesetzt sind, und so eignet uns nolens volens jene Offenheit, die man den Frauen gerne zuschreibt. Allerdings ist fraglich, ob die Prognose, daß die Zukunft hörig und weiblich sein wird, uns sonderlich weiterhilft. Tatsächlich hat die Gleichsetzung von Scham und Ohr eine lange und komplizierte Tradition. Wenn Sie in die Dogmengeschichte des Christentums zurückgehen, entdecken Sie (und das ist der entscheidende für das Dogma der Unbefleckten Empfängnis), daß Maria ihr Kind nicht durch den Schoß, sondern übers Ohr in sich aufnimmt: Ohrenempfängnis. Da ist die Scham zu Kopf gestiegen (und hört auf Scham zu sein, wird vielmehr zur triumphalistischen Geste). Das scheint mir überhaupt das Charakteristikum der Scham zu sein. Denn die Schamgrenzen sind keineswegs fixiert, sondern verschieben sich, unaufhörlich. Nun, wenn Sie sich dreißig Jahre zurückversetzen – in die Zeit vor der sexuellen Revolution -, da war das Reich der Scham noch weitgehend mit der entblößten Scham, also dem Körper, assoziiert. Diese Schambezirke existieren (wenn wir unserer visuell verzeichneten Welt folgen) nicht mehr, statt dessen sind Nacktheitsrüstungen, Muskelpanzer, Siliconpolster etc. an ihre Stelle getreten. Und weil die öffentliche Schamlosigkeit unübersehbar ist, könnte man (wie das ja da und dort, in zumeist kulturkritischer Absicht geschieht) schließen, daß die Scham verschwunden ist. Skama – das ist etymologisch das, was verdeckt und verhüllt wird. Im Umkehrschluß könnte man sagen: das, was uns nur in verdeckter und verhüllter Form zugänglich ist, beschreibt den Ort der Scham. Setzt man diese Logik voraus – daß man von den Hüllen auf die Scham schließen muß - ist klar, daß der unverhüllte, exponierte Körper nicht unter dem Register der Scham zu lesen ist. Meinerseits wäre ich geneigt, hier vom Geschlecht der Geräte zu sprechen – und da geht es nicht um Scham, sondern um andere Zusammenhänge. Die Liaison von Heckflossen und weiblicher Brust, Waschbrettbauch und Lamellen...
Scham – das ist ein altes Wort, ein Wort, das die Gesetze der Moral und der Religion auf den Plan ruft. Nun bin ich – in Anbetracht all der pudenda, aber auch der großen Schuld- und Sühneproblematik, die hier ins Spiel kommt – geneigt, eine zeitgenössischere Formel zu wählen. Und da könnte man, statt von der Scham, vom Unbewußten sprechen. Damit hätte man, statt eines Freudschen Triebwerkes (das ja, wie bekannt, ödipalisiert und durchsexualisiert ist) eine dynamische, geschichtliche Größe angesetzt. Und da ist die Scham, wie gesagt, keine feststehende Größe, kein ein-für-allemal festgelegter Schambezirk mehr, sondern sie wandert und wechselt ihre Gestalt. Dort, wo Sie einem Verhüllten begegnen, begegnen Sie der Sphäre des Unbewußten. In diesem Sinne ist es fraglich, ob wir tatsächlich schamlos sind, oder ob sich die Scham nicht bloß verschoben hat. So haben wir vielleicht das Geheimnis des Sexuellen gelüftet, aber versuchen Sie einmal – unter Berufung auf die nämliche Freizügigkeit - das Steuergeheimnis Ihres Nachbarn zu lüften! Mögen die körperbedeckenden Hüllen gefallen sein – das, was die symbolischen Körper verhüllt, ist es keineswegs. Und so ist es nur logisch, von der Dunkelheit dieses Raums auf ein »Unbewußten des Geldes« zu schließen. Dies vorausgesetzt wären wir nicht wirklich schamlos, sondern unser Schambezirk hätte sich in ein anderes, symbolisches Terrain hinein verlagert. Diese Verschiebung ist der Sinn eines kleinen, hintergründigen Witzes, der über Donald Trump, den Multimillionär und Herren des Trump-Towers kursiert. Der begegnet eines Tages im Fahrstuhl seines Trump-Towers einer wunderschönen jungen Dame. Und da man ganz unter sich ist und der Fahrstuhl des Trump Towers in jene Höhen hinaufführt, die man treffenderweise die Welt der Hochfinanz nennt, bietet sie sich an, ihn zu befriedigen, und zwar mit dem Mund. Das ist nun wirklich ein sehr uneigennütziges Angebot? Und was sagt Donald Trump dazu? Und, sagt er, was springt für mich dabei raus?
Nun – kommen wir zum Hören, zu der Frage, ob und warum das Ohr der Ort der Scham sein könnte. Als ich vor gut siebzehn Jahren mit Klängen und Geräuschen zu arbeiten begann (in einem Feld, das weder dem Hörspiel angehörte noch der Musik, sondern das genau dazwischen angesiedelt war), war ich fasziniert von der Offenheit dieses Feldes. Und je länger ich mich damit beschäftigte, desto klarer wurde mir, daß das Geräusch, der amorphe Klang, soetwas ist wie eines jener »unidentifizierten Theorieobjekte«, die die Agentur Bilwet vor Jahren ins Gespräch gebacht hat, UTOs genant. Diese extraterrestrische, unerhörte Fremdheit ist um so sonderbarer, weil doch das Geräusch das alltäglichste, allerselbstverständlichste Phänomen ist – und doch hat sich niemand darangesetzt, die Sprache der Klänge zu erforschen. Gewiß: die musikalische Formsprache hat ihre eigene Wissenschaft. Aber schon um das Sprechen – das doch in der Antike eine der höchsten Kunstformen war -, wird es merkwürdig still, ganz zu schweigen von der Stimme mit all ihren Dysfunktionen. Aber gänzlich dunkel wird es, wie gesagt, wenn Sie in das Feld der Geräusche und der Geräuschwahrnehmung eintreten. Was überhaupt ist ein Geräusch? Das scheint eine blödsinnige Frage zu sein. Jedoch wird sie plausibler, wenn man sie unter der Folie untersucht: wann hören wir auf, von bloßen Geräuschen zu sprechen, wann nennen wir etwas Musik oder Sprache. Es ist diese doppelte Abgrenzung, einerseits zur Musik, andererseits zur Sprache hin, welche das Geräusch definiert – aber das ist keine positive, sondern eine negative Definition. Geräusch ist all das, was nicht Sprache und nicht Musik ist. Läßt sich die Musik, die dort im Hintergrund läuft, überhaupt als Musik auffassen, oder ist sie nicht vielmehr Hintergrundsgeräusch, Klangteppich, über den man achtlos hinweggeht? Und kann die Stimme meines Gegenüber, dem ich, endlos gelangweilt, zuhöre, etwas anderes sein als sinnentleertes Rauschen, kaum unterscheidbar von dem Nachklang der Espressomaschine? Und umgekehrt: wird mir, bin ich von der Sprecherin verzaubert, diese Stimme nicht erscheinen wie die höchste Sphärenmusik? – Setzt man die Mutabilität des akustischen Ereignisses voraus, so läßt sich nicht mehr definitorisch sagen: dies oder jenes sei Musik, dies oder jenes sei Sprache, dies oder jenes Geräusch. Das, was ich höre, wird Musik dadurch, daß ich es als Musik höre, wird Geräusch dadurch, daß ich es als Geräusch höre. Demzufolge wäre das Geräusch ein Modus des Hörens, oder genauer: des Überhörens.
Tatsächlich erweisen sich all diese Grenzziehungen als künstliche Abtrennungen, deren wesentliche Funktion darin besteht, das gesamte Feld nicht zur Kenntnis zur nehmen. Aber warum nicht? Ich erinnere mich, daß ich vor langer Zeit einmal in einem Studio saß und eine Cutterin bat, einen Schnitt zu machen. Es war die Aufnahme eines Zulu-Textes, den ich in Südafrika im Radio aufgezeichnet hatte. Was der Sprecher sagte, war mir vollkommen schleierhaft, es klang nach einer Art Boxkampf, sehr aufregend, und der Sprecher steigerte sich, in einer unendlich langsamen Glissando-Bewegung, zu dramatischen Höhen hinauf. Nur an einer Stelle, da hing dieses Glissando etwas ungenehm durch, und ich sagte: Hier, schneiden Sie das raus. Aber, sagte die Cutterin, das ist doch mitten im Wort. Das können sie doch nicht machen. Da zerstören Sie doch den ganzen Sinn!
Das ist wirklich ein merkwürdiger Einwand. Da haben wir diese Frau, die tagaus tagein mit Klangmaterial zu tun hat, mit nichts anderem als Klangmaterial – und sie interveniert. Aber in wessen Namen interveniert sie? Im Namen des Sinns einer Sprache, die sie nicht spricht – Zulu. Das ist schon ein merkwürdiger Fall, eine Wortgläubigkeit selbst dort, wo man das Wort gar nicht versteht. Da könnte man doch schon einmal die Frage stellen, ob der Sinn am Wort allein hängt, oder ob er sich nicht auch in der Bewegung der Rede, in diesem sich steigernden, allmählich sich hinaufschraubenden Glissando, artikuliert? – Was mich jedoch an der Heftigkeit ihres Einwandes interessierte, war die absolute Fraglosigkeit, die Selbstverständlichkeit dieses Satzes: Das kann man nicht tun! Und so habe ich den Einwand als eine moralische Geste aufgefaßt. Und wenn man’s so liest, könnte man das folgendermaßen übersetzen: Zerstören Sie nicht die Integrität dieser Rede! Denn das läuft (in letzter Instanz) auf die Zerstörung dieser Person hinaus. Es ist im übrigen keineswegs so, daß ich diesen moralischen Impuls kritisieren wollte. Nur hat dieser moralische Impuls wenig mit der Praxis des Rundfunkcutters zu tun. Denn diese besteht im wesentlichen darin, Interviewschnipsel aneinanderzuheften – und ansonsten jedes Äh, jedes Öh, jedes Zungenschnalzen und jedes Lippenschmatzen zu eliminieren. Das ist akustischer Schmutz, unrein, und wandert ab in den Müll. Der Schnitt in diesem Sinn ist nicht bloß Collage, sondern Klanghygiene - und wenn man den nötigen Aufwand für diese hygienischen Operationen anschaut, so ist er beträchtlich, vor allem aber führt er zu der Frage: Wozu dieser Aufwand? Ist das denn nötig, oder nicht bloß eine Art akustischer Waschzwang? Denn wir allesamt reden ja nicht wie gedruckt, sondern stockend, zögernd, mit diesen Äh-und-Öh-Interjektionen. Kurzum: Was da tagaus tagein herausgeschnitten wird, ist nichts anderes als der menschliche Faktor. Kommen wir aber auf die Geschichte mit dem Zulu-Sprecher zurück. In Anbetracht der täglichen Praxis nämlich sieht der Einwand der Cutterin noch merkwürdiger aus. Denn einerseits soll es erlaubt sein, Sprecher akustisch zu desinfizieren, anderseits wird behauptet, daß der Schnitt (der nicht hygienisch, sondern lautlich, vom Sound her begründet ist) ein unzulässiger, weil sinnzerstörender Einwand ist. Was für ein Sinn steht hier auf dem Spiel? Zweifellos ist es nicht der Sinn des Hörens, der Sinn unserer Sprach- und Klangwahrnehmung, sondern ein abstrakter, gleichsam überkörperlicher Sinn: was ich das Sprechen-wie-gedruckt, wie ein Buch nennen möchte. Die Dominanz dieses höheren Sinn (hinter dem Sie, wenn Sie in die Philosophie zurückgehen, mit Leichtigkeit den Logos, die Metaphysik der Letter, entdecken) macht taub für das konkrete Klanggeschehen. Weil diese Grenze zwischen dem sprachlichen Sinn und dem akustische Un-Sinn existiert, wird das Sprechen von seiner eigentümlichen Gestik abgetrennt. Und in diesem Sinn könnte man, in Analogie zur Legasthenie von einer Akusthenie sprechen – nur daß dieses Krankheitsbild nicht als solches gedacht wird, sondern vielmehr zum guten Ton zu gehören scheint.
Nun ist dieses Erlebnis kein Einzelfall – habe ich im Laufe meiner Arbeit sehen können, daß die in diesem Feld Tätigen einen nicht unbeträchtlichen Teil ihrer Energien darauf verwenden, das akustische Material in seiner Eigentümlichkeit nicht zur Kenntnis zu nehmen. Und da stellt sich die Frage: Was ist so Gefährliches daran, daß man die Ohren verschließt? Woher diese Wahrnehmungsblockaden? Und warum affiziert diese Blockade vor allem jenen großen akustischen Untergrund, der nicht druckreifes Sprechen ist oder im Untergrund des nicht-instrumentalen »reinen« Klangs west. Zweifellos: hier liegt eine Scheide zwischen rein und unrein, und diese wird mit dem Messer immer wieder hergestellt. Zwar ist das Schnittmuster weder rational noch reflektiert, aber es ist verläßlich (und somit von einer unbewußten, zwingenden Logik): Was dem Messer zum Opfer wird, ist das Geräusch. Und so wird dem SINN (den man in großen kapitalen Lettern denken muß) die Komplexität und Vielschichtigkeit des akustischen Sinnes geopfert.
In einem Seminar, das ich an der FU zur „Semiotik des Geräuschs“ gemacht habe, habe ich eine Sitzung darauf verwandt, die Studenten (und zwar jeden einzelnen) 2 Dinge erzählen zu lassen: erstens, ein Kindheitsgeräusch, an das sich der oder die Einzelne genau erinnern kann, zweitens ein gegenwärtiges Geräusch, das vor dem inneren Ohr lebendig ist. Das, was dabei herauskam, war sehr merkwürdig. Ein Beispiel: Da erzählt zum Beispiel eine junge Frau, wie es ist, nachts in einer Hundehütte im Wald zu liegen – und ein Geräusch wahrzunehmen, das sie nicht identifizieren kann, wie von einem anderen Wesen, und wie plötzlich alles zum Indiz einer Bedrohung wird. Und dann erzählt dieselbe Frau ihr Kindheitsgeräusch. Das ist beim Aufwachen: da hört sie so ein Schmatzen, so ein Lippengeräusch, ganz nah am Ohr. Und sie weiß: das ist jetzt die Mutter, die sie weckt, und zwar dadurch, daß sie ihr Gesicht verzieht und groteske Grimassen schneidet (daher das Geräusch der Lippen) – und wenn sie jetzt die Augen öffnet, wird sie da ein solch grimassierendes Muttergesicht vor sich haben. Und während sie das erzählt, schaue ich mich um und sehe die Gesichter der Zuhörer, die fragen: Was ist das für eine komische Mutter? Und was um Gottes willen macht die Tochter da nachts in einer Hundehütte im Wald? Aber diese Blicke sind nicht irgendwie hämisch, wie wenn man jemanden bei einem Freudschen Versprecher psychisch dingfest macht, sondern sympathetisch. Diese Differenz ist sehr merkwürdig, denn sie steht in einem scharfen Gegensatz zur Bildwahrnehmung. In äußerster Vereinfachung könnte man sagen: Wir besitzen Bilder, aber wir besitzen keine Geräusche. Es keine akustische Eigentumsordnung, da herrscht blanker, unschuldiger Kommunismus.
Oder wenn man die Differenz, was ich vorziehen würde, historisch fassen möchte: der hörende, hörige Mensch ist nicht identisch mit dem, was wir Subjekt nennen. Aber das ist ja keineswegs verwunderlich, verdankt sich die Konstitution des neuzeitlichen Subjekts einer visuellen Technik: daß man sich einen Rahmen baut, sich davon in Stellung bringt und das, was im Rahmen sichtbar wird, über die zentralperspektivische Konstruktion, fixiert, feststellt, objektiviert. Wenn ich Subjekt bin und Objekte mir gegenüberstelle, so nur, weil ich, diesem neuzeitlichen Projekt folgend, im Bilde bin. Aber versuchen Sie einmal, dieses Arrangement auf die akustische Wahrnehmung zu übertragen. Da wäre die Frage: Wie kann ich ein akustisches Objekt feststellen? Wo wäre der Rahmen? Der Witz ist natürlich, daß sich das akustische Objekt niemals als einzelnes zeigt. Selbst wenn’s nur eine einzelne Klangquelle wäre, so schwingt doch der Raum, in dem diese Klangquelle erscheint, immer mit: verändert den Klang, wirkt als Resonanzboden. Klänge sind immer schon vermischt, Klangräume - und nicht einzelne Objekte. In diesem Sinn führt uns die Rede vom reinen Klang (die die musikalische Phantasie zu ihren Vorstellungen der Sphärenmusik gebracht hat) in tiefe Widersprüche. Denn der reine (wenn Sie so wollen: mathematisch hygienische) Klang ist der Sinuston: also das, was wir als vollkommen untertäglich erleben.
Ein weiteres ist unmöglich: nämlich die visuelle Distanz. Sie können sich nicht (wie hinter einer Trennscheibe – sehend, ohne gesehen zu werden) dem Objekt gegenüber aufbauen, sondern werden, hörenderweise, immer in diesen Raum hinein genötigt. So wie das Geräusch unlösbar ist vom umgebenden Umraum, stecken Sie Ihrerseits in diesem Umraum mit drin. Dieses In-Sein ist das Fundament unserer Klangwahrnehmung. Das aber heißt: hörenderweise haben wir ein anderes Verhältnis zur Welt. Aber das, wie schon erwähnt, muß gelesen werden unter dem Blickpunkt einer Sinnestechnik.
Nehmen Sie – als ein hervorragendes Beispiel, denn es ist beschreibt die Art und Weise, wie der Klang über Jahrhunderte gedacht worden ist – die musikalische Notenschrift, die ja nicht von ungefähr mit der Zentralperspektive gemeinsam entsteht. Wenn Sie sich eine solche Seite vornehmen, sehen sie, daß sie von all dem, was die Welt des Klangs ausmacht, absieht. Während ein Händeklatschen, je nachdem, wo es passiert, in einer kleinen stickigen Kammer oder in einem Badezimmer, ganz anders klingt, steht hier nichts weiter als ein abstrakter, raumloser, klanglich unspezifizierter Impuls. In gewisser Hinsicht funktioniert die klassische Notation so, wie Galilei das als Desiderat für ein perfektes Gravitationssystem formuliert hat: »Denken Sie sich die Luft weg!« Aber tatsächlich ist die Luft, ist die Reflexion des Klangs, seine Brechung an diesem oder jenem Material das eigentliche Element. So daß man sagen muß: die Notenschrift fungiert wie der SINN in kapitalen Lettern – oder in ein Bild gefaßt: als abstraktes Programm, als Spielanleitung für Spieluhren, die in der Schwerelosigkeit, im vollendeten Schweigen, aufzuführen ist. Mag diese Vorstellung absurd anmuten, so führt sie doch das Idealbild des perfekten Subjekt vor Augen, das (ungetrübt von den Gegebenheiten des Raumes) sein Instrument beherrscht.
So besehen ist der Widerstand, der sich dem amorphen Geräusch gegenüber artikuliert (das sich, wie ein liederliches, ungewaschen und ungekämmtes Wesen unkontrolliert mit anderen Kopula vermischt und vermengt), durchaus verständlich. Denn hier kollidiert der Geist der Feststellung, das neuzeitliche Subjekt, mit einem fremdartigen, nachgerade feindlichen Prinzip. Die Sprache der Klänge (wenn diese denn nicht ihrerseits in die Abstraktion gehoben – und damit ausgelöscht worden sind) hat nichts gemein mit der Logik der Repräsentation. Wenn ich hier von der Logik der Repräsentation rede, so ist damit die zentralperspektivische Weltbildmaschine gemeint, die ja ihrerseits unsere Bildwahrnehmung, unsere Philosophie und unsere politischen Maschinen geformt hat. Das ist ein wahrhaft umfassender Komplex, und er hat sich tief in unser Verhalten eingefleischt. Was fragen Sie, wenn Sie ein Bild sehen? Was ist das, wo ist das, wer ist das? Oder – wenn nichts Figürliches darauf zu sehen ist - wie teuer war’s? Und wer hat’s gemalt? Dieser Blick, wenn ich einen Begriff aus der Linguistik zitieren darf, ist deiktisch. Er stellt Raum und Zeit fest. Er identifiziert. Klassifiziert. Und er wertet. In gewisser Hinsicht kommt uns das natürlich vor, tatsächlich jedoch begegnen wir hier einer historischen Technik. Seit dem Arnolfini-Bild, das Jan van Eyck im Jahr 1432 gemalt, kennt das Bild die Signatur des Künstlers und eine Datierung. Und seit dieser Zeit läuft der Tausch Bild gegen Zahl.
Verzeihen Sie mir die kursorischen Ausflüge in die Kulturgeschichte. Ich habe an anderer Stelle eingehend darüber geschrieben – und will, um den Faden nicht zu verlieren, nicht weiter darauf eingehen. Tatsächlich war mein Gang in die Kulturgeschichte nicht unwesentlich von der Frage bestimmt, wie sehr wir noch immer dominiert, ja geradezu besessen sind von Gedankenfiguren, die der visuellen Sphäre entstammen. Und weil ich gelernt habe, dies einzuordnen, verstehe ich die Vernachlässigung besser, die dem panakustischen Raum noch immer zuteil wird. Eine der größten Merkwürdigkeiten war für mich stets die relative Unempfindlichkeit, mit der man die Wörter behandelt – oder vielmehr: unterjocht hat. Tatsächlich gibt es keine Sphäre des menschlichen Lebens, die sich der Definitionsmacht stärker widersetzt als die Welt der Wörter. Natürlich steht es Ihnen frei, sich eine Definition anzumaßen, aber definitiv ist, wie Nietzsche treffend gesagt hat, nur der Tod. Etwas definieren zu wollen heißt: sich harthörig zu stellen für das, was die Sprache selbst mitzuteilen hat. Tatsächlich ist jedes Wort, das ich entgegennehme, mit einer semantischen Konterbande befrachtet – und ob mir das genehm ist oder nicht, in seiner Lautung trägt es einen Sinn mit sich herum, den ich nicht selber geschaffen habe.
Was ich zu Anfang meines Vortrags über die Architektur der Information gesagt habe, trifft im besonderen auf die Wörter zu. So wie der Bildschirm uns nur mit der grafischen Oberfläche konfrontiert, so sehen wir, hören wir in den Wörtern nur die jeweils letzte, zeitgenössische Bedeutungsschicht. Jener vermeintlich sichere Begriff des »Subjekts«, den wir narzißtisch hoch aufgeladen haben, ist selbst eine überaus flüssige, wandelbare Größe: im Französischen ist das „sujet“ immer noch, was bei uns das Objekt, der Gegenstand ist. Bis weit ins 18. Jahrhundert wurden Subjekt und Objekt fast homonym benutzt, war die Tücke eines Objekts stets auch die Tücke eines Subjekts. Und wann man ganz weit zurückgeht, wird man in diesem gewissen Subjekt den sub-iectus, den Unterworfenen, also den Untertanen erkennen – womit sich das autonome Subjekt in sein Gegenteil zurückverwandelt hätte. So besehen ist die Etymologie das Unbewußte der Sprache, haben sich die Traumata, die Neurosen der Zeit in die Wörter eingeschrieben. Damit ist nicht gesagt, daß die abgetriebenen Wort-Bedeutungen nun zwangsläufigerweise als semantische Untote aus den Gräbern herausgestiegen kämen und uns, zombiegleich, mit ihrer nicht-enden-wollenden-Vergangenheit heimsuchen. Manches ist tot, und das ist vielleicht gut so. Anderseits ist es durchaus hilfreich, sich daran zu erinnern, daß das, was wir »Definitionsmacht« nennen, nichts anderes als die ausdrückliche Verleugnung der Tatsache ist, daß wir die Sprache empfangen – und nicht selber gemacht haben. Und so lauert hinter der Definitionsmacht die Scham, die Muttersprache empfangen zu haben, die Scham geboren zu sein. Gesteht man sich diese konstitutionelle Beschämung ein, öffnet sich die Welt der Wörter – wird man mit Überraschung entdecken, daß der Abstieg in den semantischen Abgrund kein Einstieg in ein gähnendes Nichts ist, sondern Bedeutungsschichten zutage fördert, die einem gegenwärtigen Fragen entsprechen.
Der Psychoanalytiker Jacques Lacan hat die Regression nicht als ein Zurückschreiten, sondern als ein „Zurückkommen auf Unerledigtes“ gedeutet. Das heißt: regredierend verkindlichen wir nicht, sondern kommen auf eine Stelle zurück, die offen geblieben ist. Da klafft etwas auf – und zwar jetzt, in der Gegenwart. Das ist wie bei einem Freund, dessen Freundinnen ausschauen wie geclont, eine wie die andere. Womit man dem klassischen Wiederholungstäter begegnet. Aber was ist die Motivation dieser Wiederholung? Da haben Sie die Bedeutung der Lacanschen Regression: ein Zurückkommen auf Unerledigtes. Die Etymologie eines Wortes zu konsultieren, heißt mithin: an der Kette des Gleichen zurückzuschreiten, die Differenzen und Potentialgefälle eines Bedeutungsfeldes zu denken. Da geht es nicht mehr um den einen Sinn, sondern darum: wie das Wort, mit seinen verschiedenen Konnotationen und Masken, im Feld der Sprache erscheint.
Um ein Beispiel zu geben. Die klassische Linguistik, seit Saussure, hat uns darüber aufgeklärt, daß die Zeichen als arbiträr zu denken sind. Da erhebt, zu Anfang dieses Jahrhunderts, die folgenreiche Idee der arbiträren Zeichens ihr Haupt. Wenn Sie die Philosophie konsultieren, die von autologischen Systemen, Sprachspielen etc. spricht (also die sogenannte „analytische Philosophie“) – so sehen Sie, daß all ihre großen Errungenschaften auf der Idee des arbiträren Zeichens basieren. Das ist die »Währung«, in der gerechnet wird. Fragen Sie einen Adepten dieser Schule, was unter »Abiträrität« zu verstehen, so wird er Ihnen mit der Beliebigkeit des Zeichens kommen, oder er wird Ihnen Derivate desselben Gedankens aufschwätzen, wird von »Selbstreferentialität«, »Autologie« etc. sprechen, kurzum: er wird eine Tautologie mit einer anderen Tautologie beantworten. Nun aber hat das Wort, wie fast jedes Wort, eine lange Geschichte. Wenn Sie das Lexikon konsultieren, werden Sie unter »arbitratus« die nämliche Bedeutung finden: »willkürlich, nach Belieben, zufällig«. Aber schauen Sie unter »arbiter« nach, wird das Bild sehr viel komplexer: da haben wir den Anwesenden, den Mitwisser, den Schiedsrichter, und dann (Sie können gleichsam verfolgen, wie sich hier jemand zu Autorität aufschwingt) den Herrscher und Lenker – und schließlich: den Scharfrichter. Und da stellt sich sogleich die Frage: Was in Gottes Namen ist das Verbindende, und wie ist es dazu gekommen, daß von alledem nur die Bedeutung des Zufälligen geblieben ist? Nun: diese Irritation, so hoffe ich, löst sich sogleich auf, wenn ich Ihnen folgende Geschichte erzähle. Dabei geht es um das arbiträre Zeichen par excellence, jenen Fetzen Papier, auf dem eine Zahl geschrieben ist. Wie man weiß, ist das Papiergeld eine chinesische Erfindung, und so ist der Held dieser Geschichte der chinesische Kaiser. Nehmen wir einmal an, der Kaiser hat einen begehrlichen Blick auf das Haus eines Untertanen geworfen und er bietet ihm ein arbiträres Zeichen dafür an. Nehmen wir an, dieser Geldschein ist so groß, daß ihn der Betreffende niemals wird wechseln können. Er wird sich wohl weigern, dieses „arbiträre“ Zeichen entgegenzunehmen. Was aber passiert dann? Die Antwort des Souveräns ist kurz und schmerzhaft: er wird den Betreffenden hinrichten, wegen Insurrektion und Majestätsbeleidigung. Nur damit da kein Mißverständnis aufkommt: Das ist keine chinesische Spezialität, auch die frühe Neuzeit bestraft die Nichtannahme eines Sovereigns mit Kerkerhaft, Festungsstrafe etc. Und warum, so frage ich Sie, ist es wohl so, daß nur der Staat ein Recht auf Geldemission hat und es mir bei strenger Strafe verbietet, meine eigene Währung, den Burckhardt, zu emittieren. – Nicht, wahr, wenn sie die Bedeutung des Wortes erhören, haben Sie die ganze Geschichte, nicht bloß ihre jetzige Ausgabe.
An dieser Stelle nun könnte man das Hohelied des Hörens singen. Denn hörenderweise können wir in die Sprache zurücksteigen, können wir die Konterbande des Denkens, seine Obertöne, Schwingungen und Konnotationen wahrnehmen. Das ist, wenn man so will, das Geschenk der Sprache. Es besteht darin, daß die Wörter, mögen sie von der jeweiligen Epoche auch das entsprechende Bedeutungskostüm übergezogen bekommen haben, immer auch etwas von ihrer Vorgeschichte, von ihrem Bedeutungsfeld mit sich tragen. Und weil man auf diese Vorgeschichte zurückkommen kann, ist man nicht dazu verdammt, ohne es zu wissen auf ein Unerledigtes zurückzukommen, im Neuen das Alte wiederholen zu müssen. Etwas erhören heißt, daß ich auch aufhören kann.
So besehen wäre das Ohr nicht bloß Ort der Scham, sondern auch der Ort der avanciertesten Reflexion. Tatsächlich hängt dies ja engstens zusammen – wird man zur Reflexion nicht aus Liebe zum Schönen, Wahren und Guten gebracht, nein: es ist vielmehr die Peinlichkeit, die einen zum Nachdenken nötigt, der Versuch, sich fürderhin zu wappnen. Günter Anders hat einmal eine ziemlich präzise Beschreibung dessen gegeben, was die Empfindung der Scham kennzeichnet. Er hat die Scham als das Resultat einer Aporie, einer paradoxen Doppelempfindung beschrieben. Da steht jemand, der weiß, ICH BIN’S GEWESEN – und auf der anderen Seite ist da die Gewißheit: DAS BIN DOCH NICHT ICH! Von diesem Gedanken ausgehend hat Anders das Verhältnis zur Technik analysiert – die Tatsache, daß wir Maschinen bauen, die um sovieles perfekter sind als das, was der unbewehrte Mensch vermag, und er hat dieses Verhältnis als „prometheische Scham“ umschrieben, eine merkwürdige Mischung aus Megalomanie und Beschämung.
Wenn Sie, was ich einmal unterstelle, Fernsehzuschauer sind (mit schlechtem oder gutem Gewissen, gleichviel), kennen Sie die Werbung, die die Firma AOL mit dem Computerlaien Boris Becker veranstaltet. Das spielt genau auf diesem Register der „prometheische Scham“. ICH BIN’S. DAS BIN DOCH NICHT ICH.
Vor einigen Jahren, als ich ein Seminar mit Schauspielern gemacht habe, war für mich die erstaunlichste Erfahrung: daß die jungen Schauspieler auf ihre akustische Performance heftig, viel heftiger reagiert haben als auf eine Videoaufzeichnung. Während sie, wenn man ihnen das Bild servierte, in der Regel ganz selbstzufrieden dreinschauten, war die Reaktion auf die körperlose Stimme einhellig: DAS BIN DOCH NICHT ICH! Und dann: komm, laß mich nochmal! – Die Frage, woher dieser fast reflexartige Widerstand (genauso impulsiv wie der Widerstand der Cutterin) rührt, hat mich sehr beschäftigt. Ist es wirklich bloß der Klang der eigenen Stimme, der da als fremd und unzugehörig abgespalten wird? Um dies herauszufinden habe ich eine weitere Übung gemacht, deren Sinn nur darin bestand, die Verfügungsgewalt über die Textgestaltung auszuschalten. So habe ich die Schauspielschüler gebeten, den Text abzuschreiben und die Worte dazu – aber mit der Bewegung der Hand koordiniert - auszusprechen. So wie Kinder, die ihre Hausaufgaben machen. Das Erstaunliche an dem Resultat war, daß man dieser Textfassung sehr viel leichter folgen konnte – und daß hier die Reaktion des „Das bin ich nicht!“ ausblieb. Die Tatsache also, daß der Aufgabe, konstitutionell, das Moment des Unvollkommenen, des Handicaps eingebaut war, verhinderte also, daß das Resultat als unzugehörig abgelehnt wurde. Daraus aber ist nur zu schließen, daß das Moment der Beschämung von der Konfrontation mit dem psychischen Bild herrührt, das die Stimme evoziert – und das mit der Imago, unserem optischen Outfit, nicht zusammengehen will. Offenbar ist, was sich unserer Stimme einschreibt, komplexer, widersprüchlicher als das, was unser Äußeres an den Tag legt. Die Stimme läßt sich nicht maskieren. Sie entblößt – und ist entblößend. Plötzlich ist da Kloß in der Stimme, eine Heiserkeit, ein Räuspern, und da verschlägt’s einem die Sprache. Was hier zutage tritt, ist die Scham der Imago. Also das, was unterhalb unserer Bildoberflächen liegt.
Der Weg, der vom Auge zum Ohr geht, beschreibt den Weg in die Innerlichkeit. Schon Goethe hat diesen Sprung in einer kleinen synästhetischen Drehung erfaßt, oder besser gesagt: mit einem Übertritt des Visuellen in die Akustik deutlich gemacht: „Man spürt die Absicht – und man ist verstimmt“. Hinter der Fassade öffnet sich ein anderer Raum. Es ist klar, im Begriff der Verstimmung geht’s nicht um Akustik, sondern um Psychoakustik – und dies folgt der Bewegung, der Novalis im frühen 19. Jahrhundert die Losung geprägt hat: Nach innen geht der geheimnisvolle Weg. Wenn Sie die Sprache der Innerlichkeit analysieren, werden Sie verwundert registrieren, wie reichhaltig das akustische Vokabular hier ist: Denn hier ist beständig von Verstimmung und Harmonie, von feinen Schwingungen etc. die Rede. Nun muß man die Innerlichkeit nicht ideologisch oder ästhetisch lesen, man kann sie auch als Symptom einer tiefgreifenden, durchaus materiellen kulturellen Verschiebung deuten. Mit dem 19. Jahrhundert geht die Welt der eingefrorenen Bilder zuende, beginnen die Zeitkünste. Aus der Metaphysik wird Metabiologie: die Zeit läuft, und sie läuft schneller, als das Auge zu sehen vermag. Wenn die Hochgeschwindigkeitsphotographie, Ende des 19. Jahrhunderts, den Flug einer Kugel festhält, so ist damit nicht nur der Triumph der Technik dokumentiert, sondern vor allem, daß wir in einer Welt operieren, in der das Unsichtbare real ist.
Vielleicht wird jetzt deutlicher, woher mein Interesse am Akustischen rührt. Es bezieht sich auf die unsichtbare Welt, es bezieht sich aber auch auf die Strukturen eben dieser unsichtbaren Welt. Das Merkwürdige ist, daß sich hier vorneuzeitliche Gedanken mit postmodernen Lebenserfahrungen kreuzen – was Sie, wenn Sie sich denn in der Musik umhören, als eine Art gegenwärtiger Tendenz ausmachen können: Die gregorianischen Gesänge, Musik für Räume, techno, die immersive environemts etc. Man könnte hier, auch wenn’s die Stilbegriffe durcheinanderwirbelt, von einer Renaissance des Mittelalters (oder der Gotik) sprechen. Und in einem solchen Kontext würde man sagen können: die Stimme ist die anima, Sitz und Ort der Seele.
Und doch: Ist es auch naheliegend, sich von den älteren Bedeutungsschichten der Wörter soufflieren zu lassen, so liegt hier doch etwas zutiefst Problematisches. Allzu schnell findet man sich in einer Harmonie- und Glückseligkeitsblase wieder, bei der man sich zwar der Zustimmung der Gleichgestimmten sicher sein kann, aber auf Kosten der intellektuellen Einsicht in die Strukturen unserer Gegenwart. An genau dieser Stelle aber ist mir die Auseinandersetzung mit den Klängen überaus hilfreich gewesen: nicht bloß rezeptiv, sondern in der Bearbeitung. Hier, so scheint mir, tut sich mit den Klängen ein gedanklicher Mehrwert auf, werden die Umrisse jenes Geisteskontinents sichtbar, auf den wir heute, im Blindflug vielleicht, zusteuern. Wenn Sie so wollen: in der medialen Behandlung der anima, die man nun nicht mehr als das schlechthin Unerhörte, sondern als ein je historisches Wesen fassen sollte, wird ihre tatsächliche Befindlichkeit sichtbar. So wie wir unsere Symbole bearbeiten, bearbeiten wir auch uns selbst. Und damit möchte ich zum Radio kommen, oder genauer: zu jenen Stimmen, die, ihren Körper hinter sich lassend, in den Raum hinausstrahlen – und die, wenn man so will, die Prototypen jener Identitätsmaschinen sind, denen wir in den Zeiten des Internets begegnen.
Die Genealogie des Radios ist in gewisser Hinsicht von einer tiefen Prägnanz. Wie man weiß, war das Radio vor allem für die Seefahrt von Belang, ein Navigationssystem (das für den Anfang unseres Jahrhundert die Bedeutung und den Entwicklungsstand besaß wie etwa das Global Positioning System für unsere Gegenwart). Und da saß im April 1912 ein junger Mann, David Sarnoff, im Gebäude der Wireless Telegraph Company in New York, und fing von irgendwoher, aus Neufundland, Botschaften auf: das SOS der untergehenden Titanic. Im Bewußtsein der nahenden Katastrophe organisierte er, in einer 72-Stunden-Seance, eine Art Konferenzschaltung verschiedener Funkstationen. In diesem Sinn ist der Untergang der Titanic die erste Live-Übertragung. Und sehr bald, abermals von dem jungen Sarnoff auf den Weg gebracht, folgte diesem Ereignis die Gründung von RCA, dem ersten Rundfunksender. Wenn Sie so wollen: an dem Tag, an dem die Titanic in den Wellen des Atlantic versank, erblühte jener imaginäre, virtuelle Raum der Radiowellen. Mag sein, daß ihnen eine solche Deutung allzu holzschnittartig, vielleicht auch verwegen erscheint. Aus diesem Grund möchte ich Ihnen mit einigen weiteren Details dieser merkwürdigen Geschichte aufwarten, die ein andere Zeuge erzählt hat. Auch er war Funker, nur daß er als Funkoffizier auf der Titanic tätig war, und das was er zu berichten hatte, war nicht mehr live, sondern jener Teil der Geschichte, bei dem es ums nackte Überleben ging. Harold Bride, das war der Name, hatte sein Funkgerät verlassen und sich entschieden von Bord zu gehen. Aber nicht alle Besatzungsmitglieder waren so überlebensbewußt. Da gab es zum Beispiel die Musiker, ein Streichersextett, und die standen da und spielten und spielten und spielten.
Von hinten hörte man die Klänge der Band. Sie spielten ein Ragtime-Stück. Das Schiff senkte seine Nase - wie eine Ente, die gleich untertauchen wird. Ich hatte nur einen Gedanken – dem Sog zu entkommen. Die Band spielte noch immer, und ich denke, alle Musiker gingen unter. Sie spielte einen Hymnus: Autumn. Ich schwamm mit all meiner Kraft. Ich denke, ich war 50 Meter entfernt, als die Titanic mit ihrem Bug, das Heck senkrecht in die Luft hinaufgestreckt, unterging... Die Art und Weise, wie die Band immer weiterspielte, war wahrhaft nobel. Ich hatte sie zuerst gehört, als wir funkten, da spielten sie dieses Ragtime-Stück, das letzte, was ich von ihnen sah, war, als ich mit meinem Lebensrettungsring im Meer herumschwamm, war, wie sie auf dem Deck standen und „Autumn’ spielten...
Als Harold Bride, der Augenzeuge, nach New York zurückkehrte, wurde er von Marconi höchstselbst empfangen, der ihm, zutiefst bewegt, die Hände schüttelte. Woher die Bewegung? Marconi, obschon Physiker – und von daher vor allem an der Effizienz seiner Apparatur interessiert – war alles andere als ein bloßer Physiker; ja, man könnte sagen, er war soetwas wie ein Pata- oder Metaphysiker. Bis zum Ende seines Lebens war er überzeugt davon, daß Schallwellen niemals wirklich untergehen, sondern daß sie lediglich leiser und leiser würden. Nicht wahr: wenn ein Geräusch entsteht, bewegen sich die Schallwellen durch die Luft, pflanzen sich fort, über Länder, Erdteile hinweg – und man weiß, daß innerhalb von 24 Stunden die gesamte Atmosphäre über die Einspeisung eines solchen Geräusch eine Veränderung erfährt. Gäbe es nun eine Apparatur, die das zu lesen verstünde, so wäre die Luft eine Bibliothek als dessen, was jemals gesagt worden sei (und wie um zu belegen, daß es hier um Höheres geht als um die Physik, verweist Marconi darauf, daß man dann möglicherweise auch hören könne, was Jesus Christus gesagt habe – womit die Luft selbst, der Äther, eine heilige Schrift darstellen würde). Dieser Gedanke findet sich keineswegs bei Marconi allein, auch der Computeriponier Charles Babbage hat ihn in seinem Ninth Bidgewater Treatise, in fast gleicher Form, artikuliert. Wir begegnen hier einer anima-Vorstellung, einer Unsterblichkeitsvorstellung, die sich auf das Material bezieht, aus dem sich die Radiowellen speisen. Wenn ich vorhin von Panakustik geredet habe, so haben sie hier die dazugehörige Theorie. Das Bezeichnende hier ist, daß man, um hier etwas lesen zu können, ganz anders vorgehen muß, als wenn sie ein visuelles Objekt dingfest machen – denn hier gilt es den Zustand des Gesamtsystems zu kennen, um ein Detail erfassen zu können. Die Verbindung von Körper und Umraum ist konstitutionell, systemisch.
So sollte man sich auch von der nachgerade religiös aufgeladenen Seite dieser Vorstellung nicht irritieren lassen. Was sich in dieser Verschmelzungsform von Technik und Mystik ankündigt, ist tatsächlich eine neue Ratio (und in diesem Sinn ist die Techno-Mystik eine Art Übergangssymptom – was man auch aus dem Mittelalter gut kennt, als der Räderwerkautomat als eine Art Gottesgabe gefeiert wurde). So besehen ist es präziser, hier nicht die überzeitliche, metaphysische Seele suchen zu wollen, sondern vielmehr jene besondere anima in den Blick zu nehmen, die in der Konfliktzone zwischen Ewigkeitswunsch und technischer Ratio liegt. Etwas hochgestochen könnte man von einer Identitätsmaschine sprechen. Und da ist natürlich (was die Konstitution dieses Wesens anbelangt) die entscheidende Frage, welche Prinzipien hier herrschen. Damit komme ich – endlich – zu jenem Punkt, der mich in der Arbeit mit dem akustischen Material zutiefst beschäftigt hat.
In gewisser Hinsicht – und das war wohl der Grund des unmittelbaren Angerührtseins – ist all dies in der Geschichte der untergehenden Titanic beschlossen, kam mir dieses Bild wie eine nachträgliche Erläuterung all dessen vor, was mir reizvoll erschienen war: nämlich das akustische Material zu deformieren, es langsam, zeitlupenartig zu transformieren, es zu rhythmisieren und im Hintergrundsgeräusch versinken zu lassen. Und da fragt man sich, wenn man sich denn nicht als besonders destruktionswilliger Typ begreift, im Laufe doch schon einmal: Was treibt dich dazu? Vor allem aber: woher rührt die Schönheits-Empfindung, die dir ein solches Klangereignis vermittelt? Die Antwort, so würde ich heute sagen, ist, daß all diese Operationen – in symbolischer Form – jene Transformationen zutage treten lassen, denen man heutzutage unterlegen ist. So wie man die Symbole bearbeitet, so wird man auch selber bearbeitet. Allgemeiner gesprochen: Was in all diesen Operation greifbar hervortritt, ist die Konstitution des zeitgenössischen Subjekts. Dieses Subjekt hat nichts mehr gemein mit dem Bild, das die Frührenaissance uns – als Ausschnittbogen – geliefert hat: Halbbrustbild vor tiefer Landschaft. Anders gesagt: die Schwundformen meiner selbst, die zerstreuten Existenzen fügen sich nicht mehr zu jener Einheit zusammen, wie sie das Bild suggeriert. Da gibt es gleichsam eine untergründige, maritime Dimension, da gibt es ein Ausstrahlen, das über die Leibesgrenze hinweggeht – da gibt es schließlich die Gemeinde der Ohrenzeugen, die im Bewußtsein des Untergangs sich zu einer Gemeinschaft zusammenschließt (was Peter Sloterdijk einmal sehr schön formuliert hat: die Nation als Sorgenvibrator). Eingedenk all dieser Wirklichkeiten ergibt es nicht viel Sinn, zu behaupten, daß ich ein Individuum bin. Tatsächliche teile ich mich auf, entwickele Partialexistenzen. Und Teile dieser Partialexistenten sind virtuell, wie die Stimme meines Anrufbeantworters, die auch dann noch Botschaften entgegennehmen wird, wenn ich tot bin, oder sie mögen, als Agenten und Avatare, Wiedergänger meines freien Willens, im Internet herumgeistern. Vielleicht sind Sie auf Anhieb geneigt, all diese elektromagnetischen Schattenexistenzen als Simulakren, als unechte, uneigentliche Anhaftungen zu deuten. Freilich wirken diese virtuellen Schattenwesen längst auf mein eigentliches Selbst zurück, und in einem Maße, daß ich geneigt wäre zu sagen: was wäre ich ohne sie?
Man kann die zeitgenössische Apotheose des Kommunikationsbegriffs auch ganz ausdeuten. In dem Maße nämlich, in dem ich zur Mit-Teilung angehalten bin, zerteile ich mich, entwickele ausdifferenzierte Teilstücke meiner selbst – und werde, nolens volens, zu einer Art Dividuum, einem freiflottierenden Massewesen. Und da ist es angelegentlich sinnvoller, Teile dieses Identitätsaggregats nicht als weltabgeschlossene Korpuskel, sondern als Welle zu deuten, das heißt: unter dem Gesichtspunkt, wie dieses Wesen im entsprechenden Umraum erscheint. Die Auflösung des Körperzentrums (als der hervorragenden Ortes unserer Persönlichkeitsbildung) macht vielleicht das Geheimnis des derzeitigen Körperkults aus. Im Grunde ist die Abschließung und Perfektionierung des Körpers Symptom nicht die Apotheose des Narziß, sondern Symptom seiner fortschreitenden Dissoziation, ist es nicht von ungefähr, daß man sich mit Silikon und Anabolika aufpumpt. Aber man muß das vielleicht gar nicht dramatisieren. Der Untergang des Subjekts (als einer gleichsam weltlosen, individuellen, will sagen: unteilbaren Einheit) heißt ja nicht, daß wir nicht mehr ICH sagen werden, sondern es besagt: daß die Phantasie der Imago, daß unsere körperlichen Outfits nicht mehr greifen, daß die Grammatik der Repräsentation an ein Ende gekommen ist. Genau an dieser Stelle wird die Auseinandersetzung mit dem Geräusch interessant, lehrt es uns doch, daß wir konstitutionell in anderen Räumen stecken, daß es sinnlos ist, hier jene klinische Scheidung von Subjekt und Objekt anzusetzen. Wir zerstreuen uns, verlieren uns in Räumen, tauchen ab in submarine Zonen. Es gibt viele Begriffe dafür, und mehr oder weniger ausdrücklich ist dies in allen zeitgenössischen Theorien enthalten. Wenn Sie etwa die Luhmannsche Systemtheorie nennen (die stets um das Verhältnis von System und Umwelt kreist), sehen Sie, daß die Auflösung des Individuums diesem Gedankengebäude axiomatisch bereits eingebaut ist, daß der Begriff des Subjekts an die gesellschaftliche Institution (den Diskurs der Macht, der Anerkennung, des Geldes, der Liebe) übergegangen ist. Freilich ist es deswegen irrig, gleich den Tod des Subjekts zu verkünden – werden wir auch in Zukunft noch ICH sagen.
An genau dieser Stelle sind die Techniken der zeitgenössischen Klangbearbeitung interessant. Anders als beim Film, der ja im wesentlichen über den Schnitt funktioniert (also über die Logik von Anwesenheit / Abwesenheit), steht im Felde des Klanggeschehens die Frage im Zentrum, wie ein Körper im Raum erscheint. Die Fixierung auf einen weltlosen Körper demgegenüber ist wenig ergiebig – dies hieße: den Sinuston als den idealen Klang zu denken. Der Klang jedoch ist stets Kompositum: notwendiger zusammengesetzt aus Eigen- und Fremdgesetzlichkeit, Klangquelle und Akustik. Technisch gesprochen gesprochen geht es um die Mischung: wie verhält sich dieser Körper zum Umraum? Von daher ist es kein Zufall, daß ein Großteil der Klangbearbeitungsoperationen sich nicht auf den Schnitt, sondern auf die Mischung bezieht, daß es um Mixes und Remixes geht. Wenn ich das jetzt einmal ins Philosophische hebe, so haben wir, als entscheidendes Moment der zeitgenössischen Subjektkonstitution, eine Figur, die ich, provisorischerweise, den Mischling möchte. Man zerlegt sich und setzt sich immerfort neu zusammen. Wo früher das Idealbild des Homogens war, entsteht nunmehr das Bild einer Proteusexistenz.
Nun - an dieser Stelle kommt ein Element ins Spiel, das ich hier nur – um den Zeitrahmen nicht überzustrapazieren – ganz kurz bloß andeuten möchte. Das Meer, in dem wir versinken, ist nichts anderes als: Software. Darin unterzugehen, bedeutet, mit der Beschaffenheit der digitalen Logik konfrontiert zu werden. Digialisiert werde ich zum Sample meiner selbst. Die Grundformel des Computers lautet x = xn. Das klingt sinnlos, aber wenn Sie’s auf die Null oder auf die Eins, das heißt die Grundfesten des Systems, applizieren, macht es Sinn. Wenn ich meinem digitalen Schatten begegne, habe ich kein Double vor mir, sondern einen Genpool, einen Multiplex, eine Vielheit. Ein solcher Schatten steht notwendigerweise unter einer Proliferationsdrohung (und in diese Sinn ist die Rede vom „Original“ obsolet – oder genauer: überflüssig). Wenn ich hier nun der Bezug zur Genetik herstelle, so ist dies weder zufällig noch metaphorisch – denn die Prozeduren der Klangbearbeitung sind, symbolisch besehen, genetische Operationen excellence. Man nimmt einen Originalstring, benutzt irgendeinen Algorithmus, und dann haben Sie ein Derivat, einen Mischling, der sich aus dem ursprünglichen Klang und seinem hinzuaddierten Hybriden zusammensetzt. Im Gegensatz nun zu einer statischen Größe (sagen wir: einem computerbehandelten Photo) sind diese Prozesse, der Natur des Klanges folgend, dynamisch. Wenn ich versuchen würde, dies ins Bildliche zu übersetzen, so hätte man einen pulsierenden Körper vor sich, der sich ausdehnt, zusammenschrumpft, der seine Gestalt und Form wandelt, der sich aufzuspalten und auszuschwärmen vermag – kurzum: man hätte ein metamorphes, proteusartiges Wesen vor sich. In gewisser Hinsicht sind diese Umschreibungen hier ganz überflüssig, bin ich doch sicher, daß Ihnen all dies – als Teil ihrer Lebenswirklichkeit – längst vertraut ist. Die Klänge des Techno etwa laufen in diesem Register, und sie skandieren den metamorphen Körper, die beständige Vermischung von Klang und Umraum, den Übergang von einem zum andern. Das macht das ekstatische Moment daran aus. Ek-stasis: das heißt ja wörtlich, Aus-sich-Heraustreten. In diesem Aus-sich-Heraustreten wird der Körper als durchlässige, permeable Größe erfahren, die sich mit dem Außen vermischt, und so kann man wähnen, daß der eigene Leib eine Art Kollektivleib ist, in dem der Rhythmus der Gruppe pulsiert. Bum Bum Bum. In der Parade der vibrierenden, zuckenden Körper vollzieht sich die lustvolle Inszenierung des Untergangs: was es bedeutet, sich als Dividuum zu erfahren, im Strom der anderen zu wogen. Wenn man so will: die heroische Geste der Musiker auf der Titanic, die im Meer untergehen, erlebt im Techno seine beständige Wiederholung. Aber wozu? Vielleicht, um hier den Übergang in die Virtualität, in die Welt des Scheins und der Körperlosigkeit feiern zu wollen. Freilich liegt hier, in nuce, bereits einer neuer Grund der Beschämung. Daß da so viele Möglichkeiten sind, und nur ein einziges Leben. Denn zwischen dem Leib und seinem symbolischen Multiplex herrscht eine kategorische Asymmetrie – und so bedarf es einer Zugabe von Ecstacy, um den Übertritt in die Kollektivexistenz zu bewerkstelligen.
Vielleicht ist das der Grund, warum ich, wenngleich ich das Lob des Ohrs singen möchte, doch nicht ganz Ohr sein möchte. Und vielleicht wissen Sie jetzt, warum ich ein abstehendes Ohr – und es doch nicht richten lassen will. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Themenverwandt
Tat ohne Täter
Wenn Meister Eckhart den schönen Gedanken formuliert hat, dass Gott einfach sei, so ist damit gemeint, dass jedes komplexe System auf grundlegende Einsichten zurückgeht – und sich damit als das entpuppt, was Thomas Bernhard in einem wunderbaren Titel zusammengefasst hat: einfach kompliziert. Aus dieser Warte betrachtet wohnt jedem Geda…
The Price of Identity
The following essay is a translation of a piece Martin wrote for Lettre International, Europe’s leading cultural magazine, in the fall of 2019. It continues a line of thought that dominated his first book: the connection between images and numbers. While this may be evident on every coin, the dual emergence of Central Perspect…
Die Erfindung der Maus
Dieses kleine Kapitel aus der 2018 erschienenen “Kurzen Geschichte der Digitalisierung” beschreibt eine in Vergessenheit geratene Revolution - und ist damit der Prätext für ein nachfolgendes Video, das sich mit der 68er Revolution beschäftigt.