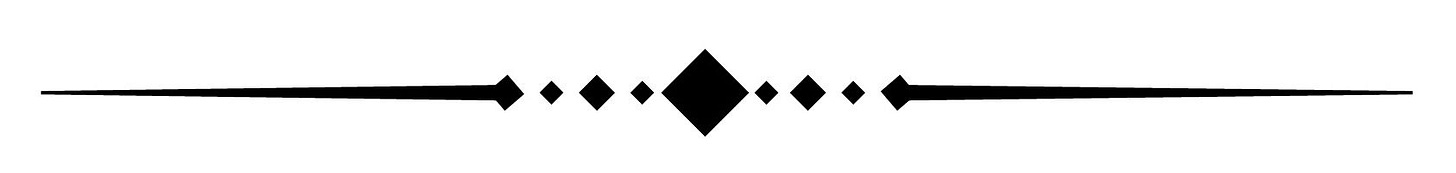Wenn Meister Eckhart den schönen Gedanken formuliert hat, dass Gott einfach sei, so ist damit gemeint, dass jedes komplexe System auf grundlegende Einsichten zurückgeht – und sich damit als das entpuppt, was Thomas Bernhard in einem wunderbaren Titel zusammengefasst hat: einfach kompliziert. Aus dieser Warte betrachtet wohnt jedem Gedankensystem eine gewisse Schlichtheit inne – was selbstverständlich (wie sollte es anders sein?) auch auf das eigene Denken zutrifft. Deswegen nun dieser Vortrag aus dem Jahr 1996, welcher den Gedanken des Zeitrisses mit dem Einschnitt der Guillotine verknüpft – eine Erfahrung, die sich meiner Übersetzung von Guy Lenôtres Sozialgeschichte der Guillotine verdankt, einem Buch, das gerade seiner körperlichen Prägnanz wegen meinen Blick auf die Moderne, aber auch auf die zeitgemäße Ratio mit einem Abgründigkeitsbewusstsein versorgt hat. Und weil die Zeitläufte mit den aufmerksamkeitsökonomisch gefütterten Medien sich ihre telematischen Guillotinen geschaffen gaben, sich in der moralischen Ökonomie zudem die ersten Wohlfahrtskomitees bilden, erscheint hier dieses Memento. Ein besonderer Dank hier gilt Hopkins Stanley, weil er diese alten Texte ins Amerikanische übersetzt, mich überhaupt erst dazu gebracht, in die eigene Vergangenheit zurück zu steigen.
Zeitriss
Über Todestechnologie und Rationalisierung
Vortrag für die Guardini-Stiftung, Berlin, Mai 1996
Meine Damen, meine Herren,
ich möchte Ihnen heute etwas über die Guillotine vortragen, oder, wie es im Untertitel heißt, und so holprig, so dass auch ich ins Stolpern gerate darüber – über den Zusammenhang von Todestechnologie und Rationalisierung. Nun, wenn ich schon stolpere, ist anzunehmen, dass es Ihnen nicht viel besser ergeht. Und wenn ich ein Wort wie Todestechnologie in den Mund nehme, so ist es nicht allzu verwunderlich, dass man ins Stolpern gerät. Im übrigen mögen Sie sich fragen, was die Guillotine, dieses sinistre Instrument, das uns an die Schwelle der Moderne zurückführt, mit unserem Thema zu tun hat, das da lautet: die Zeit.
Ein anderer Titel, der mir im Kopf vorschwebte (und der den Bezug zu unserem Thema sehr viel deutlicher hätte markieren können), lautete Zeitriss – und der Gedanke, der dahinter steckt, besagt, dass irgendwann gegen Ende des 18. Jahrhunderts das Denken eine tiefgreifende Umwälzung erlebt hat. Das ist so neu nicht – wir haben eine ganze Reihe von Revolutionsformeln dafür gefunden. Die Menschenrechte, die industrielle Revolution, ja der Begriff der Moderne selbst – all das besagt nichts anderes als neue Zeit. Was die Revolutionäre mit großen Getöse selbst inszenierten, indem sie die christliche Zeitrechnung dispensierten und ihr Jahr I ausriefen, in jenem Schreckensjahr 1792, als auch die Guillotine ihren Dienst aufnahm.
Worum es mir geht und weshalb ich auf den Zeitriss der Guillotine zurückkommen möchte, ist etwas anderes: ich möchte die Zeit der Revolution neu betrachten, und zwar invertiert: als eine Revolution der Zeit. Wenn Sie sich eine Guillotine vor Auge halten, so werden Sie mir sofort konzedieren, dass der Begriff Zeitriss hier fast eine metonymische Dimension erhält – ruckzuck, und dann ist es passiert. Die Zeit der Revolution ist wirklich eine Revolution der Zeit.
Wobei Zeit hier nicht jene abstrakte, metaphysische Dimension annimmt, wie sie ein naturwissenschaftlich fundierter Begriff so leicht anzunehmen bereit ist, sondern Zeit wird begriffen als eine jeweilige, jemeinige Zeit. Und das heißt: es ist eine zugleich geschichtliche und eine persönliche Zeit. Und wenn ich meinen Kopf unter ein solches Messer halte, so ist es meine Zeit, die reißt – und eben das nehme ich persönlich.
Ich möchte die Zeit also auf den Körper zurück schreiben – was ja ein jedermann tut, der sich eine Räderwerkuhr oder eins jener digitalen, funkgesteuerten Wunderdinger ans Handgelenk heftet. Wenn ich von Zeit rede, rede ich also im wesentlichen von einer Zeittechnologie, von der Art, wie ich mit meiner Zeit umzugehen pflege. Eben hier, so behaupte ich, läuft ein Riss, ein Riss, der sich durch unsere und durch meine Gegenwart zieht. Das ist die Bedeutung dieses verworfenen Titels: Zeitriss.
Vielleicht – und hier liegt mein Beweggrund dafür, nicht diesen schnittigen Titel gewählt, sondern mich auf das Stolpern des Gedankens verlassen zu haben – ist eines der wesentlichen Probleme unserer Moderne, dass sie über diese Schwelle einfach fortgeschritten und nicht, wie es angemessen gewesen wäre, ins Stolpern geraten ist. So dass es uns Postmodernen vorbehalten bleibt, im nachhinein über diesen unseren Fortschritt, und das heißt eigentlich: über ein ausgebliebenes Stolpern zu stolpern.
Also die Guillotine. Wer stolpert nicht, wenn es dem Tod entgegen geht? – Alle, würden wir sagen, aber das stimmt so nicht ganz. Denn es gibt Menschen, die das Geschäft des Todes betreiben, und von denen man genau dies verlangt: dass sie nicht stolpern, sondern mit sicherer, umsichtiger Hand zu Werke gehen. Der Henker zum Beispiel.
Die Position des Henkers ist schon sehr interessant. Warum, beispielsweise, bewirkt ein Wort wie Todestechnologie, dass man stolpert? Der Grund dafür scheint mir sehr einfach, und er wird noch sehr viel einfacher, wenn man nicht von einer abstrakten Technologie, sondern von ihrer Verkörperung spricht. Also vom Henker. Der Henker, der an der Schwelle vom Diesseits zum Jenseits operiert, erinnert uns daran, dass eine jegliche Technik nicht bloß, wie die Philosophen sagen, ein innerweltliches Phänomen ist, ein Phänomen der Immanenz, sondern dass sie Mittel und Wege bereitstellt, den einen oder anderen auch aus der Welt herauszubefördern. Womit Technik stets auch das Problem der Transzendenz auf dem Hals hat, in dem Maße vielleicht, in dem sie über Leben und Tod befindet – heute mehr noch als je. Nun, diese Macht, ans Transzendente zu rühren, war lange der Person des Henkers vorbehalten – und vor diesem Hintergrund wird verständlich, dass man dem Henker, wie auch dem Blut seiner Opfer, thaumaturgische und wunderheilende Kräfte zugeschrieben hat.
Wie auch immer das sein mag. Der Henker, insofern er die Todestechnologie in sich verkörpert, markiert also jenen äußeren Rand der Vernunft, wo die Todesdrohung ausgesprochen und exekutiert wird. Dazu bedient er sich bestimmter Techniken. Todestechniken. Insofern ist die Etablierung der Guillotine schon interessant – haben wir es damit zu tun, dass hier, an einer kritischen Grenze, sich eine Verschiebung ereignet. Normalerweise, wie gesagt, geht man im Fortschrittsglauben über derlei hinweg, ja ist der Fortschritt, ex definitionem, ein solches Verschwindenmachen der Grenzen – nur dass man hier, an der Grenze des Todes, zögern mag, vom Fortschritt zu sprechen.
Nichtsdestotrotz, all jenen, die das Geschäft des Todes betreiben, sind derlei Skrupel fremd. Sie fragen sich, wie jeder andere Gewerbetreibende, ob dies oder jenes Detail ihrer Tätigkeit nicht ein bisschen komfortabler gestaltet werden könnte. In diesem Sinn ist die Guillotine zweifelsohne ein Fortschritt. Nun will ich Sie nicht mit allzu gräulichen Einzelheiten behelligen, möchte Ihnen aber doch eine Passage über die Begründete Meinung über die Art der Enthauptung, verfasst von Dr. Louis, dem ständigen Sekretär der Chirurgischen Akademie, nicht vorenthalten.
Man muss sich hier ins Gedächtnis rufen, was bei der Enthauptung des Marquis de Lally beobachtet worden ist: er kniete, seine Augen war verbunden; der Scharfrichter schlug ihn auf den Nacken; der Schlag jedoch hat den Kopf nicht abtrennen können, ja er konnte es nicht. Denn der Körper im Fall, wo er durch nichts aufgehalten wurde, drehte sich, und es bedurfte drei oder vier weiterer Säbelhiebe, um den Kopf schließlich vom Rumpf abzutrennen. Mit Schrecken nur hat man diese Hackerei gesehen, wenn es erlaubt ist, dieses Wort zu prägen.
Da sieht man, dass ein Wort wie »Todestechnologie« eben doch seine Berechtigung hat. Es war – und eben darin bestand die Argumentation des berühmten Philanthropen Doktor Guillotin, der der Nationalversammlung dieses Gerät anempfahl (mit dem etwas ungeschickten Argument: Ich schlage Ihnen im Nu den Kopf ab, und Sie spüren gar nichts dabei) – es war die höhere, menschenfreundliche Ratio seines Maschinchens, welche die Abgeordneten überzeugte. So besehen kann man in der Guillotine, wenn wir die Glaubwürdigkeit und Lauterkeit ihres philanthropischen Namensspenders unterstellen, nun wahrhaft eine Segnung der Technik sehen – jedenfalls dann, wenn wir die Todestechnologie abstrakt betrachten.
Nun ist es, wie man weiß, gar nicht so leicht, eine technische Neuerung durchzusetzen. Als die Guillotine im März 1792 auf der place de Grève eingeweiht wurde, da war das zahlreich herbeigeströmte Publikum keineswegs angetan. Das Spektakel war einfach zu kurz, die Agonie des Opfers kaum spürbar – und so lief der Pöbel, der sich um den Thrill, die kathartische Wirkung betrogen fühlte, anschließend durch die Straßen und grölte, dass man seinen guten, alten Galgen wiederhaben wolle. (Wobei das französische Wort für den Galgen potence lautet, also Potenz – worauf wir, im Zusammenhang mit der entmachteten Macht, dem König, noch zurückkommen werden).
Als Spektakel und als Volksbelustigung war die Guillotine ein Flop. Erst als sich der Vorgang serialisierte, als Kopf um Kopf ins Rollen geriet, begann die Bevölkerung einen gewissen Geschmack an der Sache zu entwickeln. Zum Beispiel errichtete man dem Schafott gegenüber ein Restaurant, wo auf der Speisekarte nicht nur die Speisen, sondern auch die Liste der zu erwartenden Opfer verzeichnet waren. – An dieser Stelle, wie gesagt, haben wir es mit eben jener dialektischen Verschlingung zu tun, die der wohlmeinende Doktor nicht im Auge gehabt haben mag. Denn eben dadurch, dass die Guillotine, ruckzuck und ganz seriell, Kopf um Kopf rollen ließ, machte sie den Terreur, den sozusagen nebenher verspeisten Massenmord erst möglich. Erst durch die Wiederholung vermittelte sich jener Kitzel, den früher der Galgen zu befriedigen vermochte, ja entstand etwas Neues, etwas, was sehr viel mehr mit dem Filmschnitt zu tun hat, dem Rhythmus, der Skansion. – Nun mag Ihnen dieser Vergleich zwischen dem filmischen Bild und der Guillotine wie ein bloß metaphorischer Parallelismus anmuten, oder, im Gegenteil: so augenfällig, dass er schon fast wieder unwahrscheinlich erscheint. Wem steht da nicht die Klappe vor Augen, die heruntersaust wie das Fallbeil und annonciert: Szene Sowieso, die 1. – und dass es, wenn es geglückt und die Szene im Kasten ist, lakonisch heißt, gestorben – die Nächste bitte! Freilich: beschäftigt man sich mit der Frühzeit des filmischen, und das heißt eigentlich: des photographischen Bildes, so treten die historischen, aber auch die strukturellen Parallelen sehr viel deutlicher hervor. So wie das Hauptanliegen der Konstrukteure der Guillotine in der Fixierung des Patienten bestand, so waren auch die ersten Porträt-Photographen damit beschäftigt, den Körper so hin zu richten, dass der Schuss der Kamera ihn auch wirklich erwischte. Anders gesagt: die Guillotine war in gewisser Hinsicht der erste filmische Schnitt, denn sie vermochte in real time, was die Welt der technischen Bilder sehr viel später erst aufzuzeichnen vermochten.
Lassen Sie mich dazu eine kleine Geschichte erzählen, die ich bei Guy Lenôtre gefunden habe, einem französischen Historiker, der um die Jahrhundertwende ein wunderbares Buch über die Guillotine geschrieben hat. Ich werde dazu ein bisschen ausholen, aber weil es eine sehr merkwürdige Geschichte ist, und eine der wenigen Geschichten dazu, die uns detailliert berichten, was dort vor sich gegangen ist, nehme ich mir diese Zeit. Es geht dabei (behalten Sie das im Kopf) um das Auge, das Eye, das Ich. Der Held dieser Geschichte ist ein junger Oratorianpriester, der Abbé Carrichon, der im Paris des Jahres 1794 untergekrochen ist, aber gleichwohl ein Versprechen abgelegt hat. Diese schlichte und überaus empfindsame Seele hat einer ihm verbundenen Familie, der Gräfin von Noailles, ihrer Tochter und ihrer greisen, schon kindisch gewordenen Schwiegermutter, versprochen, ihnen die Absolution zu erteilen, wenn es denn so weit sein soll. Und um nicht als Priester zu erscheinen, ist vereinbart, dass er sich in einen dunkelblauen Frack und eine rote Weste gewandet.
Am 22. Juni des Jahres 1794, dem Tag der Hl. Madeleine ist es soweit. Man klopft. Der Hauslehrer der Familie steht vor der Tür, mitsamt den Kindern, die Waisen werden sollen an diesem Tag, die aber ahnungslos sind und fröhlich, und er annonciert, dass es soweit ist. Der Abbé hat gewusst, dass dieser Augenblick kommen wird, nichtsdestoweniger trifft es ihn, und was ihn am meisten trifft, ist die Begegnung mit dem Schafott. Wie gesagt, er ist eine höchst empfindsame Seele, und der Gedanke, dass er Blut sehen soll, das ist ein Kopfschmerz, der ihn nicht loslässt. Wie eine tickende Uhr. Er zieht sich um. Er geht zum Revolutionstribunal, nichts deutet auf einen Aufbruch hin. Er geht in die Kirche, er lässt sich von einer Bekannten einen Kaffee zubereiten, um den Kopfschmerz zu zerstreuen, er geht wieder zum Palais zurück, mit dem Wunsch nicht anzukommen, jene nicht anzutreffen, die ihn dorthin bestellt haben. Der Hof des Gebäudes ist geschlossen, dennoch kündigt die Bewegung im Innern an, dass etwas bevorsteht. Die erste Karre fährt durch das Tor – und der Abbé entdeckt, dass die greise, kindische Marschallin darauf sitzt. Ihre Schwiegertochter und Enkelin sind nicht da. Der Abbé schöpft Hoffnung. Aber dann, auf dem zweiten Wagen, entdeckt er sie: die Mutter im blauweißgestreiften Morgenrock, die Tochter in jenem weißen Kleid, das sie seit dem Tod ihres Vaters nicht mehr ausgezogen hat. Die beiden Karren stehen eine Viertelstunde vor dem Palais, wobei die Todgeweihten den Beschimpfungen der Menge ausgesetzt sind. Der Abbé versucht, sich seinen Beichtkindern bemerkbar zu machen – aber die Menge ist zu dicht, er gelangt nicht nah genug an sie heran, sie sehen ihn nicht. Die Wagen setzen sich in Bewegung. Der Abbé Carrichon irrt durch die Menge, er macht einen großen Umweg, er baut sich an einer Brücke auf, an einer Stelle, wo er glaubt, dass sie ihn sehen müssen. Aber vergeblich: Ich habe alles getan, was ich konnte. Von überallher wird die Menge immer größer. Ich bin müde. Ich werde mich zurückziehen.
In diesem Augenblick bricht ein Gewitter los. Binnen Sekunden sind die Straßen wie leergefegt, und dem Abbé Carrichon, der ganz durchnässt ist vom Schweiß und vom Regen, gelingt es, sich den Damen bemerkbar zu machen. Im Laufschritt, hinter dem Karren herlaufend, der seine Fahrt beschleunigt hat, den Kopf gegen den herabstürzenden Regen geschützt, erteilt er ihnen die Absolution. Und eigentlich könnte er, den die vor Angst vor dem Schafott den ganzen Tag über schon heimgesucht hat, umkehren, jetzt.
Aber sonderbarerweise: er folgt dem Zug, er folgt ihn bis zur place du Trône, wo er das Schafott sieht, das ihn schaudern macht. Der Regen hat aufgehört, eine große Menschenmenge hat sich eingefunden. Es ist merkwürdig: nunmehr verändert sich die Erzählung des Abbé.
War das Warten vor dem Justizpalast ein nach innen gewendetes Grübeln, eine Art Gedankenkrampf, bei dem er nichts anderes mehr hatte denken können als die verstreichende Zeit, noch zwei Stunden, anderthalb Stunden, noch eine Stunde – eine milchige trübe Angst, die sich zu einem Kopfschmerz zusammenballt, tritt er aus sich heraus. Jetzt, da er sein Versprechen erfüllt, da er die Absolution erteilt hat, ist auch er absolutiert, freigesprochen. Er ist nunmehr ganz Auge, und um besser sehen zu können, wechselt er den Platz. Ich sehe den Henkers-Meister und seine beiden Gehilfen. Der eine der beiden Gehilfen fällt durch seine Größe auf, seine Körperfülle, die Rose, die er im Mund hält, die Kaltblütigkeit und die Besonnenheit, mit der er agiert – und wie eine Kamera hält sein Blick alles fest, die aufgekrempelten Ärmel, die gekräuselten Haare, die zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden sind – und so notiert sein Auge, mit einem gewissen Bewundern, wie präzis all das hier vor sich geht, wie sanft doch eigentlich die Marter ist – schrecklich nur durch die schnell aufeinanderfallenden Schläge – und so sieht er, wie das erste Opfer vollzogen wird, sieht, wie schnell es geht, sieht, wie man einen Alten mit schlohweißem Haar auf das Schafott hinaufführt, wie er dabei gestützt wird von den beiden Gehilfen, die sich im übrigen durchaus respektvoll und ehrerbietig erweisen, sieht, wie sie ihn festbinden, wie die Klinge heruntersaust, wie der Kopf durch das Loch im Boden in den Kleiesack plumpst, sieht, wie der kopflose Körper auf einen Kippkarren geworfen wird, wo alles im Blut schwimmt, und er sieht, wie als dritte die Gräfin hinaufgeführt wird, sieht, wie man ihr, beim Versuch den schlanken Hals freizulegen, die Haube entreißt, wie man sie, da diese mit einer Nadel im Haar befestigt, an ihren Haaren zieht und sich der Schmerz auf ihrem Gesicht widerspiegelt, er sieht, wie die Tochter, nachdem die Mutter beseitigt ist, an ihre Stelle tritt, er sieht den Strom hellroten Blutes, der aus Kopf und Hals hervorschießt – und ganz Auge, kann er gar nicht mehr anders als zuzuschauen, er sieht, wie das nächste Opfer hinaufgeführt wird und er schaut und schaut, bis er bemerkt, dass ihm kalt und frostig geworden ist. Zwanzig Minuten hat dieser Augenblick gedauert – und in diesen zwanzig Minuten hat sich die Szene zwölfmal wiederholt.
Dieser Blick des Priesters, der schaut und sich darüber vergisst, scheint mir wesentlich: hier, im Auge des Betrachters, liegt jener Zeitriss, um den es mir geht. Denn er, der einem anderen Menschen hat beistehen wollen mit seinem Blick, erlebt, dass dieser Blick sich selbst vergisst, dass er starr und kalt wird, dass der Ort der Betrachtung, so könnte man sagen, das Innere dieser empfindsame Seele verlässt, dass er fernbedient wird von dieser Maschine. Ganz Auge, wie eine Überwachungskamera, die sich nah und näher an das Objekt der Betrachtung heranzoomt, schaut er dem Tod jener Menschen zu, dessen bloße Vorstellung ihn vor ein paar Stunden in Panik versetzt hat – er sieht den Schmerz, den der Henker seinem Beichtkind mit der Haarnadel zufügt – aber all das erreicht ihn nicht wirklich. Es erreicht ihn als eine Unwirklichkeit, und sie besteht darin, dass Leben und Tod nur getrennt sind von einem kurzen, präzisen Schnitt, einem Lidschlag. Es gibt hier keinen Übergang, kein Sterben mehr. Und wie um sich davon zu überzeugen, dass es dennoch so ist, wird dieser Augenblick wiederholt, serialisiert. Das Nicht-mehr-Sehen-Können des Todes markiert den Übergang in die Unwirklichkeit. Der Tod wird zum Film, zu einer dünnen, unwirklichen Schicht. Womit die Guillotine, wie gesagt, strukturell den Filmschnitt vorwegnimmt. – Hitchcock, wenn Sie mir diesen kurzen Bogen gestatten, Hitchcock hat genau dies gewusst: denn in der berühmte Tötungsszenen in Psycho ist nicht zu sehen, wie das Messer in den Körper des Opfers eindringt, nein, die Gewalt dieses Mords schreibt sich dem Auge selbst ein, in hundert Schnitten, für eine Szene die kaum anderthalb Minuten dauert.
Sie sehen, wir sind mitten drin, in der Zweischneidigkeit unseres Themas, eben dort, wo wir an den Rand der Vernunft geraten – auf die gleiche Weise, wie unser Priester in seinen Stupor verfällt. Und damit kommen wir zum Zusammenhang von Todestechnologie und Rationalisierung. Die Guillotine führt uns dabei in jenes gedankliche Dunkel, das im Wort selbst steckt. Die ratio, das ist, wenn ich mein lateinisches Wörterbuch konsultiere, das »Geschäft«, es ist die »Methode«, die Art und Weise meines Vorgehens, und es ist schließlich die Vernunft selbst, und weil diese Vernunft das Geschäft der Zerlegung betreibt, haben wir es mit einer rationalisierten, in einzelne Portionen zerlegten, also: einer rationierten Vernunft zu tun, die schlimmstenfalls umschlagen, zu einer falschen Form der Rationalisierung werden kann. Wobei, am Ende dieser Skala, dieser zunehmend kopflos werdenden Vernunft jene Verwendung des Wortes steht, die sagt, dass man es etwas wegrationalisiert habe, wobei, und das ist bemerkenswert, sich bei dieser Form der Ratio feststellen lässt, dass es hier keine kleinen, aber auch keinen großen Köpfe mehr gibt, sondern nurmehr eine abstrakte, herrenlose Ratio: ein sozusagen herumvagabundierendes großes Messer, ein Rasenmäher.
Es ist diese Dunkelheit unserer Ratio, die mich dazu gebracht hat, mich mit der Guillotine, dieser anderen Seite der Vernunft auseinanderzusetzen. Vor allem kam es mir darauf an, der Konstellation zwischen den Apologeten und den Apokalyptikern, zwischen den Aufklärern und den Gegenaufklärern zu entkommen – und als eines zu begreifen, was eins ist. Hier liegt vielleicht eine der größten Naivitäten: als sei unsere Ratio ein Ding, das wir tatsächlich im Griff hätten – und als sei es nicht umgekehrt genau so, dass unsere Ratio auch uns im Griff hat.
Im übrigen gehört zu den Paradoxien unserer Geschichte, dass der Berufsstand des Henkers selbst der Ratio dieser Maschine zum Opfer gefallen ist. Es mag kurios klingen, gleichwohl können wir doch, am Beispiel der Guillotine und des Henkers, einen geradezu klassischen Rationalisierungsfall verfolgen. Denn anders als wir mutmaßen, war die Zeit der Revolution keineswegs die große Zeit der Henker, sondern ihr Untergang.
Im ancien règime hatte so gut wie jedes Nest seinen Henker. Diese Henker waren gepäppelt mit allerlei Privilegien, deren Ursprünge nicht mehr zu verfolgen sind und die wohl auf das ausgehende Mittelalter zurückgehen. Neben dem Recht, sich der toten Pferde zu bemächtigen, war das wichtigste die sogenannte havage. Das bedeutete, dass der Scharfrichter, ausgerüstet mit einem großen Sack, auf den Marktplatz gehen und von den feilgebotenen Waren soviel mitnehmen konnte, wie er tragen konnte. Um zu kennzeichnen, dass er sich bei einem bestimmten Händler schon bedient habe, malte er mit einem Stück Kreide ein Kreuz auf seine Schulter – ein Verfahren, das im Laufe des 18. Jahrhunderts, da man empfindsamer wurde, Unmut erregte. Das Kuriose an dieser großen, weitverstreuten Henkerschar war, dass sie an einer, wie man heute sagen würde, verdeckten Arbeitslosigkeit litten. So wenig hatten sie zu tun, dass sie, als die Revolutionäre ihrer bedurften, sich glaubwürdig wegen Untauglichkeit und Unerfahrenheit freistellen ließen. Was freilich nicht allzu arg war, ließ sich doch das Geschäft des Todes mit den Volontären und Ideologen genausogut und gar noch effizienter betreiben.
Das ist ein Punkt, an dem man innehalten könnte. Dass der Henker weniger effizient ist als die Maschine, dass die Guillotine das grause Geschäft präziser verrichtet, als die schwertführende Hand dies vermag, das ist eine Sache – eine ganz andere ist, wieso das ancien règime sich den Luxus einer riesigen, untätigen Henkerschar leisten konnte. Hier kommen wir zu einer Frage, die wesentlich ist. Offenbar fühlte sich niemand, bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, als erste Klagen über die Privilegien der Henker laut wurden, bemüßigt, darüber nachzudenken. Der Henker war da, das war alles. Und wahrscheinlich wäre niemand auf den Gedanken gekommen (denn das ist ein wahrhaft absurder Gedanke), seine mangelnde Effizienz zu beklagen.
Dass ein solcher Gedanke überhaupt aufkommt, verdankt sich der Maschine. Erst mit der Maschine ergibt ein Begriffe wie »Energie« wirklich Sinn, erst über ein solches Konzept wird es möglich, den Menschen als Wärmekraftmaschine zu denken. Das aber ist eine historische Kategorie, eine Kategorie, die man vor dem Hintergrund der Dampfmaschine lesen muss. Keine Sklavenhaltergesellschaft wäre auf einen solchen Gedanken gekommen. Und so wimmelt es in den Dokumenten der Revolutionstribunale von Hinweisen darauf, wie stolz man ist, dass das Maschinchen läuft wie geschmiert.
Sie sehen: wenn ich jetzt, was den Henker anbelangt, einen Terminus aus unserer zeitgenössischen Ökonomie einführe, wenn ich etwa von »Humankapital« oder gar von der Vernichtung von Humankapital spreche, gerate ich in ganz heftig ins Schlingern. Was, bitte, heißt hier Humankapital?
Kommen wir nun zu dem prominentesten Opfer der Guillotine, nähern wir uns also dem Bild des enthaupteten Königs. Stellen Sie sich den Zug vor, der Louis XVI zu Grabe trägt, auf dem Friedhof der Madeleine. Ein Gottesdienst findet nicht statt, stattdessen spielt ein Regiment Revolutionslieder. Der König liegt in einem offenen Sarg, sein Körper ist in eine weiße Spitzenweste, eine graue Seidenhose und graue Seidenstrümpfe gekleidet. Er hat weder Schuhe an noch jenen Hut, den er auf dem Weg zum Schafott trug, einen kleinen Dreispitz mit einer Kokarde daran. Den barhäuptigen Kopf hat man ihm zwischen seine Beine gebettet; die Augen sind offen. Und so, genau so beerdigt man ihn, man lässt den offenen Sarg in das Grab hinab und streut ungelöschten Kalk darüber.
Das ist schon ein merkwürdiges Bild, nicht wahr? Wenn man den philantropischen Motiven des Dr. Guillotin folgt, der dem Nationalkonvent seine Maschine ihrer Humanität wegen anpries, so wird das Bild noch merkwürdiger? Warum, so könnte man fragen, mussten die Revolutionäre die Kopflosigkeit ihres Souveräns so drastisch ausstellen? Vielleicht, so wäre zu mutmaßen, weil es ihnen angelegen war, zu demonstrieren, dass die Zeit seiner potence vorüber ist. Aber dann: Wieso erwiesen sie dem vom Rumpf getrennten Kopf nicht wenigstens die Ehre, die Augen zu schließen?
Sie sehen (und ahnen, warum ich Ihnen die Geschichte des Abbé Carrichon erzählt habe): in den toten, gläsernen Augen des Königs haben wir das Nachbild jenes Stupors, so als ob der Tote seinen Mördern und seinen Zeugen von diesem ihren Blick erzählen solle. Das ist wie ein Filmbild, das eingefroren wird: ein Bild, in dem der Betrachter sich selber erkennt, das ihm sichtbar macht, wofür ihm die Geschwindigkeit des Aktes, der schnelle und jähe Schnitt kein Gefühl gibt: dass dieser Tod wirklich geschehen ist. Die Guillotine vollzieht den Übergang von Leben und Tod in Real time.
Nun, wie auch immer das sein mag – und wir werden darauf noch zurückkommen – eins ist gewiss: in diesem Beerdigungsritual, zweifellos, wird die Rationalität der Maschine konterkariert. Hier nur die strahlend helle Lampe der Aufklärung leuchten zu lassen, ist nur eine unzulässige Überblendung jenes Schlagschattens. Über ein solches Bild kann man nicht einfach hinweggehen, da kommt man ins Stolpern. Hier offenbart sich die Rationalität in ihrer zweischneidigen Form, von der wir (wenn wir lediglich das Menschenrecht und die Aufklärung skandieren) nichts wissen wollen.
Gewiss ist es so, dass die Guillotine der herkömmlichen Enthauptung, der Hackerei gegenüber ein Fortschritt war, auf der anderen Seite ist es aber auch wahr, dass die Guillotine eben dadurch, dass sie das Geschäft so schnell zu besorgen wusste, die serielle Tötung inaugurierte.
Die Guillotine ist, wie ich schon erwähnt, eine serielle Maschine – was eine wesentliche Umdeutung des Todes mit sich bringt. Denn von an geht der Tod tatsächlich in Serie. Damit aber, in der Serialisierung dieses Vorgangs, wird der jeweilige, jemeinige Tod gleichfalls ausgelöscht. In diesem Sinn markiert der kopflose König den Tod auch der Souveränität. Dies führt uns zu einem weiteren Charakteristikum der Guillotine. Sie liefert uns den Prototypen jenes sehr viel komplexeren Automaten, welche uns die Moderne in der Folgezeit bereitstellt: eines Automaten, der keines Menschen mehr bedarf, sondern der für sich funktioniert. Eben diesen Aspekt haben die Philanthropen und Aufklärer sehr fein bemerkt: dass mit dieser Apparatur sich niemand mehr seine Hände besudelt durch den Tod eines andern. Womit die Ratio der Apparatur denjenigen, der ihre Inbetriebnahme anordnet, exkulpiert, soweit jedenfalls, als er nicht das Gefühl haben muss, sich selber die Hände schmutzig zu machen.
Das ist ein Leitmotiv unser Ratio: die Tat ohne Täter. Und vielleicht ist dies ein weiterer Grund dafür, dass man dem Körper des Königs jene letzte Ehre nicht erweist. Dort, wo der Täter schwindet, wird auch das Opfer unsichtbar. Oder genauer: es wird zum »Objekt«, zu einem Opfer-Darsteller. Wie beispielsweise unter der Herrschaft des Prokonsuls Joseph Lebon, der sich die Guillotine vor dem Schauspielhaus aufbauen ließ, um dort vom Balkon herab seinem theàtre rouge beizuwohnen oder gelegentlich, wenn ihm danach war, die sinistre Kulisse zu benutzen, um sich an einer Rede über das Vaterland zu berauschen.
Nun, das mag pervers sein, aber wenn dies so ist, so fällt dieser Schatten auch auf eine ganze Reihe uns überaus vertrauter, ja hochgeschätzter Denkfiguren. Die Tat ohne Täter, das gehört zum Bild ohne Bildner, und dies zum Blick der Kamera, die sich eben dadurch auszeichnet, dass sie unbestechlich ist: objektiv. Auch der Verweis auf eine wie auch immer geartete Objektivität führt ein Messer bei sich, nur dass dieses Messer, ganz wie es der Herr Doktor versprochen hat, uns den Kopf abschlägt und wir leiden gar nicht dabei. – Nun will ich diesen Strang nicht weiter verfolgen, sondern nur darauf hinweisen, dass im Verschwinden von Täter & Opfer ein Leitmotiv anklingt, dessen Kataklysmen weit in unsere Zeit fortreichen. Ja, ich würde sogar soweit gehen, im Bild des enthaupteten Königs ein neues Menschenbild zu orten, das moderne Dividuum.
An dieser Stelle – um nicht in einem vagen, theoretischen Irgendwo mich zu verlieren – möchte ich ihnen zweite Geschichte erzählen, die weit ins 18. Jahrhundert zurückreicht. Diese Geschichte scheint mit der Revolution wenig zu tun zu haben, sie reicht eher dorthin, wo die Geschichte der Empfindsamkeit ihren Anfang nimmt. Also: es ist das Jahr 1746, ein großes, leeres Feld (das ich mir vorstelle, wie einer jener Kriegsfriedhöfe in der Normandie, nur ohne die Kreuze). Es ist früher Morgen – und da steht ein Abt und weist siebenhundert Kartäusermönche an, in einem Kreis Aufstellung zu nehmen. Der Kreis ist riesengroß, ein paar hundert Meter im Durchmesser – aber die Mönche können einander noch sehen. Dann beginnen die Mönche, schweigend wie es ihre Ordensregel gebietet, einander mit Eisendraht zu verdrahten. Als dies geschehen ist, berührt der Abt ein Behältnis – es ist innen und außen mit Stanniol umwickelt und mit Wasser gefüllt. Ein kleiner Draht führt ins Innere, der ausschaut wie eine kleine selbstgebastelte Antenne. Und in diesem Augenblick, da der Abt dieses Behältnis berührt, passiert etwas Merkwürdiges, etwas, das den Namen Zeitriss verdient. Denn die siebenhundert Kartäusermönche beginnen zu zucken, gleichzeitig.
Tatsächlich ist dieser Akt kein obskurer Ritus, sondern eine hochwissenschaftliche Versuchsanordnung, bei der es darum geht, herauszufinden, wie schnell die Elektrizität läuft. Das ist die Frage. Und die Antwort ist klar. Die Elektrizität ist so schnell, dass man sie mit dem bloßen Auge nicht wahrnehmen kann, es gibt hier keinen Zeitfluss mehr.
Aber diese Versuchsanordnung ist mehr noch, sie ist nichts weniger als das Phantasma der Moderne. Wir haben hier den Mann in der Menge, und wir haben die Idee (oder besser: das Phantasma) von dem, was heute Öffentlichkeit heißt, wir haben den Fluss von Energie, das Massenmedium Elektrizität. Wir haben das Urbild von dem, was man die Ästhetik des Schocks nennen kann. Wir haben schließlich die Sensation der Gleichschaltung durch den Raum und die Zeit: das, was wir Aktualität nennen und was man als die »Entfernung der Ferne« bezeichnen kann: Jetzt gerade, live in New York.... Hier liegt das Urbild der modernen Gesellschaft, das, was im 19. Jahrhundert dann Nation oder Publikum heißen wird – und heute, im ausgenüchterten Sinn: Kommunikation, Mitgliedschaft. Die Empfindung, im gleichen Kreislauf zu stecken. Das ist es, was sich den Mönchen vermittelt (und was keiner Zeit zuvor sich so intensiv vermittelt hat): Gleichschaltung, die Gewissheit, einen kollektiven Körper zu bilden.
Von nun an hängt die Gesellschaft im Netz, sie steht unter Strom. Und vielleicht sind König und Henker an diesem Tag im Jahr 1746, lange vor den Wirren der Revolution, schon gestorben. Denn sie sind in einer Welt, wo einer im anderen steckt und alle miteinander an der Batterie der Masse hängen, notwendig Fremdkörper. Und vielleicht ist es das, was die französischen Revolutionäre in Wahrheit feierten, als die das Fest des Höchsten Wesens inaugurierten: nicht den Menschen, sondern die Batterie, die ihm die Empfindung verleiht, einer im andern zu sein. Liberté. Egalité. Fraternité. Wie auch immer sein mag. Es ist in diesem Zusammenhang, wo einer im anderen steckt, ziemlich sinnlos, ein geschichtsmächtiges, autonomes Subjekt in Anschlag zu bringen.
Wenn ich vorhin das Bild des enthaupteten Königs herbeizitiert habe, so ist damit nicht ein gewisser Monsieur aus dem Haus der Capetinger gemeint, sondern der König, den wir lesen müssen als den Repräsentanten eines Kollektivkörpers. Der König, so sagt Mirabeau treffend, ist das Idol eines Gemeinwesens – das heißt: an ihm haftet das Bild, das sich eine Gesellschaft über sich selbst macht, was ja der eigentliche Sinn jener berühmten Bemerkung ist, die der Großvater dieses Königs geäußert hat: L’État, c’est moi.
Wenn es eine Lektüre gibt, die ich hier wachrufen möchte, so die von Ernst Kantorowizc The King’s Two Bodies, wo man lesen kann, wie das Mittelalter, über die Konstruktion jenes phantasmatischen Leibes, und über die Einbeziehung christologischer Gedankengänge, zu jener Form gelangt ist, wie sie im Hobbes’schen Leviathan ausgedrückt ist. In diesem Register geht es nicht um den einen oder andern, um diesen oder jenen Privatmenschen, sondern es geht um die Verfasstheit einer Gemeinschaft, die sich selbst in einem künstlichen Leib ausgedrückt sieht, dessen Träger der König lediglich ist. Dieser Leib ist keineswegs der Willkür irgendeines Sonnenkönigs unterworfen, sondern es ist streng gegliedert, er spricht die Sprache seiner Zeit, die man die Sprache der Repräsentation nennen kann.
Diese Sprache, die man ziemlich präzise ansetzen kann mit dem Ende des Mittelalters, mit der Geburt des neuzeitlichen Gesichtes, unseres Idols mithin, erfährt im Bild des enthaupteten Königs eine grundlegende Erschütterung. Ja, man kann den Fortschritt der Moderne als eine fortschreitende Erschütterung lesen, mehr noch, man kann die Frage stellen, ob die Revolution überhaupt aufgehört hat, oder ob wir es vielmehr mit den Nachwirkungen dieses Zeitrisses zu tun haben. Die Augen des Königs sind offen, und sie starren in eine Welt ohne Tat und ohne Täter, in eine Welt, in der die Taten keine Ähnlichkeit mehr haben mit denen, die sie begehen. Was, wenn sie eine Formel dafür prägen wollen, nichts anderes bedeutet, dass nicht ICH es mehr bin, der tut, sondern ES.
Nehmen wir das Jahr 1968 beispielsweise. Wenn wir 1968 hören, erinnern wir uns an die Parolen unserer altgewordenen Revolutionäre, die freilich nicht so gern daran erinnert werden, und so preisen wir – rücksichtsvoll – die Revolution der Lebensformen. Den Mond, die Antibabypille, die sexuelle Revolution, anything goes. 1968, das heißt vor allem, ES ist passiert. Mit einem großgeschriebenen ES. Nun ist es interessant, dass das Jahr 1968 nicht nur auf der Straße stattgefunden hat – das Jahr 1968 kennt zwei weitere Revolutionen, nur dass wir diese selten oder gar nicht zueinander in Beziehung bringen.
Die erste Revolution, deren Nachbeben uns tagtäglich erreicht, ist mit dem Ort Bretton Woods verknüpft. In Bretton Woods löste man sich von der – längst nicht mehr haltbaren – Vorstellung des Goldstandards, man ging über zu dem, was man free floating nennt, das heißt: der Vorstellung, dass die Wechselkurse zueinander in ein flüssiges Verhältnis kommen. Genaugenommen ist das Moment der Verflüssigung (das Sie auch übersetzen können als Liquidation) noch viel weitergehender. Hatte das Geld, die Assignaten, zuvor als Repräsentant eines materiellen Wertes (also des Goldes) gegolten, ist es von nun an nichts mehr als Zeichen, ein Zeichen, von dem man hofft, dass es durch andere Zeichensysteme in Schach gehalten und kontrolliert werden kann. Aber wie auch immer der Weg dieses neuen Geldes sein mag – es läuft auf das Dilemma des digitalen Geldes hinaus.
Kommen wir zu der zweiten Revolution, die gleichfalls im Stillen abgelaufen ist. Das ist die in der Medizin vorgelegte Definition des Todes, die besagt, dass der Tod dann eintritt, wenn das Gehirn seine Funktion eingestellt hat. Also: der Hirntod. Die Mediziner sind dabei vorgegangen wie die französischen Revolutionäre: sie haben Kopf und Rumpf voneinander getrennt, mit dem Ziel, den Leib des Menschen als Ersatzteillager für andere Leiber zu konservieren. Sie sehen, die Kopflosigkeit ist also eine Bedingung dafür, den Körper in den Dienst zu nehmen.
Vielleicht – jedenfalls hoffe ich dies – wird der Bezug zum Bild des enthaupteten Königs deutlicher. In gewisser Hinsicht, nur in einem viel größeren Maßstab, wiederholt sich hier, was in dem Bildnis des kopflosen Königs beschlossen ist. Die Art, wie man den Körper des Königs zu Grabe getragen hat, ist ein präziser Vorschein auf jene Revolution, die gar nicht aufgehört hat – und die nunmehr die Massen erfaßt hat. Hat die serielle Maschine den Kopf des Königs gefordert, so läßt sie nun auch unsere Köpfe rollen.
Sie sehen, ich nehme die Grablegung des Königs als ein Symptom für eine gegenwärtige Verfasstheit. Denn die drei Revolutionen, die ich eben in einen Zusammenhang gebracht habe – die Revolution der Lebensform, die Revolution des Geldes und die Revolution der medizinischen Kartographie – lassen sich als Umcodierung des Körpers verstehen. Da haben wir die Umcodierung des politischen Körpers (das ist die Revolution der Straße), eine Umcodierung des ökonomischen Körpers (das ist das Geld) und eine Umcodierung des materiellen Körpers (das ist der Hirntod).
Ihnen gemeinsan ist eine Verflüssigung und Ablösung vom materiellen Körper. Bretton Woods löst sich vom Gold, die Definition des Hirntods löst sich von der Integrität des Körpers, und das free floating der Straße, das sich politisch gerierte, zeigt sich, fast dreißig Jahre danach, als eine Aufweichung der Lebensformen. – Man könnte sagen, alles ist Software geworden, digital. Wenn sie aber einen Körper digitalisiert haben, können sie ihn nach Belieben kopieren, ist er nicht mehr einer, sondern ein Clon, ein Hybrid, inflationär. – Vor diesem Sinn ist das Ende der Repräsentation (die ja vom Einen und seinem Double spricht) kein Schlagwort, sondern eine Wirklichkeit.
Vielleicht wird an dieser Stelle plausibel, was die Geschichte und der Zeitriss der Guillotine mit unserer Gegenwart zu tun hat. – Der kopflose Körper des Königs, dessen Kopf zwischen den Beinen aufgebahrt liegt, zum Zeichen der Impotenz, seine glasigen offenen Augen, die ins Nichts hineinstarren, in eine Welt ohne Täter und Opfer – all das annonciert uns ein Zeitalter, in dem der eine und unversehrte Mensch nicht mehr der Träger unserer Wahrheit sein kann. Dieser Eine im offenen Sarg (und das ist die untergründige Botschaft des Bildes) vermag die anderen nicht mehr zu repräsentieren.
Das Fallbeil der Guillotine, das dort in der französischen Revolution herabgesaust ist, führt uns in jene Welt, die sich im Bild der zuckenden Mönche angekündigt hat: in die Welt des Dividuums, der seriellen Existenz, oder, wie ich das moderne Massenwesen gern nennen möchte, in jene Welt, wo einer im andern steckt. Es ist, wie man auch sagen könnte, die telematische Welt, eine Welt, in der wir mit glasigem Blick uns in Räume fortträumen, die in unserer wirklichen Welt immer problematischer werden.
Es ist dieses Ende der Repräsentation, was ich im Auge hatte, als ich zu Anfang vom Stolpern in die Moderne sprach – und es ist dieses Ende, über das der Fortschritt einfach hinweggegangen ist, so als ginge es nur darum, die Macht des Königs auf die Masse zu verteilen. Dies aber erweist sich als illusionär, in dem Maße vielleicht, in dem die Macht wirklich an die Masse übergegangen ist – so dass man, rückblickend, sagen könnte, dass nur das Ausgeschlossen-Sein von dieser illusionären Macht ihren Fortbestand garantiert hat. Dort hingegen, wo man der Akklamation der Masse nicht bedarf, in der Kunst und im Denken, dort ist das Denken der Repräsentation schon lange erledigt.
Nun will ich nicht den Anschein erwecken, als ob die Guillotine so etwas wie einen historischen Sündenfall dargestellt hätte. Sehr viel wahrscheinlicher scheint mir – das jedenfalls ist meine Hypothese -, dass der Tod des Königs nur das Symptom jener anderen Krise ist, die das Subjekt in der Mitte des 18. Jahrhunderts erfasst hat – und die darin besteht, das der Eine, der an die Batterie der Masse angeschlossen worden ist, nurmehr Einer-im-andern sein kann. Hier, im Bild der zuckenden Mönche, liegt für mich der wahre Anfang der Moderne, die eigentliche Revolution und jener Zeitriss, den es ins Denken aufzuheben gilt.
Dieses Bild der zuckenden Mönche, das ich als den Zustand des Einer-im-andern bezeichnet habe, bedeutet jedoch eine Umcodierung unseres Denkens, die noch keineswegs abgeschlossen ist. Nehmen Sie die wesentliche Säule unseres Rechtssystems: das autonome Subjekt. Dieses Subjekt ist natürlich nichts anderes als ein kleiner König – der in einem gesellschaftlichen Subsystem Herrschaft hält. Dieser Subjektbegriff jedoch unterstellt, dass es einen Täter gibt, einen Urheber (und nicht von ungefähr ist der Künstler, das Genie der heimliche Held der Moderne – wobei genau dies uns zum Nachdenken bringen sollte: denn der Künstler ist ein König ohne Reich, und selbst wird dies ihm, da jeder ein Künstler zu sein prätendiert, streitig gemacht).
Die Frage ist also: gibt es den Urheber noch? Betrachtet man die großen Katastrophen dieses Jahrhunderts, vor allem aber ihre juristische Aufarbeitung, so wird sichtbar, dass dieses Subjekt sich längst aus der Weltgeschichte verabschiedet hat. Vielleicht sind die großen Totalitarismen dieses Jahrhunderts, die vom Phantasma gelebt haben, dass da einer im andern aufgehen möge, im einen und immerwährenden Volkskörper – während man sich in Wahrheit daran machte, das Andere aus dem Kreis der konvulsivisch zuckenden Mönche auszuschalten – vielleicht sind die Totalitarismen nichts anderes als ein gigantischer Versuch, ein Einheitsbild zu erzwingen, ein gigantisches, überlebensgroßes ICH zu errichten. Bezeichnenderweise verschwindet diese Einheit sogleich, sobald die Batterie der Masse ihren Dienst aufgegeben hat. Da häufen sich Berge von Leichen, Unrecht auf Unrecht, aber die Täter (die zu kleinen harmlosen Würstchen zusammengeschrumpft sind) beharren darauf, Opfer zu sein. Nicht ICH SPRECHE, ist ihre Losung, sondern ES (oder wie unsere Altvorderen gesagt: Nicht wir sind’s, Adolf Hitler ist es gewesen). Dabei mag ES mag, was es will: das Geld, die Wissenschaft unseres Körpers oder die Umstände, also der Weltgeist. Was immer es ist: es läuft aufs System hinaus. Womit ich wieder beim Jahr 1968 angelangt bin: bei Bretton Woods, der Kartographie des Körpers und jenem Jahr, da ES passierte.
Die Revolution hat nicht aufgehört. Und sie wird nicht aufhören, solange man ES sagt und sich nicht die Mühe macht, sich dieses ES auf den eigenen Leib zu schreiben, was ja die Bedingung dafür ist, verantwortlich ICH sagen zu können. Dieses großgeschriebene ES bedeutet: eine Ratio, die keinen Träger mehr hat, eine Ratio, die einem so weit über den eigenen Kopf gewachsen ist, dass man sich ihr freiwillig unterwirft – nur um nicht über ihre Gesetzmäßigkeit nachdenken zu müssen. Dieses ES hat die Struktur der Guillotine. Die anonyme, namenlose Maschine.
Ob es der Markt ist, der sich den Turbulenzen des Geldes überantwortet, ob es die wissenschaftliche Ratio ist, die, sozusagen im Blindflug, dem Machbaren folgt, ob es schlussendlich die Individuen sind, die bereitwillig der Mehrheit folgen, nur weil sie die Mehrheit ist – all dies besagt nur, dass Entscheidungen gefällt werden, ohne dass jemand bereit wäre, den Ort der Rede und der Verantwortung einzunehmen. ES – das ist die Hoffnung, dass es ein anderer macht und dass es einem anderen passiert. Freilich: dieses ES ist eine Fiktion. Denn niemals hat ES wirklich gehandelt, immer war es ein Mensch. Und so heißt die Formel auf der Seite der Täter: Wenn ich es nicht mache, wird es ein anderer machen. Denn ES wird passieren, so oder so.
Sie sehen: diese Form der Rationalität ist tatsächlich, in kleinen, aber auch in größeren Dosen, eine Form der Todestechnologie. Das empfindende Ich, als das entscheidende Organ, befindet sich hier auf dem Rückzug. Genauer: es entscheidet gegen sich selbst, wider besseres Wissen – womit sich die Guillotine in den Kopf hineingesetzt hat. In gewisser Hinsicht zelebriert sich hier, auf symbolische Weise und immer neu, der Tod des Königs, lassen wir das Fallbeil irgendeiner übermächtigen Instanz hinabsausen und geben uns, im Namen dieser oder jener Instanz, selber preis.
Vor diesem Hintergrund wird die Faszination, mit der wir den Tod im Fernsehen verfolgen, verständlich, wird verständlich, warum wir andererseits all die talking heads, die vertrauten Kommentatoren und Moderatoren brauchen. Sie, die wir wiedererkennen, machen uns vor, dass der Ort der Politischen nicht, wie man mutmaßen könnte, leer ist, sie machen uns vor, dass all das noch einen Sinn hat. Und die allermächtigste Botschaft ist vielleicht gar keine Botschaft mehr, sondern nur das vertraute, unveränderliche Gesicht. Die Hoffnung, dass es möglich sein könne, das Gesicht zu wahren. Seine Unversehrtheit. Mit diesen Gesichtern schirmen wir uns vor unserem beschädigten Narzissmus ab, der eigenen »Gesichtslosigkeit«, trösten wir uns darüber hinweg, dass auch unsere Augen auf diesen Schirm schauen, so wie der tote König aus seinem Grab herausgeschaut hat.
Nun will Ihnen durchaus keine Predigt halten, oder wenn: so ist, was ich predige, keine Rückkehr zum einen und unversehrten Individuum, sondern im Gegenteil, das Zur-Kenntnis-Nehmen seines Todes. Nur diese Kenntnisnahme ermöglicht uns, ins Auge zu fassen, was an seine Stelle getreten ist – den Multi, oder wie ich es nennen würde: das Dividuum. Also den, der sich mit-teilt (was ja der große Imperativ unserer Zeit ist: die Kommunikation, die Mitteilungsfähigkeit).
Nun befinden wir uns ziemlich genau in einer Epoche, wo das Problem des Körpers (oder wie ich sagen: das Problem der Repräsentation) nicht einmal vor jenen großen Megakörpern Halt macht, die das 19. Jahrhundert an die Stelle des Königs gesetzt hat. Auch die modernen Nationalstaaten erweisen sich als höchst fragile Gebilde, auch sie werden vom Fluss des Geldes affiziert und in Mitleidenschaft gezogen, so weit, dass sie, wie im Falle des illiquide gewordenen Ostblockes liquidiert werden müssen. Von jenem flüssig gewordenen, symbolischen Kapital aufgeweicht, das über den Globus strömt, beginnen die Körpergrenzen der alten, als autonom sich gerierenden Nationalstaaten zu verschwimmen, ja zeigt sich, dass das Geld und die Landkarten einiger Länder nicht einmal das Papier wert sind, auf dem sie gedruckt sind. In gewisser Hinsicht ist dies nichts als eine Spätfolge dessen ist, was in Bretton Woods sanktioniert worden ist, nämlich das free floating.
Nun, wenn Sie das bildlich nehmen und sich überlegen, was einem Körper widerfährt, den man allzu lange einer Flüssigkeit überantwortet – so ist klar, was passiert. Er wird schwammig, flockt aus, nimmt eine breiartige Konsistenz auf, bis er überhaupt aufhört, sich von seinem Milieu zu unterscheiden. Da gibt es nurmehr Spurenelemente, dissipative Strukturen, Ausflockungen.
Freilich geht es mir nicht darum, diesen Substanzverlust und diese Verwässerung zu beklagen. Tatsächlich bin ich davon überzeugt, dass dieser Prozess weit, weit zurückreicht, und dass er im wesentlichem identisch mit dem ist, was wir »Moderne« nennen. Nein, mir geht es vielmehr darum, dass wir uns jenen Zeitriss stellen, wie er im Tod des Königs beschlossen ist. Dieser Zeitriss wird in seiner ganzen zeitgenössischen Virulenz plausibel, wenn wir uns jener Frage stellen, welche die Revolution von 1968 eher verborgen hat – und die man so verschärfen könnte: Was ist ein Körper im Zeitalter seiner Simulation? Was ist unser leiblicher Körper, wenn er beliebig geclont, verwandelt und zusammengesetzt werden kann? Was ist Geld, wenn es nichts ist als Information? Was sind die Institutionen und gesellschaftlichen Vermittlungsinstanzen, die sich für die Währung verbürgen können? Was, schließlich, sind wir selbst, wenn wir nicht mehr einer sind, sondern dividuell, Akteure also, die von Szene zu Szene ihre Rolle wechseln? Wer ist dieser, der nicht mehr Einer ist und unteilbar, sondern Einer-im-andern. Also: der das Recht für sich reklamiert, nicht derselbe, sondern ein anderer, eine Ephemeride zu sein...
Nun will ich mich, um zu einem guten Ende zu kommen, gar nicht anschicken, auch nur den Versuch einer solchen Antwort zu wagen. Ich will mich lediglich mit dem Hinweis begnügen, dass ein Großteil der Fragen, die wir uns heutzutage stellen (über die Rolle der Arbeit, über den Nationalstaat, über die transnationalen Gebilde, über Genetik und Ethik undsoweiter undsofort) im wesentlichen Ableitungen dieser einen Frage sind: Was ist ein Körper im Zeitalter seiner Simulation? – Eins der heißesten, dunkelsten Themen in diesem Feld perpetuiert das Dilemma des Königs, es ist die Frage nach demjenigen, der die Attribute des König geerbt hat, dem Künstler. Genauer: es ist die Frage nach dem Urheberrecht. Ein Thema, das uns nicht nur in die Höhen der Kunst, sondern in die Gefilde der Genetiker führt, die das Genom eines Lebewesens dechiffrieren und, unter Berufung auf das Urheberrecht, ein Patent darauf anmelden. Oder ins Imperium des Mr. Gates, der Raubzüge durch die Geschichte der Bilder unternimmt... oder in die Zukunft der Arbeit, die uns lehrt, dass eine jede Arbeit, die digitalisiert, die simuliert werden, schon im Museum der Arbeit steckt. – Nun, wie auch immer die Juristen entscheiden werden, sie werden sich nicht damit begnügen können, sich einfach auf das Rechtssubjekt herauszureden, diesen kopflosen Zwergenkönig, der da in einem jeden von uns hockt – und doch nichts ist als ein Phantomschmerz, bestenfalls.
Nein, die Frage wird lauten: Was ist ein Körper im Zeitalter seiner Simulation? Nicht mehr. Aber auch nicht weniger. Und das ist der Punkt. Denn man wird diese Frage in Zukunft – wenn man denn eine Zukunft erwartet – positiv stellen müssen. Um diese Frage aber positiv stellen zu können, müssen wir zunächst einmal damit aufhören, uns selbst als Königskinder aufzuführen... gilt es zu sagen: Der König ist tot, es lebe die Zukunft...
Ich danke Ihnen.