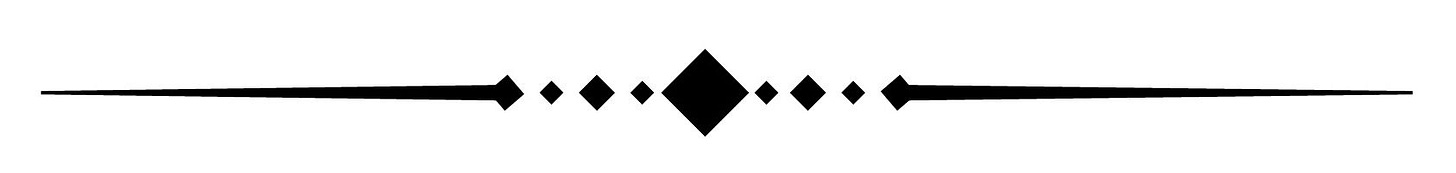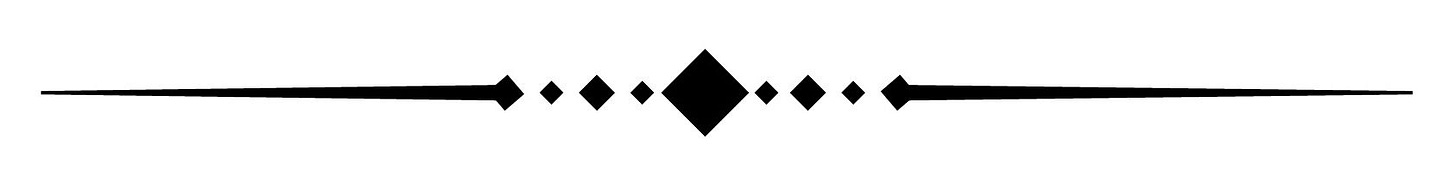Wenn man beim Nachdenken über die Fatalitäten der heutigen Culture Wars, der Ein- und Übergriffe selbsternannter Sprachpolizisten zumal, sich an George Orwell erinnert, an seine Logik von Oldspeak und Newspeak, Gedankenverbrechen und das Ministerium der Wahrheit, so ist das kein Zufall. Denn Orwell hat, wie kaum ein anderer vor ihm, die Abgründe des totalitären Denkens erfasst, nicht zuletzt deswegen, weil er jener seltenen Spezies von Autoren angehört, die unabhängig von der politischen Wetterlage dem Begriff der Wahrheit ebenso wie dem Begriff der Freiheit eine primordiale Bedeutung zuspricht. Folglich behauptet er in wunderbarer Schnörkellosigkeit:
Wenn Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann ist es das Recht, den Menschen zu sagen, was sie nicht hören wollen.1
Nun ist der Weg, der Orwell zum großen Verteidiger bürgerlicher Freiheiten hat werden lassen, insoweit ungewöhnlich, als er sich seiner Wandlung zum politischen Schriftsteller, ja seinem politischen Aktivismus verdankte. Weil er den Faschismus bekämpfen wollte, ging der junge Eric Blair (das war Orwells ungeliebter bürgerlicher Name) Ende 1936 nach Spanien und schloss sich der P.O.U.M. an (Partido Obrero de Unificación Marxista), einer marxistischen Splittergruppe, welche die reaktionären Putschisten Francos bekämpfte.
War er als Zeitzeuge zunächst fasziniert von der sozialistischen Aufbruchstimmung, hin zu einer klassenlosen Gesellschaft, begriff er sehr bald, dass die Hauptgefahr weniger von den Truppen Francos ausging, als vielmehr von den stalinistischen geprägten Republikanern, welche die trotzkistischen Abweichler nicht als Verbündete begriffen, sondern als Todfeinde, denen man entsprechend begegnen musste. Folglich musste Orwell gewahren, dass seine Kampf- und Weggefährten in Gefängnissen verschwanden, über Folter zu falschen Geständnissen genötigt oder kurzerhand umgebracht wurden – und dass auch sein eigenes Leben und das seiner Frau gefährdet war. Was ihn, nach England zurückgekehrt, jedoch am allermeisten frappierte, war der Umstand, dass auch die Intellektuellen, welche die Geschehnisse nur von der Galerie aus beobachtet hatten, sich ein Bild von der Welt zurechtgelegt hatten, welches mit der Wirklichkeit nichts zu hatte, aber alles mit der Parteinahme für diese oder jene Gruppierung. Und dies führte Orwell zu der bitteren Einsicht, dass die ideologische Verzerrung nichts anderes als eine Verblendung darstellt:
Aber was mich damals beeindruckt hat und seitdem beeindruckt, ist, dass Gräueltaten allein aufgrund politischer Vorlieben geglaubt oder nicht geglaubt werden. Jeder ist von den Grausamkeiten des Gegners überzeugt und leugnet die der eigenen Seite, ohne sich je die Mühe zu machen, die Beweise zu prüfen.2
Wenn man den Bericht von großen Schlachten liest, »wo es keine Kämpfe gab, und völlige Stille, wo Hunderte von Männern getötet worden waren«, ist evident, dass jene psychopathologische Störung, wie sie Leon Festingers Konzept der ›kognitiven Dissonanz‹ nahelegt, eine Untertreibung sondergleichen ist. Worauf Orwell insistiert, ist, dass man in dem Augenblick, wo man die Möglichkeit aufgibt, dass es soetwas wie eine Wahrheit gibt, sich einer kollektiven Schizophrenie ergibt, dem, was er in seinem dystopischen 1984-Roman später groupthink genannt hat.
Vor genau diesem Hintergrund ist ein kleiner Essay zu lesen, den Orwell im Jahr 1945 für die Zeitschrift Polemic geschrieben hat. Erwartet man von einem Essay, der Anmerkungen zum Nationalismus betitelt ist, eine jener allfälligen Auseinandersetzungen, die den Nationalismus vom Chauvinismus und vom Patriotismus gleichermaßen abgrenzen, stellt sich schon bei den ersten Zeilen eine große Überraschung ein. Denn Orwell weist auf den Fall des George Byron hin, der gewahren musste, dass die englische Sprache zwar kein Wort für das französische longueur besitzt, das Gemeinte jedoch in Hülle und Fülle kennt. Folglich schreibt Orwell, dass das Wort Nationalismus nur ein Platzhalter ist, denn:
wie wir gleich sehen werden, verwende ich es [das Wort] nicht im gewöhnlichen Sinne, und sei es nur deshalb, weil die Emotion, von der ich spreche, nicht immer an das gebunden ist, was man eine Nation nennt, d. h. eine einzelne Ethnie oder ein geographisches Gebiet. Ebensogut kann sie sich an eine Kirche oder eine Klasse binden, oder sie kann in einem rein negativen Sinne wirken, gegen irgendetwas oder irgendjemanden und ohne die Notwendigkeit eines positiven Objekts der Loyalität.3
Nimmt man diese weite Definition, so handelt es sich bei dem, wofür das Platzhalter-Wort »Nationalismus« stehen soll, um eine Form der Zugehörigkeit, ja, der Gemeindebildung, bei der Menschen sich in einen kollektiven Gruppen- und Bedeutungszusammenhang einordnen. Intuitiv erfasst Orwell damit eine Absonderlichkeit, die Historiker wie Eric Hobsbawm in eine Deutungsverlegenheit sondergleichen geworfen hat. Denn der Nationalismus ist, seiner natalistischen Bezüge zum Trotz, kein Immer-schon-Dagewesenes, sondern eine Erfindung der Moderne, und diese Erfindung hat sich erst in der Epoche der Flugblätter, der optischen Telegraphie und der Massenmobilisierung eingestellt. Folglich spricht Benedict Anderson, der dieser Erfindung eine erhellende Studie gewidmet hat, von imagined communities, Gemeinschaften mithin, die sich aufgrund einer kollektivierten Einbildungskraft herausgebildet haben. Wenn man der Meinung ist, dass man als Deutscher, Franzose oder Engländer einen angeborenen Nationalcharakter besitzt, so ist dies eine Behauptung, die nichts weiter ist als ein modernes Mythologem, und diesem ist nur deswegen ein solcher Erfolg beschieden, weil sich die fraglichen Gesellschaften einem Gründungsmythos, kurzum einer Geschichtsklitterung hingegeben haben. Wenn ich demgegenüber im Bild der elektrisierten Mönche des Abbé Nollet das Urbild der modernen Massengesellschaft situiert habe, so besagt dies, dass das eigentliche Triebwerk der Moderne die telematische Masseformation ist. Dass die Nation über lange Zeit als die institutionelle Entsprechung jenes neuen Gesellschaftstyps hat erscheinen können, beschreibt eine ideologische Überblendung, deren große Zeit, wie deutlich zu sehen, vorüber ist. Denn seit mehr als fünf Dekaden lässt sich beobachten, dass die Gesellschaft sich immer mehr in Richtung einer Weltgesellschaft bewegt (was die Kantische Bemerkung bestätigt, dass die Geschichte in weltbürgerlicher Absicht voranschreitet). In diesem Sinne geht mit dem Nationalismus ein Verkennen des tatsächlichen Gesellschaftstriebwerks einher, könnte man ihn als eine Art Phantomlust begreifen, welche über einen Phantomschmerz, das tiefe Unbehagen in der Moderne, hinweghelfen soll. Psychologisch betrachtet wird ein individuelles Leeregefühl durch einen Zugehörigkeitswunsch ersetzt, etwas, was man im Wortsinn und in seiner Vergeblichkeit als Identitätspolitik begreifen könnte. Nun ist die Nation keineswegs das zwangsläufige Objekt dieses obskuren Begehrens, ebenso gut kann es sich als Zugehörigkeitswunsch zu einer Klasse, einer Ideologie oder einen Glaubensgemeinschaft artikulieren. Demgemäß begreift Orwell den Nationalismus nicht als ein erworbenes Selbstbewusstsein, sondern als eine Störung, ja, als eine Form der kollektiven Psychopathologie. In diesem Sinn geht es hier stets um eine narzisstische Selbstermächtigung – und diese geht fast immer auf Kosten eines anderen, den man entsprechend herabwürdigen muss.
Der eigentliche Kunstgriff Orwells aber besteht darin, dass er den Nationalismus (der ein Platzhalterwort für einen identitätspolitischen Zugehörigkeitswunsch ist) in drei Erscheinungsformen aufspaltet. So spricht er von einem positiven, einem negativen und einem übertragenen Nationalismus. Der positive Nationalismus ist, was uns als solches hinlänglich bekannt ist – jener übertriebene Nationalstolz, der selbst den bescheidensten Schuhmacher erfüllt, wenn er sich als Angehöriger einer Kulturnation, als Nachfahre von Goethe, Schiller & Co geriert – etwas, was ihn selbst dann noch mit einem Überlegenheitsgefühl erfüllt, wenn er keine einzige Zeile seiner Kulturheroen gelesen haben sollte. Tatsächlich sieht Orwell in diesem Selbstvergrößerungsimpuls die eigentliche Triebkraft. »Der Nationalismus«, schreibt Orwell, »ist untrennbar mit dem Streben nach Macht verbunden.
Das Ziel eines jeden Nationalisten ist es, mehr Macht und Ansehen zu erlangen, und zwar nicht für sich selbst, sondern für die Nation oder eine andere Einheit, in der er seine eigene Individualität versenken will.4
Orwells Hinweis, dass es bei alledem um Macht, Prestige und Einfluss geht, ist insoweit hoch bedeutsam, als dieser Drang das Entrée für jene anderen Erscheinungsformen ist, die er als „negativen“ oder „übertragenen“ Nationalismus bezeichnet. Folglich kann auch der negative Nationalismus mit einer Form des Prestigegewinns verbunden sein. Wenn ein Politiker vom Schlage eines Jürgen Trittin in der „Leitkultur“-Debatte behauptete, die Forderung, dass jemand, der die deutsche Staatsbürgerschaft anstrebe, eine gewisse Sprachkompetenz aufweisen müsse, stelle eine Zwangsgermanisierung dar, so ist dies nichts anderes als eine Form der moralischen Selbstüberhebung – eine identitätspolitische Überlegenheitsgeste, die Orwell als eine Form des negativen Nationalismus aufgefasst hätte. Und weil dies, wie unsere Kulturstaatsministerin Claudia Roth vorgeführt hat, als sie sich zu den Rufen Deutschland, du mieses Stück Scheiße! in eine Demonstration sich einreihte, eine Form der Gruppenbildung darstellt (»die Reihen fest geschlossen«), sieht man sich hier dem spiegelverkehrten Abbild des Nationalismus gegenüber. In jedem Fall ist die demonstrative Abkehr von der eigenen Nation ihrerseits mit einem Macht- und Prestigeanspruch verbunden, und weil dem so ist, mag auch der negative Nationalismus als Gesellschaftsklebstoff wirken. Wenn der britische Philosoph Roger Scruton dieses Sentiment mit dem Begriff der Oikophobie zu fassen versucht hat (worunter er die Angst vor dem Eigenen verstand, die sich zu Abscheu steigern mag), so kommt das Konstitutive des negativen Nationalismus zu kurz - der Umstand mithin, dass auch die Verneinung der eigenen Herkunft zur Gruppenbildung beitragen kann. Von hier aus ist es nur ein kurzer Schritt zu jener dritten Erscheinungsform, die Orwell als übertragenen Nationalismus bezeichnet. In diesem Fall werden die Eigenschaften, die man in der eigenen Kultur schmerzlich vermisst, auf irgendeine andere, „exotische“ oder sonstwie herausragende Weltgegend übertragen. So mag man den australischen Aborigines jene tiefere Weltweisheit zuschreiben, welche der eigenen Kultur fehlt – wird der Exotismus zur Sehnsuchtsfigur.
Wenn der „übertragene“ Nationalismus, als Projektionszusammenhang, nach einem psychoanalytischen Blick verlangt, so ist Orwell durchaus nicht verlegen, den Nationalismus insgesamt mit dem weiten Register der Psychopathologien zu verknüpfen.
Die Zusammenhänge zwischen Sadismus, Masochismus, Erfolgsanbetung, Machtanbetung, Nationalismus und Totalitarismus sind ein riesiges Thema, dessen Ränder kaum angekratzt wurden, und selbst die Erwähnung dieses Themas wird als etwas indifferent angesehen.... Faschismus wird oft locker mit Sadismus gleichgesetzt, aber fast immer von Leuten, die in der sklavischen Verehrung Stalins nichts Falsches sehen. Die Wahrheit ist natürlich, dass die zahllosen englischen Intellektuellen, die Stalin den Arsch küssen, sich nicht von der Minderheit unterscheiden, die Hitler oder Mussolini die Treue hält, und auch nicht von den Effizienzexperten, die in den zwanziger Jahren „Punch“, „Drive“, „Persönlichkeit“ und „learn to be a Tiger man“ predigten, und auch nicht von der älteren Generation der Intellektuellen, Carlyle, Creasy und den anderen, die sich vor dem deutschen Militarismus verneigten. Sie alle huldigen der Macht und der erfolgreichen Grausamkeit. Es ist wichtig zu bemerken, dass der Kult der Macht dazu neigt, sich mit einer Liebe zur Grausamkeit und Bosheit um ihrer selbst willen zu vermischen.5
Überträgt man die Orwell’schen Einsichten auf die heutigen Verhältnisse, entpuppen sich viele der heutigen Ideologien als geistige Abkömmlinge dessen, wofür ehedem der Nationalismus stand. Der aggressive Internationalismus, der seine Legitimation aus der vermeintlichen Überwindung nationalstaatlicher Begrenztheit bezieht, der Tiermondismus, der sich in ein postkoloniales Büßergewand gehüllt hat und die eigene Superiorität durch Flagellations-Performances beglaubigt, lassen sich beide als Spielarten des negativen und übertragenen Nationalismus auffassen. Nicht zufällig stellen sie ihren Adepten Codes und Erkennungszeichen bereit, welche die eigenen Machtgelüste befriedigen: und nicht zufällig kann man, mit dieser Ideologie ausgerüstet, auf eine ansehnliche Karriere im heutigen Politikbetrieb hoffen. In diesem Sinn sind die Totalitarismen des 20. Jahrhunderts keineswegs Geschichte, besteht die Gefahr, dass sie in identitätspolitischer Form wiederauferstehen. Genau hier liegt der große Vorzug des Orwell’schen Platzhalterwortes, denn es erfasst, besser als jede Form der Massenpsychologie, die phantasmatische Struktur der Identitätspolitik. Der größte Vorzug dieses Gedankenkostüms aber besteht darin, dass man damit den Blick auf das eigentlich wirksame Gesellschaftstriebwerk verstellt, jene telematische Logik, welche nicht nur das 18. Jahrhundert, sondern die ganze Gesellschaft unter Strom gesetzt hat. Wenn man mit Marshall McLuhan davon spricht, dass mit der Elektrifizierung die Welt zu einem Dorf wird, übersieht man leicht, dass die Formel des global village auch einen gegenläufigen Effekt haben kann, nämlich, dass sich das Dorf (mit all seiner Engstirnigkeit und seinem Provinzialismus) zur Welt aufschwingen kann. Genau diese Selbstermächtigungslogik ist der eigentliche Drive des ›Nationalismus‹ - und er ist der absolute Gegensatz dessen, was Kant im Sinn hatte. als er von einer Geschichte in weltbürgerlicher Absicht gesprochen hat. Man treibt Identitätspolitik, um sich mit der universalen Maschine der Gegenwart nicht beschäftigen zu müssen: wisch und weg! Im Grunde ist dies eine Lizenz zur Verantwortungslosigkeit, ja zur Regression in kindliche Größenphantasien: Man prätendiert digitale Souveränität, um nun, gänzlich enthemmt, in seinen Vorurteilen und identitären Phantasmen baden zu können. Der Finsterling der Philosophie, Joseph de Maistre, hat in diesem Kontext die kluge Frage gestellt, ob man sich etwas Schrecklicheres vorstellen als ein Kind, das mit Superkräften begabt sei. Was, in eine Filmszenerie übersetzt, das Bild eines Kindes wäre, das vor einem geöffneten Atomkoffer säße und darin den roten Knopf entdeckte. Dies im Blick, wäre das Einzige, was man den Nationalisten aller Couleur zurufen sollte: Kinder, bitte werdet endlich erwachsen!
Aus einem Vorwort zu “Animal Farm”.
George Orwell: “Looking Back on the Spanisch Civil War”. In ders.: A Collection of Essays. London 1953, S. 188-209. S. 191
George Orwell: “Notes on Nationalism”. In: ders.: Essays, London 2000, S. 300-317. S. 300.
George Orwell: “Notes on Nationalism”. In: ders.: Essays, London 2000, S. 300-317. S. 301.
George Orwell: “Raffles and Miss Blandish”, In ders.: A Collection of Essays. London 1953, S. 32-148, S. 155.
Themenverwandt
Abwärts!
Wenn man von Totalitarismus spricht, steht häufig das Bild eines übermächtigen, furchterregenden Staates vor dem inneren Auge: Porträt des Leviathan, als Monster gezeichnet! Von Franz Neumann, dem leider vergessenen Politikwissenschaftler, der (nach einem Studium bei Karl Mannheim) an dem von Frankfurt nach New York ausgelagerten Insti…
Die Ritter von der traurigen Gestalt
Von Nietzsche stammt die schöne Bemerkung: »Der Irrsinn ist bei Einzelnen etwas Seltenes, — aber bei Gruppen, Parteien, Völkern, Zeiten die Regel.« Mag diese Einschätzung unmittelbar einleuchten, so bringt sie andererseits eine große Gedankenverlegenheit mit sich: Denn wenn der Irrsinn zu einer Massenerscheinung wird, ist er als s…