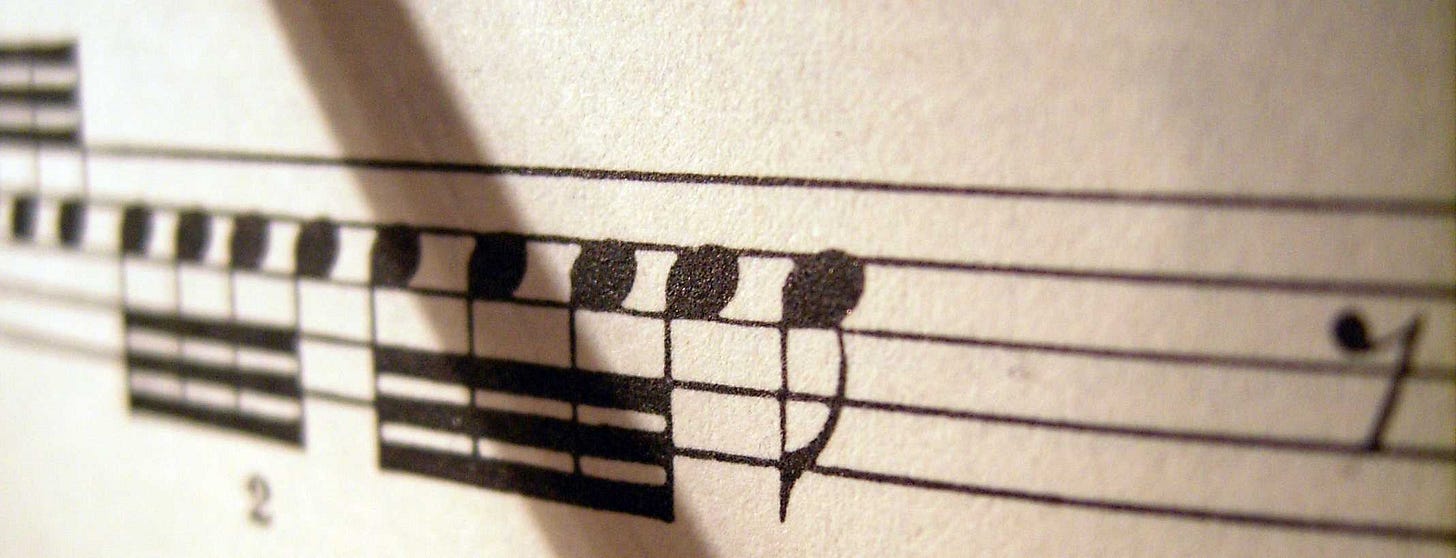Hopkins Stanley
Einleitung
Porträt des Autors, elektrifiziert: Über den Übergang vom mechanischen zum elektromagnetischen Schreiben ist die siebte Übersetzung in unserer Reihe von Martins frühen Schriften. Er stellte sie am Abend des 11. November 1995 im Berliner Literaturhaus im Rahmen der Berliner Hörspieltage,1 nachdem er am Vormittag sein Klangstück Klänge und Schatten aufgeführt hatte, eine Art akustischer Selbstanalyse. Das Publikum bestand fast ausschließlich aus Redakteuren, Regisseuren und Hörspielautoren. Das Timing des Vortrags war insofern bemerkenswert, als die Zuhörer einerseits mit einer radikalen Selbstinszenierung, andererseits mit einer ausgefeilten Theorie konfrontiert wurden – und weil vor diesen Vorträgen gerade Martins kantiger Aufsatz in einer Fachzeitschrift erschienen war,2 in dem er die veralteten Produktionstechniken des deutschen Rundfunks beklagte, war die Stimmung durchaus angespannt. Dieser Vortrag bezieht sich zwar auf die Frage der Klangkunst, fügt sich aber auch nahtlos in unsere Aufsatzreihe ein – und damit in dem größeren Kontext des burckhardtschen Denkens. Wie in den vorangegangenen Aufsätzen Digitale Metaphysik3 (April 1988), Im Arbeitsspeicher4 (Januar 1990) und Die Universale Maschine5 (Dezember 1990) geht es um die größere Frage jenes Paradigmenwechsels, den Martin in seiner ersten großen Publikation angegangen war: Metamorphosen von Raum und Zeit (1994). Das Porträt des Autors, elektrisiert fällt in die Zeit unmittelbar nach dem Erfolg der Metamorphosen, als er immer häufiger gebeten wurde, Vorträge zu halten. Intellektuell gesehen war dies eine seltsame Herausforderung für den jungen Autor, der, nachdem er in den Metamorphosen die Repräsentation der Zentralperspektive für beendet erklärt hatte, darüber nachdachte, was die Rückkehr zum Simulacrum und die Bewegung darüber hinaus in die Simulation kulturell bedeutete, was schließlich zur Veröffentlichung seines zweiten Hauptwerks, Vom Geist der Maschine: Eine Geschichte kultureller Umbrüche im Jahr 1999.
Es mag sein, dass es geborene Denker und Philosophen gibt, aber in Martins Fall hatte er sich nicht vorgenommen, Theoretiker, geschweige denn Philosoph zu werden – und wie diese Reihe seiner frühen Texte deutlich macht, drehte sich sein Schreiben in erster Linie um seine Begegnung mit dem Computer. Es spiegelte damit die unmittelbaren Erfahrung des elektrischen Autors wieder, der sich in der Radioproduktion und im Tonstudio wiederfand, dessen Maschinenpark gleichsam eine Materialisierung des zeitlichen Bruchs der sich verändernden intellektuellen und ästhetischen Paradigmen darstellte. Und da er den Schriftsteller immer als einen Wortkünstler verstanden hatte, entspringt sein Schreiben der Neugier, die er bei seiner Arbeit erlebt. Während die 1991 begonnene Arbeit an den Metamorphosen bereits einen philosophischen Wandel in seinem Verständnis erforderte (so wurden vor der Veröffentlichung des Werks die Kapitel über die Mechanische Uhr, die Kathedrale und die Fotografie in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht), verschob sich sein Blick von der ästhetischen Praxis hin zur Kultirphilosophie. Und dies führte dazu führte, dass er sich mit entlegenen Themen wie dem Dogma der unbefleckten Empfängnis oder der Sozialgeschichte der Guillotine und des Henkers auseinandersetzte - beides Gegenstände, die Lettre-Essays wurden und später zu Kapiteln im Geist der Maschine wurden.
Im Nachhinein betrachtet war es ganz wunderbar, auf diesen speziellen Vortrag gestoßen zu sein. Hier nämlich fand sich die Antwort auf meine Frage, wie sein experimenteller Geist seine Arbeit mit Schauspielern, der Radioproduktion und dem Sound im Allgemeinen beeinflusst hatte – etwas, worüber er in Éducation sentimentale III und IV schreibt. Der Hauptgrund ist, dass dieser Vortrag die erschreckenden wie schönen Auswirkungen der digitalen Technologie auf die Neudefinition unserer menschlichen Intelligenz als erkennen lässt, als Metrum und als Quelle der Einbildungskraft. Dies ist ein wesentlicher Einblick, um zu verstehen, worum es in Martins Gedankenlabyrinth geht. Wenn dieses als eine Form der Technikphilosophie abgetan wird, so lässt dies seine Beobachtungen über die antike Rationalität und ihre kulturellen Auswirkungen auf die sozialen Antriebe der Moderne unter den Tisch fallen. In diesem Vortrag jedenfalls lässt sich in Augenblick erhaschen, wo der Künstler und der Theoretiker einander die die Hand reichen - und dabei zeigt sich, dass die Gestalt des elektrifizierten Autors mit einer Umcodierung des Individuums einhergeht – vom Individuum zum Dividuum zum allseits vernetzten Zeitgenossen6, eine Metamorphose, die man als das Ende der Philosophie und den Beginn der Psychologie der Maschine definieren kann.
Porträt des Autors, elektrifiziert.
Zum Übergang von der mechanischen zur elektromagnetischen Schrift
Berliner Literaturhaus, 11. November 19947
Sehr geehrte Damen und Herren,
Wie Sie der Ankündigung haben entnehmen können, geht es um das Porträt des Autors, elektrisiert. Und wie der Untertitel sagt: Um den Übergang von der mechanischen zur elektromagnetischen Schrift. Womit ich es fertiggebracht habe, eine ganze Reihe von Rätseln darin zu verstecken. Lassen Sie mich also (das Thema ist dunkel und schwierig genug) mit einer Geschichte beginnen. Gehen wir zurück in die Mitte des 18. Jahrhunderts, dorthin, wo die Geschichte der Empfindsamkeit ihren Anfang nimmt, oder wo (wie ich sagen würde) der moderne Autor sich elektrisiert. Also: stellen Sie sich vor, ein großes, leeres Feld. Es ist früher Morgen und da steht ein Abt und weist tausend Kartäusermönche an, in einem Kreis Aufstellung zu nehmen. Der Kreis ist riesengroß, ein paar hundert Meter im Durchmesser aber die Mönche können einander noch sehen. Der wahre Held dieses Kreises ist aber nicht der Abt Nollet, sondern die sogenannte Leidener Flasche, das heißt: jenes Behältnis, das die erste Form konservierter elektrischer Energie darstellt, also eine Batterie. Hier, an der Elektrizität, hängt die Fragestellung, die dieser Aufstellung zugrunde liegt: Wie schnell bewegt sich die Elektrizität? Das soll in Erfahrung gebracht werden. Die Mönche reichen sich also die Hände und bilden somit einen Kreis. Zuletzt wird der Kreis geschlossen eben dadurch, dass man die Leidener Flasche, also die Batterie berührt, und augenblicklich beginnen die tausend Kartäusermönche zu zucken, gleichzeitig – womit die Antwort auf die Frage gegeben ist. Die Elektrizität ist so schnell, dass man sie mit dem bloßen Auge nicht wahrnehmen kann, es gibt hier keinen Zeitfluss mehr.
Diese Versuchsanordnung ist so etwas wie das Phantasma der Moderne. Sie haben hier den Mann in der Menge, und Sie haben die Idee (oder besser: das Phantasma) von dem, was heute Öffentlichkeit heißt, Sie haben den Fluss von Energie, das Massenmedium Elektrizität. Sie haben das Urbild von dem, was man die Ästhetik des Schocks nennen kann. Sie haben schließlich die Sensation der Gleichschaltung durch den Raum und die Zeit: das, was wir Aktualität nennen und was man als die Entfernung der Ferne bezeichnen kann: Jetzt gerade, live in New York.... Diese Versuchsanordnung wird interessanter noch, wenn wir einige Fragen formulieren. Zum Beispiel könnte man fragen, wer hier der Sender und wer der Empfänger ist? Schwierig, nicht wahr? Oder: was ist die Botschaft? Auch schwierig. Denn es gibt ja eigentlich keine Botschaft im Sprachsinn, und doch wird wird unzweifelhaft etwas übermittelt. Zu sagen, dass dies Elektrizität sei, ist ein bisschen dürftig: eher muss man wohl einräumen, dass hier das Urbild der modernen Gesellschaft kommuniziert wird, was im 19. Jahrhundert dann Nation oder Publikum heißen wird und heute, im ausgenüchterten Sinn: Kommunikation, Mitgliedschaft. Die Empfindung, im gleichen Kreislauf zu stecken. Das ist es, was sich den Mönchen vermittelt (und was keiner Zeit zuvor sich so intensiv vermittelt hat): Gleichschaltung, die Gewissheit, einen kollektiven Körper zu bilden. Aber fragen wir weiter, andersherum: ist es möglich, in diesem Kreislauf noch von einer individuellen Handlung zu sprechen? Sie sehen, das läuft auf die Frage nach dem Autor hinaus. Was die Kartäusermönche angeht, so ist klar: sie sind Ergriffene. Ergriffene in dem Sinn, dass der eine den anderen ergreift und dadurch der Fluss hergestellt wird. Löste sich nur einer aus der Kette, wäre der Kreislauf unterbrochen. Sie sehen: es ist in diesem Zusammenhang, wo einer im anderen steckt, ziemlich sinnlos, ein geschichtsmächtiges, autonomes Subjekt in Anschlag zu bringen. Aber machen wir uns dennoch auf die Suche, nehmen wir an, es gäbe ihn: den elektrisierten Autor. Worin bestünde dann seine Handlung? Die einzige denkbare Handlung (wenn es man es denn nicht vorzieht, sich fein herauszuhalten) besteht nurmehr darin, den Kreis zu schließen, sie besteht in der Berührung der Batterie. Der Autor wäre derjenige, der die Autorität hätte, einen solchen Kreislauf herzustellen. Versetzen wir uns in die Lage desjenigen, der den Kreis schließt, der die Batterie ergreift und der die anderen in konvulsivische Zuckungen versetzt. Das ist natürlich die Megalomanie schlechthin: ich rühre einen Finger und alle beginnen mit mir zu zucken. Begreiflicherweise ist dies die Sehnsucht des elektrischen Autors, das ist die Sehnsucht all derjenigen, die den Zugriff auf solche Batterien haben. In diesem Phantasma wird der Körper des Autors, durch die gleichzeitige Verschaltung mit seinem Publikum, zu einem Mega-Körper. Das ist das Phantasma der Ausstrahlung.
Nun sind wir aber auf den Berliner Hörspieltagen und haben es damit zu tun, dass wir längst in den leeren Raum hinein strahlen. Aus dem Glanz der Ausstrahlung ist eine Art des diffusen Verstrahlens geworden. Das hat natürlich damit zu tun, dass der eine und alleinseligmachende Kreis (wie er in der Kette der elektrisierten Kartäusermönche präfiguriert ist) nicht mehr existiert, dass wir es mit einer wachsenden Zahl von schrumpfenden und einander überlagernden Kreisen zu tun haben. Ja, man wird das Gefühl nicht los, dass es schon einen Haufen Batterien gibt, die einfach so vor sich hinstrahlen. Das ist eine Proliferation ganz eigener Art.
Was aber macht der Autor jetzt? Wenn er intelligent ist, begreift er, dass er sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass er nur dadurch, dass er sich an die Batterie anschließt, tausend andere in konvulsivische Zuckungen versetzt. Diese Einsicht aber ist, wie jede narzisstische Störung, eine große Verletzung. Und sie ist es umso mehr, weil die Ästhetik im wesentlich aus der Hochspannung dieses Kreislaufs sich speist. Die Erfahrung dieses Kreislaufs, wo einer im anderen steckt, wo sich die Botschaft sozusagen elektrisch verlängert, hatte die Formel: ES SCHREIBT. Dieses großgeschriebene ES, das könnte man unsere Sozius-Existenz nennen (das Gesellschaftliche, das Politische, das Thema, das auf der Straße liegt). Aber darauf, das ist die Lage, kann man sich nicht mehr verlassen. Lieschen Müller ist zuhause und sie ist nicht zuhaus, denn sie schaut fern und lässt sich via Fernbedienung durch den telegraphischen Raum katapultieren. Der Autor, elektrisiert muss erfahren, dass der Kreis, in dem er sich bewegt, immer kleiner wird. Jenes kollektive ES (die Idee des Megasubjekts, der räumlichen Vergrößerung) verwandelt sich, schon mangels Publikum, zurück zu einem ICH. Dieses ICH jedoch kann und will nicht mehr derjenige sein, der es war, bevor es ES wurde. Denn es ist ein ICH, das die Botschaft der Elektrizität aufgenommen hat, das also weiß, dass einer im anderen steckt.
Aber damit komme ich zu dem Punkt, der mich interessiert. Denn in dem Maß, in dem das Vertrauen in die Ich-Vergrößerung, ins ES schwindet, tritt etwas anderes hervor: die Schrift. Damit wird sichtbar, was eigentlich von Anbeginn schon angelegt war: nämlich dass unser Autor längst schon mit einer neuen Schrift operiert. Er setzt sich nicht mehr an den Tisch und schreibt schwarz auf weiß, ICH SCHREIBE sondern er setzt sich ans Mikrophon und sagt ICH BIN'S (oder er stellt sich, schreibenderweise, vor, wie ein anderer sich ans Mikrophon setzen und dies sagen wird). Es gibt tausend Weisen, das zu sagen. Und in diesen tausend Weisen bringt sich nicht nur einer zu Gehör, sondern wird sichtbar, dass in dem einen immer auch ein anderer steckt (wie in einer dieser kleinen russischen Puppen). Die Erfahrung, wenn man so will, ist die eines Dividuums (und das genau ist die Botschaft, die die akustisch vervielfältigen Stimmen aussenden).
Aber das ist jetzt nicht unser Problem, mir geht es um die Schrift, mir geht es um die Frage, was sich dem Autor mitteilt, wenn er (in Ermangelung des Publikums) in einen Kreislauf mit sich selbst eintritt, wenn er sich also, übers feed back, selbst füttern muss. Oder um es bildlich zu sagen: was passiert, wenn jenes große Feld, wie ich es aus dem 18. Jahrhundert herbeizitiert habe, geräumt ist? Wenn da niemand mehr ist, nur der Autor mit seiner Batterie? Nun hat sich diese Batterie im Laufe der letzten zweihundert Jahre zu einem hochkomplizierten Maschinenpark verwandelt. Da gibt es Kameras und Mikrophone, da gibt es die Möglichkeit, durch die elektromagnetische Schrift die eigene Stimme und den eigenen Körper festzuhalten (das heißt: die Möglichkeit sich selbst als anderen zu betrachten), da gibt es andererseits die Möglichkeit, etwas, was ich nicht am eigenen Leibe erfahren habe, mir dennoch einzuverleiben. Und damit bin ich endlich bei meiner These: der Behauptung nämlich, dass das Novum, wie es die Versuchsanordnung des Abbé Nollet verrät, darin besteht, dass das Konzept der mechanischen Schrift durch das der elektromagnetischen abgelöst wird.
An dieser Stelle möchte ich abermals zu einem kleinen Exkurs aufbrechen, mit dem Ziel, zu präzisieren, was ich unter mechanischer Schrift verstehe (was ja in meiner Gedankenordnung das Gegenbild zur elektromagnetischen Schrift ist). Was ist damit gemeint? Ich verstehe darunter einen Prozess, dessen Anfänge ins 12. Jahrhundert zurückgehen und der mit dem Buchdruck zu seiner endgültigen Form findet. Also das, was Sie mit Bleilettern gesetzt und gedruckt schwarz auf weiß lesen können – eine Ordnung, die ja bis in meine eigenen Jugendzeit gegolten hat. Es wäre nun sehr naiv anzunehmen, dass sich, da es ja beim Alphabet bleibt, das Konzept der Schrift durch die Mechanisierung nicht ändert, dass man es bloß damit zu tun hat, dass das, was im Mittelalter nur handmade sein konnte, sich nun massenhaft vervielfältigen lässt. Das ist natürlich nicht der Fall. Alles wird anders.
Das ganze Konzept des Erzählens verändert sich, es wandert von der Oralität ins Visuelle, aus den Erzählern (ja man könnte fast sagen: aus den Sängern), die im direkten Kontakt mit dem Publikum stehen, werden Literaten. Also solche, die nicht mit dem gesprochenen Wort, sondern mit dem gedruckten Wort, die mit Lettern operieren. Es entsteht, wie Marshall McLuhan das genannt hat, der typographische Mensch. Wenn Sie hier die Verlustseite verbuchen wollen, haben Sie's mit dem Beginn der Videotie zu tun. Man schreibt dem Auge zu, was man dem Ohr versagt.
Freilich gibt es auch einen Gewinn. Das ist ein Zuwachs an Abstraktion. Da hat man es zunächst einmal mit der Entstehung eines Leserpublikums zu tun, mit dem, was Kant Öffentlichkeit nennt (und worunter er stets Buch-Öffentlichkeit versteht). Diese Öffentlichkeit, die einen frühen Prototyp unserer elektrisierten Mönche darstellt, ist als solche zunächst nicht sichtbar, sie konstituiert sich um das Buch herum – sie bildet also einen künstlichen Leib. Diese Veränderung macht sich am deutlichsten vielleicht an der Figur des Autors bemerkbar. Der Autor wird zu einer Art Mega-Subjekt, er erlebt (mit dem Buch) eine Körper-Erweiterung ersten Ranges. Damit aber hat es noch lange nicht sein Bewenden. Denn auch das Buch, das zuvor ein Zweit-Hand-Produkt war (das Abbild der schreibenden Hand), wird zu einem künstlichen Korpus, es wird zum Korpus, wo sich die Ich-Erweiterung von Leser und Autor gleichermaßen abbilden. All das ist durchaus unmetaphorisch und handgreiflich zu nehmen. Denn das, was auf der Seite des Autors einen quasi phantasmatischen Leib, also die Aura der Literatur konstituiert, wird auf der politischen Seite zu einer Realität, vermag das Buch einen Sprachraum doch so zu homogenisieren, dass er eine Einheit bildet. Das ist der Kern der Mechanischen Schrift: Homogenisierung, Rationalisierung, die Konstituierung künstlicher Körper, Körperschaft. Wir haben es also mit den durch die Buchkultur kodifizierten und vereinheitlichten Volkssprachen zu tun, die bald einen politischen Anspruch anmelden und sich zu politischen Räumen formieren: eben das, was man in Europa den Nationalstaat nennt. So besehen ist es kein Zufall, wenn die Letter, also das, was schwarz auf weiß geschrieben steht, zu einem Stellvertreter der Autorität wird. Sie verbürgt, was der Glaube nicht mehr vermag. Das ist das Konzept: Schwarz auf weiß. Dieses Konzept, das ich mechanische Schrift nennen möchte, war lange und unangefochten, bis in unsere Tage hinein, die avancierteste Form des Zeichens.
Was bedeutet elektromagnetische Schrift? Das soll zunächst einmal nichts anderes heißen, als dass das Zeichen in elektromagnetischer Form, auf einem Band oder auf einer Festplatte notiert ist. Sie sehen: dieser Schriftbegriff umfasst, als einen Spezialfall, auch das, was wir herkömmlicherweise Schrift nennen: das geschriebene, besser: das gedruckte Wort. Denn natürlich ist auch der Autor, der es vorzieht, schwarz auf weiß zu schreiben (wofür es ja eine Reihe guter Gründe gibt), längst ein elektrisierter, textverarbeitender Autor. Diese sehr weite Definition der elektromagnetischen Schrift hat nicht nur den Vorteil, dass sie die Antinomie von audiovisueller Schrift und dem, was man heute Printmedium nennt, unterläuft, sie versucht auch, den Unterschied, den man zwischen analog und digital macht, nicht so sehr als Zäsur, sondern als Kontinuum aufzufassen. Denn digital: das heißt nur, dass etwas auf eine sehr viel intelligentere Art und Weise notiert ist, und so ist es kein Zufall, dass man Arbeitsweisen, die schließlich die Gestalt von Maschinen annehmen, lange zuvor ästhetisch vorweggenommen sehen kann. Kurzum: wie auch immer man das sagt, ICH BIN'S, ob vor einer Kamera, einem Mikrophon oder man's in den Computer hinein tippt, es hängt an jener Batterie, wie sie unsere elektrischen Mönche zucken lässt.
Nun möchte ich (denn ich habe nicht vergessen, wo ich bin) nicht über die Zukunft der Literatur oder der Bilder sprechen, sondern über das, was uns hier angeht: Töne. Klangzeichen. Meine Frage lautet: wie schreibt man, worauf schreibt man, was ist der Ort der Schrift? Die Antwort lautet, ebenso klar: sie erscheint nicht schwarz auf weiß, sondern in Form eines Bandes, auf dem Klangzeichen gespeichert sind. Und weil man es mit elektrischer Schrift zu tun hat, braucht man ein elektrisches Lesegerät, was immer es sei (Radio, Kassettenrecorder, Bandgerät). Das ist, wie Sie sagen können, natürlich eine triviale Betrachtung. Deshalb aber keineswegs überflüssig. Denn dieser Gedanke markiert eine höchst bemerkenswerte Verschiebung: der Ort der Schrift, der zuvor der Logik des schwarz auf weiß folgte, verschiebt sich ins Terrain der elektromagnetischen Schrift, hier: ins Feld der Klangzeichen. Oder um es noch präziser zu sagen: Der Ort der Schrift ist dort, wo die Klangzeichen montiert und bearbeitet werden. Im Tonstudio. Oder, da auch diese Ort schon im Begriff ist, sich zu miniaturisieren: im Computer.
Hier und unter dieser Prämisse formulieren sich die entscheidenden Fragen. Nehmen wir, um zu exemplifizieren, worum es geht, einen Sound, sagen wir einfachheitshalber: ICH BIN'S. Nun kann es sein, dass ich das vom Papier abgelesen habe. Es kann aber auch sein, dass ich dies, weil mich das Papierene des Ablesens stört, gleich ins Mikrophon hinein gesagt habe. Ich möchte (und das ist bemerkenswert) das Papier nicht hören. Nicht von ungefähr wird ein großer Teil Mühe darauf verwandt, das Rascheln und Blättern auszublenden, oder, wenn man es geistig nimmt: die Papiertiger des Autors aus der Welt zu schaffen. Der Text, wenn denn eine Textvorlage da ist, soll so sein, dass er nach irgendwas klingt. Kunst oder Leben, das ist egal, Hauptsache, dass es klingt. Worauf ich hinauswill: die Ebene, auf der ich dieses Sprachereignis betrachte, ist die Ebene nicht mehr der Literatur, es ist auch nicht die Ebene des Theaters, sondern es ist die Ebene des Klangzeichens selbst. Auch diese Bemerkung ist eine Trivialität, verkünde ich hier doch nichts anderes als eine medienspezifische Sprache. Aber was, und hier wird es wieder interessant, was ist denn die Sprache eines Klangzeichens? Was ist die Klangzeichensprache?
Zunächst einmal ist, dadurch dass ich es aufgenommen habe, ein Klang zum Zeichen geworden. Und von jetzt ab muss ich mich nicht mehr wiederholen, sondern ICH BIN'S sagt jetzt mein Tonbandgerät. Diesen Schnipsel nun kann ich verdoppeln, wie es mir gefällt. Ich habe also einen ganzen Chor von Stimmen, die ich wie ein Kanon hintereinander loslaufen lassen oder clusterförmig übereinander lagern könnte. Ich kann meinen Schnipsel aber auch, mit Schere, Sampler, Delay oder Hall bearbeiten, ich kann ihn time stretchen oder pitch shiften (oder wie diese Teufelswerkzeuge auch heißen mögen) und so habe ich nicht nur einen, sondern eben einen im anderen, eine ganze Armada von Clons und Hybriden. Und da es ich mir nicht an Nachschub fehlt, könnte ich meinen Klangzeichenkörper, der stetig behauptet, er sei's, einer Reihe von Experimenten unterziehen. Ich könnte ihn also als eine Art Dummy und Crashtestpuppe benutzen. Ich könnte untersuchen, wie er lange er das auf erkennbare Art und Weise tut und ob und wann er in den Untiefen des Geräuschs verschwindet. Ich könnte untersuchen, was passiert, wenn ich ihn auf den Kopf stelle, wenn ich sein Inneres nach außen stülpe, wenn ich ihn zerschnipsele oder wenn ich seinen Kreislauf so herunterfahre, dass ich ihn unter der Zeitlupe betrachten kann. In diesem Sinn fungiert das Instrumentarium des Tonstudios als Analysezeug, oder, um es bildlich zu sagen: als Chirurgenmesser, mit dem es möglich ist, die Anatomie des Klangzeichens zu untersuchen.
Ich könnte diesen Prozess der systematischen Verformung auch dem Zufall überlassen, ich könnte meinen Schnipsel in den Maschinenpark einspeisen und ihn so, über das Feedback, in einen Kreislauf mit sich selbst eintreten lassen. Ich könnte also wenn etwa mein Ehrgeiz danach gehen sollte, mich selbst herauszuhalten, eine aleatorische ICH-Maschine konstruieren, die sich von allein verformt. Sie werden zugeben, dass spätestens bei der siebten Variation das Interesse auch des gutwilligsten Hörers nicht mehr sein wird, in Erfahrung zu bringen, wer dieses sonderbare Dividuum ist, sondern man wird die Mutationen und Metamorphosen verfolgen, man wird schauen, wie es sich aufbläht, wie es an den Rändern ausflockt und Form verliert, und wie es (ein amorphes, kaum mehr zu erkennendes Etwas) im Rauschen untergehen wird.
Ich gebe gern zu: All das mag jemanden, der am Alphabet hängt und der nur das als Schrift auffassen mag, was schwarz auf weiß zu lesen ist, irritieren. Denn da verflüssigt sich etwas und geht unter, fühlt man sich in ein plankenloses Meer hineingeworfen. Wenn Audio Art als Provokation erlebt wird, so deshalb, weil sie den festen Grund der Literatur verlässt, kann man sich doch ein Stück vorstellen, in dem kein Text mehr erscheint, sondern nur eine Stimme, die sagt: ICH BIN'S, immer neu und immer anders.
Freilich: diese Einsicht dürfte den Radiomacher am allerwenigsten affizieren. Denn gehen wir zurück, in die mythische Zeit des Anfangs, so war eine der ersten, radiophonen Sendungen der Untergang der Titanic, die (über die drahtlose Telegraphie) davon berichtet, wie sie untergeht. Es war einer der Initiatoren des amerikanischen Rundfunks, ein junger Mann namens Sarnoff, der die Hilferufe der untergehenden Titanic aufgefangen und mit einem improvisierten telegraphischen Netz die Rettungsversuche koordiniert hatte. In der Tat ist der Seefunk (der Versuch, die bedauernswerten Matrosen mit vertrauten Liedern an die Heimat zu erinnern) eine Art Entbindung von der Schrift: nicht mehr die Lettern, die geschriebenen Texte, sind es, die das Heimatgefühl wachrufen, sondern der Gesang. Womit das Radio in eine vorneuzeitliche, animistische Ausdrucksweise zurückfällt und wir nun wirklich in einer modernen Odyssee angelangt sind. An einem Vorweihnachtsabends des Jahres 1906 wurden die Telegraphisten eines Schiffes in der Karibik davon überrascht, dass ihr Apparat plötzlich zu sprechen begann: »Eine menschliche Stimme kommt aus dieser Maschine, da spricht jemand. Eine Frauenstimme singt. Es ist unglaublich!«
Liest man die Dokumente dieser frühen, mythischen Zeit, da das Radio in der Luft lag, wird sichtbar, dass man es hier mit der Geburt eines neuen Genus zu tun hat: dem elektromagnetischen Gespenst. Denn Radio, das heißt Telepresenz, Raumextension, es ist (als Geschwister der Telephonie) die Möglichkeit zur überleiblichen Anwesenheit. Das heißt: übers Radio kehren animistische Denkformen zurück. Wenn Sie diesen Hintergrund vor Augen haben, ist der Gedanke, dass man ein Hörspiel verfassen kann, wo jemand mit schwerem Schritt und festem Schuhwerk eine Treppe heraufstiefelt, klingelt und sagt: Ich heiße Paul Meier, eine ziemliche Abstrusität. In gewisser Hinsicht ist dieser Typus ein anrührend Versprengter, ein unverdrossener Landgänger und Überlebender einer Zeit, die noch nicht Schiffbruch erlitten hat.
Nichtsdestotrotz hat mich eine ganze Zeit lang die Frage beschäftigt, aus welchen Gründen die Modernität des Mediums so verkannt werden konnte, wie mühelos Theater und Literaturformen in dieses Medium einwandern konnten, wie vergangenheitszugewandt offenbar das menschliche Auffassungsvermögen ist, dass es einen solchen Auftritt für bare Münze zu nehmen vermag. Ja, bis hier und heute ist man noch geradezu umstellt von Formeln und Gedankenfiguren, die irgendwo anders zuhause sind, im Kino, in der Literatur, in der sogenannten Realität, nur dort nicht, wo das Medium zuhause ist: nämlich im Tonstudio. Wir hängen, das ist wohl die dunkle und wenig schmeichelhafte Realität, einer Reihe von Vorstellungen an, die man in der Psychoanalyse Deckerinnerungen nennt, das heißt: Erinnerungen, deren Funktion vor allem darin besteht, etwas anderes zu überdecken, es nicht zur Sprache kommen zu lassen. Nehmen Sie beispielsweise die Rede vom O-Ton. Da haben Sie das naive Widerspiegelungsdenken: als ob ein Mikrophon irgendetwas 1:1 abbilden könnte. Ganz abgesehen davon, dass ein jedes technisches Medium die Welt auf eine bestimmte, systematische Weise verformt, dass also in der Art und Weise der Widerspiegelung schon bestimmte Gesetzmäßigkeiten liegen, so ist es doch darüberhinaus evident, dass ein solcher O-Ton in den Händen desjenigen, der mit ihm arbeitet, zum Zeichen wird, dass er also mit einer Schrift operiert, die nur zum Schein real, in Wahrheit jedoch eine Schrift ist, die Segmente von Realität zum Zeichen verwandelt. All die Widerspiegelungstheorien, die uns solche Begriffs und Gedankenungetüme wie Realismus, Naturalismus etc. aufschwatzen, sind im wesentlich Begriffs und Gedankenverhinderungsapparaturen, die den Blick aufs Medium verstellen. Schon das kleinste Exempel macht klar, dass alles, was im Zeichen des Spiegels steht (oder komplizierter gesagt: was der Logik der Repräsentation folgt), hier nicht mehr weiterhilft. Denn wenn ich meine Stimme, die sagt, ICH BIN'S, in einen Sampler einspeise, so habe ich zwar ein exaktes Double und kann mich damit begnügen, dieses akustische Spiegelbild nun von einer Tastatur abrufen zu lassen, tatsächlich jedoch läuft diese Digitalisierung auf etwas anderes hinaus: nämlich auf eine ungeheure Verflüssigung des ursprünglichen Klangzeichens. Denn durch diese Operation habe ich mich in den Besitz eines Gen-Pools gebracht, aus dem ich Hunderte von Derivaten, Clons und Mutanten erzeugen kann. Die digitalisierte Stimme ist ist also ein pluralis, eine Art genetischer Chor geworden, ja, an ihren Rändern hört sie überhaupt auf, Stimme zu sein, wird sie zu einem stimmähnlichen Geräusch oder zu einem metallenen und chaotisch vibrierenden Saiteninstrument.
Wenn ich hier in eine etwas deplaziert anmutende Terminologie verfalle, ist das kein Zufall. Denn wenn Sie die avancierten Arbeitsweisen der Studios analysieren, werden Sie feststellen, dass Sie die Operationen der Genetik hier in kristalliner, rein begrifflicher Form verfolgen können: COPY, DELETE, PASTE, INVERT, CYCLE. Ja, man könnte es genau andersherum sehen: was immer die Genetiker in vivo und mit einem noch wenig durchschauten Genmaterial praktizieren (was Chargaff nicht unzutreffend Genpanscherei nennt) ist in den Operationen, die man dem Klangzeichenkörper zukommen lässt, vorgezeichnet: klar und mit der äußersten Rationalität.
Ich muss gestehen: als ich vor einigen Jahren vor einem Sampler stand und auf dem kleinen Display lesen konnte, dass mir das Derivat eines Sounds hier als Hybrid vorgestellt war, gab es einen Augenblick des Erschreckens. Dieses Erschrecken war fundamental, es war die Einsicht: das, was du hier machst, ist etwas, was du im Grunde verachtest, du clonst. Das ist nicht bloß eine Technik, sondern es ist der Untergang eines Menschenbildes. Mehr noch: dieses Bild ist dir vor langer Zeit schon (und ohne dass Du die Genetiker dafür verantwortlich machen kannst) untergegangen, und nicht mit Getöse, sondern unter der Hand, beiläufig: in dem Augenblick etwa, als du noch mit einer Schere den Atem eines Menschen herausgeschnitten hast, einfach nur, um zu erfahren, wie ein solch atemloser Mensch klingt. Oder als du die Stimme eines Kindes in die Maschinerie eingespeist hast, bis sie, über das Feedback, zu einer Art Herztodsound geworden war.
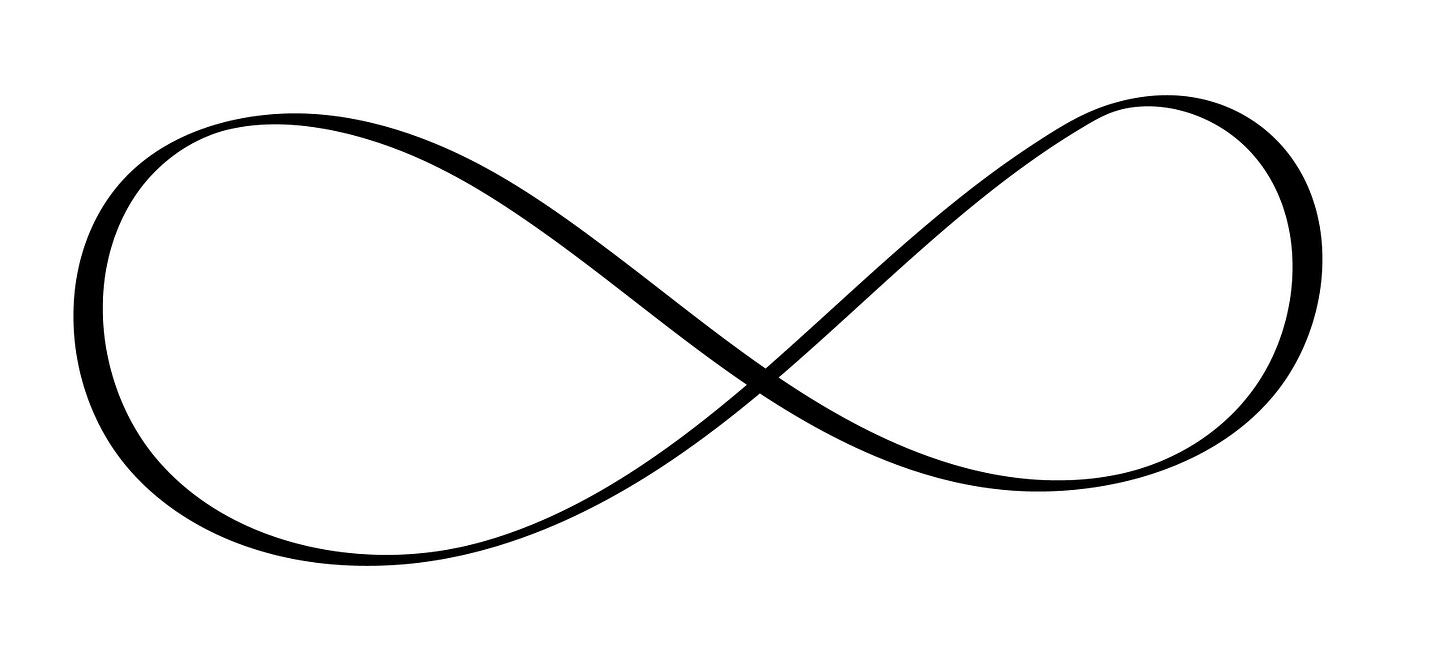
Dieser symbolische Tod, das ist der Punkt, ist der Maschine vorausgegangen, und der Sampler war in deinem Kopf lange zuvor. So besehen war dieser Blick aufs Display des Samplers ein Blick ins Innere des eigenen Kopfes, war, was hier mit einem terminus technicus bezeichnet war, der Schock einer nie zuvor so erfahrenen Innenwelt: die Erfahrung des digitalen Hybriden.
Es war dieser höchst zwiespältige Blick, der mich zu einer langen Reise in die Geschichte der Dinge hat aufbrechen lassen, dorthin, wo die Maschine ihren Anfang hat. All das gedankliche Treibgut nun, das mir aus fernen Zeiten in die Gegenwart zurückgeflossen ist, hat mich darin bestätigt, im Tonstudio die Zauberwerkstatt der Moderne zu sehen. Denn hier, in der Art und Weise, wie man Klangzeichenkörper bearbeitet, werden Dinge faßbar, die ansonsten nur mit großer Verspätung und sehr viel unklarer sich zeigen.
Was zuvor nur eine Empfindung war, wurde zu einer Gewißheit: daß man, auch unter einem großen und geschichtlichen Blickwinkel, gewiß sein konnte, am eigenen Instrumentarium zum Zeugen eines Zeitrisses zu werden. Nehmen Sie, beispielsweise, Ihre Vorstellung von dem, was ein Musikinstrument ist und bedenken Sie, was die Idee des Samplers für einige Jahrhundert Musikinstrumentenbau bedeutet. Es ist evident: Die Idee des Instruments ist im Begriff zu verschwinden, denn alles, was Klang ist, vermag virtuell zum Musikinstrument zu werden. Oder anders gesagt: es gibt keine spezifisch musikalischen und der gewöhnlichen, will sagen: unmusikalischen Welt, enthobenen Klangkörper mehr. Das ist eine Zäsur, die vergleichbar ist der Entfaltung der Polyphonie, des musikalischen Tiefenraums im vierzehnten Jahrhundert: und wie diese (die ja ihrerseits als Initial einer neuen Ordnung aufzufassen ist) etwas, was unabsehbare, unerhörte Folgen zeitigen wird.
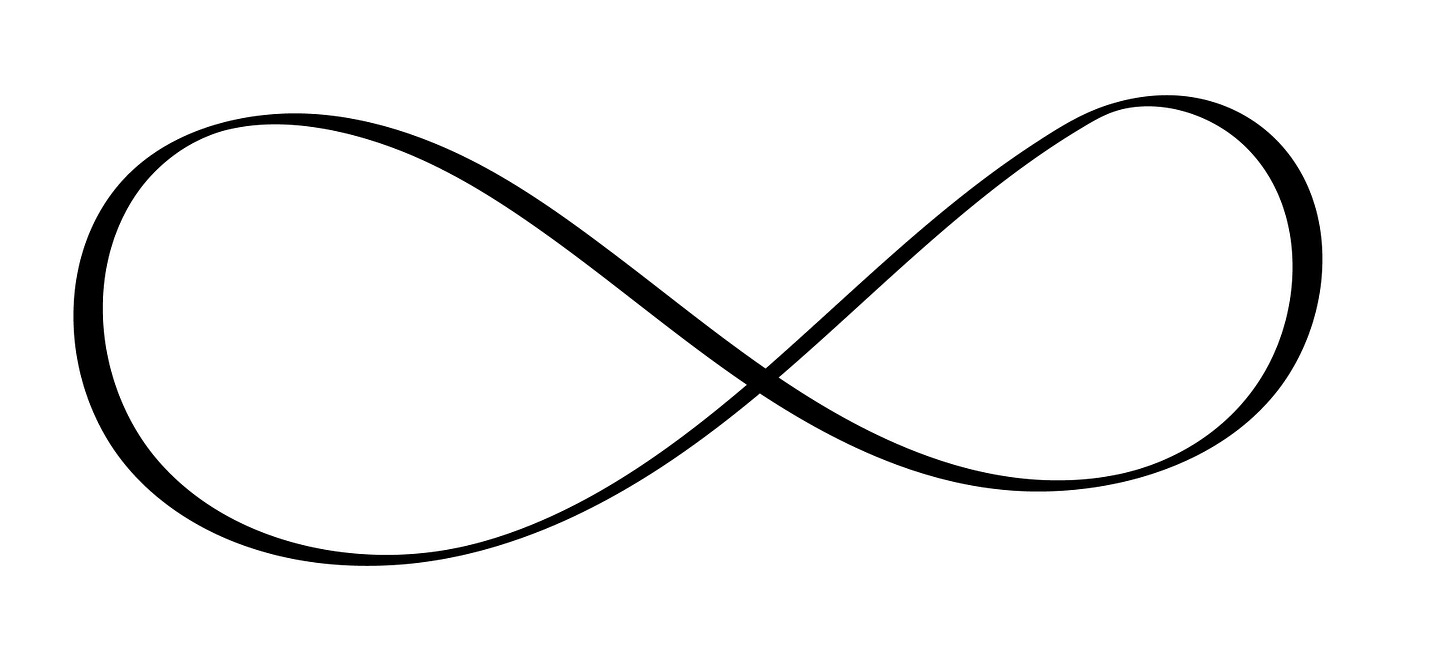
Aber nicht nur das, auch die Zeitstruktur, die ganze Art, wie Musik über Jahrhunderte notiert worden ist, erweist sich als etwas, das in die Vergangenheit weist, nicht aber in die Zukunft. Schauen Sie sich ein Notenblatt an und versuchen Sie einmal die Elemente dieser Schrift zu analysieren: Sie haben da soetwas wie einen Zeitpfeil, der auf eine bestimmte Art und Weise getaktet hast, dann haben Sie bestimmte events (von Höhe und Dauer), die bestimmten Instrumenten und Klangquellen zugeschrieben werden. Das ist natürlich, schwarz auf weiß, eine Abart dessen, was ich die mechanische Schrift genannt habe.
Man geht der Newtonschen Logik folgend von einem abstrakten und homogenen, raumlosen und deshalb portablen Klang aus. Hier aber liegt exakt die Begrenzung dieser Notationsweise. Denn der Klang ist dieser Art der Notation diametral entgegengesetzt: ein Raumereignis, ein Ereignis, das nicht zu trennen ist von seiner Räumlichkeit. Der Klang entsteht ja durch Resonanz, er ist verortet durch die Reflexionen des Raums und die Reflexionen dieser Reflexionen. Nichts von dem, was ein herkömmliches Notenblatt auszeichnet, ist für den, der mit den zeitgenössischen Klangzeichenkörpern arbeitet, noch von Belang – und daher wird niemand auf den Gedanken verfallen, Partituren dieser Art zu verfassen. Denn Sie arbeiten dort mit Dingen, die in dem herkömmlichen, mechanischen Konzept nicht notierbar sind: Sie arbeiten damit, wie der Klangzeichenkörper im Raum erscheint, mit Tiefenräumen und Raumperspektiven, die, je nachdem, ineinander verschachtelt sein können; dann arbeiten mit Sie mit dem Klangzeichenkörper selbst, mit seinen Volumina, mit seinen Höhen und Tiefen, und schließlich arbeiten sie mit seinen Clons, mit den digitalen Mutanten und Derivaten des ursprünglichen Klangs. Kurzum: Die Parameter, unter denen man einen Klang betrachtet, sind andere geworden, sie haben sich vervielfältigt. Nehmen Sie ein beliebiges Geräusch, den Sound einer Espressomaschine zum Beispiel. Wie sollte ein Komponist das noch beschreiben? Und zumal, wenn er sie so verfremdet hat, dass sie sich nicht einmal mehr durch das Sprachzeichen Espressomaschine vermitteln lässt? Eins, denke ich, wird klar: Ein solch komplexes Klangereignis als Note aufzufassen, die durch ihren Ort und ihren Zeitwert auf einer Zeitspur hinreichend definiert ist, entspricht dem alten geometrischen Körperideal, es ist aber, wenn man die komplexe Körperlichkeit des Klangereignisses analysiert, eine geradezu fahrlässige Beschreibungsweise.
Ein weiterer Punkt (oder genauer: nur eine andere Betrachtungsweise desselben Phänomens) ist die Tatsache, dass auch das Zeitgefühl ein anderes ist. Sie denken nicht mehr auf jener Zeitachse, auf der ein Komponist des siebzehnten Jahrhunderts gedacht hat, das heißt: in der Gesetzmäßigkeit der Sonatenhauptsatzform, wo man bekanntlich, nachdem man A gesagt hat, stets B sagen muss, sondern Sie operieren in einer zeiträumlichen Ordnung. Nun gebe ich gern zu, hier wird es schwierig. Also versuche ich's einfach zu machen und nehme zu diesem Zweck einfach das Speichermedium, das uns unser Zeiterlebnis vermittelt. Tatsächlich beschreibt ja schon die Festplatte (im Gegensatz zum Sendeband, das ja noch die Entsprechung des Zeitpfeils ist) die neue Ordnung. Dort, wo das Sendeband sich entwickelt, entwickelt sich auf dem elektromagnetischen Festplattenspeicher nichts mehr. Denn die Klänge sind ja schon da, sie sind räumlich organisiert und nicht mehr als Sequenz ABC, sondern mehr oder minder zufällig verteilt. Wenn etwas als Sequenz ABC erscheint, so ist dies kein physikalisches Nacheinander-Auslesen, sondern ein Springen von Hier nach Da. Es gibt hier keine Linearität, sondern Spatialität, Räumlichkeit. Das ist der wohl der entscheidende Gedankensprung: dass man sich lösen muss vom letzten Band, das uns an die herkömmliche Zeitaufassung bindet. Zeit ist eine Erscheinungsweise des Raums, alles ist gleichzeitig da und wenn es in der Zeit erscheint, so deshalb, weil sie codiert worden ist, weil eine Art Zeitprogramm geschrieben worden ist.
Verzeihen Sie mir diese etwas abstrakten Bemerkungen, die ja auf eine Art Philosophie der Festplatte hinauslaufen oder auf das, was man anderweitig, im alten Zauberglauben, virtual reality nennt. Als ob da wirklich etwas Neues hinzukäme und als ob es nicht um eine Art und Weise geht, sich durch abgespeichertes Material zu bewegen (was ja auch Lieschen Müller, die sich durch die Kanäle zappt, ihrerseits längst praktiziert: denn auch sie folgt nicht mehr dem ABC des Programms, sondern der Bewegungslogik, wie sie auf der Festplatte vorgezeichnet ist: sie springt von hier nach da). Genau diese Veränderung der zeiträumlichen Erfahrung ist es, die uns zu unseren elektrischen Mönchen zurückführt, und die ich für den Kern der elektromagnetischen Schrift halte. Ich habe darüber ein ziemliches langes Buch verfasst, das den Titel trägt: Metamorphosen von Raum und Zeit. Eine Geschichte der Wahrnehmung und da geht es um diese Fragen. Wenn es Sie interessiert, was ich dazu zu sagen habe, lesen Sie's, ansonsten kann ich Sie nur bitten, meine kryptischen Kürzel hier zu entschuldigen. Gehen wir aber zurück an den Ort unserer Schrift, ins Tonstudio, oder besser noch: setzen wir uns an den Computer. Dorthin also, wo wir unseren Klangzeichenkörper bearbeiten. Wie abgespeichert behauptet er noch immer, ICH BIN'S, aber natürlich ist er (in meiner Wahrnehmung) längst zu einem anderen geworden, zum bloßen Sound und weil das so ist, scheuen wir uns nicht mehr, ihn zu verdoppeln, mit Volumen aufzupumpen, ihn schrumpfen zu lassen, ihn zu zerknautschen oder ihn crashartig mit einem anderen Zeichenkörper kollidieren zu lassen. Sie sehen: das ist eine Terminologie, die vor keiner Ethik-Kommission bestehen würde, nichtsdestoweniger hängen höchst gegenwärtige Fragen daran. Was ist das für ein Menschenbild? Was ist ein Urheber? Was ist ein Instrument? Was überhaupt ist Arbeit, wenn sie, in den Computer eingespeist, im Museum der Arbeit verschwindet? Wenn Sie mit dem Material auf die beschriebene Art und Weise gearbeitet haben, so haben sich Ihnen unweigerlich all diese Fragen gestellt. Aus diesem Grund (und auch wenn dies wie eine Art unziemlicher Trivialisierung der höchsten Geistestätigkeit anmutet) würde ich nicht eine Sekunde zögern, zu behaupten, dass sich hier, in höchst praktischer Form, lauter wesentlich philosophische Fragen stellen: Fragen, deren Brisanz auch da liegt, dass sie sich nicht in der dünnen Luft der begrifflichen Abstraktion verlieren, sondern die handgreiflich das Denken verändern. All die Prozeduren, die man in der Bearbeitung von Klangzeichenkörpern elaboriert, markieren (wenn sie denn auf der Höhe der Zeit sind) soetwas wie eine äußerste Avantgarde des Denkens, vorausgesetzt, dass das, was hier mit Händen zu greifen ist, auch in den Begriff hinaufgehoben wird. Aber das ist bedauerlicherweise nicht der Fall. Es gibt (jedenfalls ist mir derlei nicht bekannt) keinen Versuch, diesen philosophischen Ort zu analysieren, ja es gibt nicht einmal die Anstrengung, zu einer Theorie des Samplers, oder besser: des digitalen Klangzeichens zu kommen. Das ist in Anbetracht dieser Revolution schon ein erstaunliches Faktum: eine fast unnatürliche, künstliche Stille. Wie die Stille auf einer CD.
Kommen wir zuguterletzt zu unserem Autor zurück. Was ist das Porträt des Autors, elektrisiert? Das ist zunächst einmal ein Abgesang: nämlich das Ende des Literaten, das Ende des Großschriftstellers und Weltenschöpfers, dem es gelingt, aus der Phantasie eine neue Welt entstehen zu lassen, schwarz auf weiß. Unser Autor, elektrisiert, wechselt die Schrift (was im übrigen, wie das Beispiel des Mittelalters zeigt, gar nichts so Ungewöhnliches ist). Jedoch: diese neue Schrift (und das wollte ich mit dem Anfangsbild sagen) ist nicht ganz frei, sondern sie hängt an bestimmten Voraussetzungen. Sie hängt an der Elektrizität. Der elektrische Autor, dieser vereinsamte Nachfahr der elektrischen Mönche, hat die Erfahrung gemacht, dass einer im anderen steckt – und dieser Erfahrung wegen wird er nicht mehr sagen können: ICH BIN DER ICH BIN. Als einer im anderen wird er versuchen, das andere sich einzuverleiben, ebenso wie er versuchen wird, das eigene ins andere zu überführen, er wird die Modi seiner Veränderungen, die Zwischenräume und Transfers notieren. Der elektrisierte Autor ist jemand, der die Schwingungen von Dingen auffängt, ein großes Ohr, ein großes Auge. Jemand der aufnimmt und speichert. Bilder, Töne, Empfindungen. Man mag das Synkretismus nennen, aber das trifft nicht den Punkt. Denn es bleibt ja nicht bei der Aufnahme und der geliehenen Form, sondern es geht darum, wie diese Zeichen neu zusammengesetzt werden. Der elektrisierte Autor wird derjenige sein, der die aufgenommenen Bilder, Töne und Empfindungen wiederhört und der sie im Wieder- und Wiederhören zu analysieren vermag, der eintaucht in die ihm zugängliche Schrift. Der beginnt, ein Ohr fürs Hören, ein Auge fürs Sehen zu entwickeln. Der, am Material selbst, geschult wird: feiner hinzuhören, genauer zu schauen. Nur diese Erfahrung mit der Schrift und nichts anderes vermag ihn zu autorisieren, wird ihm das Recht geben, sich Autor zu nennen.
Sie sehen: mein Porträt des Autors, elektrisiert hat wenig zu tun mit dem Textlieferanten, der sich durch den Hintereingang in die großen Häuser hineinschmuggelt und dort, demütig, seine Lieferung abgibt. In diesem Bild verunklart sich überhaupt, wo die Grenze des Autors ist, was ihn vom Tonmeister, vom Regisseur usf. unterscheidet. Diese usurpatorische Tendenz jedoch ist, wenn ich die Rede vom Ort der Schrift ernst nehme, eine Zwangsläufigkeit. Denn analysieren wir, wie der elektromagnetische Schrieb eines Hörspiels bislang verfertigt wird, so haben wir es mit einem sehr komplizierten und streng arbeitsteiligen System zu tun, bei dem eine ganze Reihe von Personen beteiligt sind. Und wie das Leben so ist: Je mehr daran mitwirken, desto zweifelhafter das Ergebnis. Diese Art zu schreiben läuft immer auf Schwundformen hinaus, dort zumindest, wo die Beteiligten einander nicht zu elektrisieren vermögen, sondern sich nur noch langweilen miteinander. Vor diesem Hintergrund ist es kein Zufall, sondern fast eine inne Notwendigkeit, dass das Medium bislang nicht zu jenem Punkt gekommen ist, der wesentlich ist: zur Idee der Klangzeichenschrift. Audio Art.
Sich der Erfahrung des Klangzeichens auszusetzen, ist für mich stets die große Verheißung des Mediums gewesen. Dazu jedoch gilt es aber, sich aller Vorurteile zu entledigen: als ob man wüsste, was ein Text ist, was eine Musik, was ein Geräusch. Genau das – und das ist meine Botschaft – ist hier noch keineswegs ausgemacht. Tatsächlich ist das Klangzeichen als solches erst einmal weitgehend indifferent, wird ihm durch seinen Gebrauch angewiesen, als was es erscheint: Text, Geräusch oder Musik. Das so begriffene Klangzeichen überhaupt ist ein Novum. Man hat es mit einem neuen Zeichenkörper zu tun, über den noch wenig zu sagen ist, den es erst einmal zu begreifen und zu verstehen gilt. Ich weiß nicht, wozu dies im einzelnen führen wird, ich weiß nur, dass das, was zuvor amorph war, als bloßes Geräusch, erlebt wurde, erkenntlich wird als ein komplexes Ereignis: es bekommt Körper. So wie der Körper in der Malerei des 15. Jahrhunderts einen Schatten bekommt, so erhält der Klangzeichenkörper ebenfalls einen Schatten, Hunderte davon.
Dieser Zustand radikaler Neuheit ist in einer Welt, die in so vielem zum Ende gekommen ist, ein wunderbarer Zustand und doch auch etwas, was vielleicht am allermeisten Angst einflößt. Und die Widerstände (um abermals einen Terminus aus der Elektrizität herbeizuzitieren) sind beträchtlich. Sie liegen nicht nur bei denjenigen, die sich in ihrem Besitzstand bedroht fühlen, sie reichen auch weit übers Hörspiel hinaus. Aus irgendeinem Grund haben wir es uns angewöhnt, jene elektromagnetischen Gespenster, die wir auf den Plan gerufen haben, als Simulacren zu verachten, wir sprechen von »Simulation« und meinen damit das Gegenteil des Realen. Aber schauen wir uns um, so können wir doch sehen, dass sich unsere Welt mit solchen Simulationen zunehmend anfüllt. Von Simulation in diesem abschätzigen Sinne zu sprechen, heißt: sich der neuen Schrift zu verweigern. Der elektrisierte Autor wird sie als Teil seiner selbst auffassen müssen, er wird sich einüben müssen in eine Ästhetik, die das Wort Simulation als einen Ehrentitel auffassen wird.
Ich danke Ihnen.
Éducation sentimentale IV
English Version Wer kennt das nicht? Diesen Augenblick, da der RECORD-Schalter zu blinken beginnt und signalisiert, dass die Aufnahme läuft. Und nicht selten, in einer professionellen Umgebung zumal, geht dies mit einem Moment der Panik einher: Zu wissen, dass von nun an jeder Lapsus, jeder Versprecher festgehalten wird. Folglich beginnt die Stimme zu zi…
Éducation sentimentale III
Was macht ein Kind der Popkultur, wenn es sich urplötzlich, in Gestalt von Vaterschaft und Lehrverpflichtung, in einer Rolle findet, für die es kein Drehbuch gibt? Es begann mit einem simplen Ansinnen, der Frage eines Hörfunk-Redakteurs, ob ich mit ihm gemeinsam ein dreiwöchiges Intensivseminar an der Berliner Hochschule der Künste durchfüh…
Die Berliner Hörspieltage waren eine jährliche Veranstaltung der ARD, bei der die Landesrundfunkanstalten der Öffentlichkeit zeigen konnten, was sie mit ihren Steuergeldern unterstützten; Teil der Veranstaltung war ein Treffen der Chefredakteure, ihrer Assistenten, Autoren und Techniker mit verschiedenen Präsentationen und Besprechungen.
Burckhardt, M. - Im Blinden Fleck der Öffentlichkeit: Zur Situation des Hörspiels, Rundfunk und Fernsehen 2/1994. Rundfunk und Fernsehen war eine Publikation des Hans-Bredow-Instituts.
Burckhardt, M. Digitale Metaphysik. Merkur, No. 431, April, 1988. Englische Übersetzung zu Ex nihilo unter: Burckhardt, M. Digitale Metaphysik. Merkur, No. 431, April, 1988. Die Englische Übersetzung, mit Anmerkungen, finden Sie unter Ex nihilo bei: Burckhardt, M. Digitale Metaphysik. Merkur, No. 431, April, 1988.
Burckhardt, M. Im Arbeitsspeicher – Zur Rationalisierung geistiger Arbeit. In: König, H., von Greiff, B., Schauer, H. (eds) Sozialphilosophie der industriellen Arbeit. LEVIATHAN Zeitschrift für Sozialwissenschaft, vol 11. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, January 1990. https://doi.org/10.1007/978-3-663-01683-0_15. Die Englische Übersetzung, mit Anmerkungen, finden Sie unter Ex nihilo bei: https://martinburckhardt.substack.com/p/in-the-working-memory
https://www.merkur-zeitschrift.de/artikel/die-universale-maschine-a-mr-44-12-1067/. Die Englische Übersetzung, mit Anmerkungen, finden Sie unter Ex nihilo bei:https://martinburckhardt.substack.com/p/emergence-of-the-psychotope
Historisch gesehen: Ende 1993 (ein Jahr zuvor) erblickte der Mosaic-Browser das Licht der Welt, und im Oktober 1994 kam der Netscape Navigator auf den Markt und markierte damit den Beginn unserer mit dem Internet verbundenen Gesellschaft und ihrer kulturellen Auswirkungen.
Die englische Übersetzung von Porträt des Autors, Elektrifiziert: Über den Übergang vom mechanischen zum elektromagnetischen Schreiben, mit Anmerkungen, finden Sie unter Ex nihilo bei: https://martinburckhardt.substack.com/publish/post/137870755#footnote-anchor-14