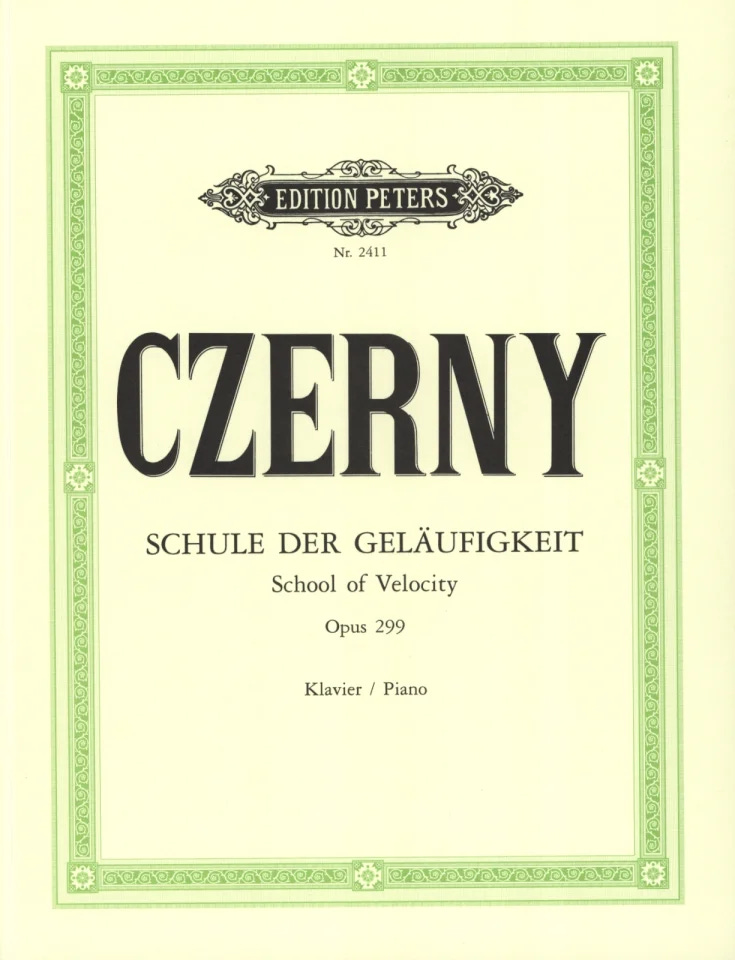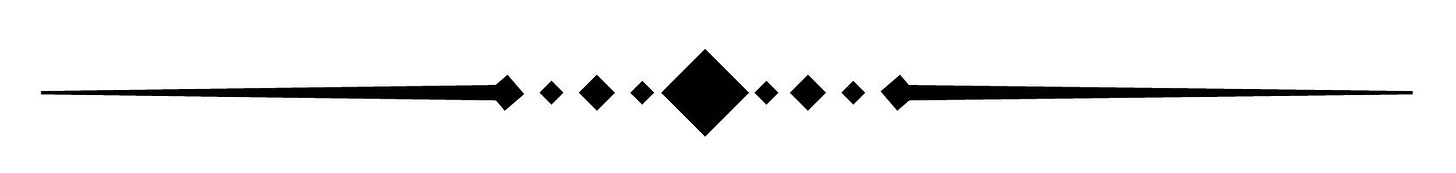Weil mein Vater, als gerade 18jähriger, im Zweiten Weltkrieg ein Bein verloren hatte, war mir das Phänomen des Phantomschmerzes, horribile dictu, von Kindesbeinen an schon vertraut. Wenn ich nach dem Aufwachen ins Elternschlafzimmer ging und zu ihm ins Bett kroch, über die Krücken hinweg, die neben dem Bett lagen, sah ich seinen bloßen Stumpf. Der Anblick war nicht ungewohnt, hatte auch nichts Schreckliches an sich. Manchmal passierte es, dass er vor Schmerz zusammenzuckte. Und als ich, das Kind, ihn fragte, wo es denn weh tue, sagte er, dass ihn der Fuß schmerze, und deutete auf eine Stelle, wo nichts war, nur das Bettlaken. Er sagte, dass es die Nerven seien, die schmerzten und dass dies keineswegs ungewöhnlich sei. Viele der jungen Männer, denen man im Lazarett ein Bein abgenommen hätte, litten darunter. Ich erinnere mich, dass ich, während er mir all dies erklärte, bloß begriffsstutzig auf seinen Beinstumpf schaute und dann auf den Faltenwurf des Bettlakens und fragte, ob er denn genau die Stelle spüren könne, wo es weh tue. Ja, sagte er und deutete mit dem Finger aufs Laken: genau hier. Und so begriff ich, noch bevor ich lernte, was ein Phantom ist, dass ein Phantom eine schmerzende Abwesenheit ist.
Mag der Phantomschmerz im Physischen eine unabweisbare Realität sein, bleibt die Frage rätselhaft, wie sich eine Verlusterfahrung im Symbolischen artikuliert. Was passiert, wenn es in der Sphäre der Werte, des Selbstverständnisses und der Identität zu einer Form der Amputation kommt? Begreift sich derjenige, der von einem solchen Schicksalsschlag heimgesucht wird, wirklich als Invalide, oder gelingt es ihm, sich über den Verlust des fehlenden Gliedes hinwegzutäuschen? Nun kommt einem solchen Abwehrverhalten zugute, dass man in der Sphäre abstrakter Moralitäten operiert - und dass es im Wolkigen, in Ermangelung einer physischen Prägnanz, kein Vorher-Nachher gibt, geschweige denn, dass der Betreffende beim Erwachen realisieren muss, dass er ein Körperglied verloren hat. Denn anders als unsere Körperglieder können Formen, so rückständig sie sein mögen, über lange, lange Zeit fortwesen – und wie die Amish bezeugen, mag sich die Verleugnung der Gegenwart nachgerade zu einer Form der Religiosität auswachsen. Nähert man sich der Frage mit der Nüchternheit eines Soziologen, so ist klar, dass auch gesellschaftlich hoch valorisierte Funktionen an Wert einbüßen können – eine Einbuße, die ihre Träger kurz oder lang mit einem Status-, wenn nicht gar mit einem Jobverlust konfrontiert. In jedem Fall folgt dem Rationalitätsgewinn ein Rationalitätsverlust auf dem Fuße. Wenn Freud davon gesprochen hat, dass der Mensch im Fortschreiten der Kultur zu einem Prothesengott wird, ist damit gleichfalls gesagt, dass seine Menschennatur bestimmte, für selbstverständlich gehaltene Gliedmaßen einbüßt – was zu der der Schlussfolgerung führt, dass der Ratio notwendig auch eine chirurgische, versehrende Funktion innewohnen muss. Dass man lange über die Dialektik von Rationalitätsgewinn und -verlust hat hinwegsehen können, hat damit zu tun, dass sich diese Verschiebungen im Zyklus der Generationen abgespielt haben. Das Alter übernimmt die Verluste, die Jugend personifiziert die Innovation. Die Digitalisierung jedoch, mit der ein neuer Geisteskontinent ins Leben getreten ist, hat eine tiefe gesellschaftliche Erschütterung erzeugt, ein plötzliches Beben, bei dem sich, quasi über Nacht, für unerschütterlich gehaltene Gewissheiten in Nichts aufgelöst haben.
Eine frühe Erfahrung dieser Art, die nachgerade soetwas wie eine dunkle Epiphanie darstellte, wurde mir zuteil, als ich in den 80er Jahren im Tonstudio meinem ersten Sequenzerprogramm begegnete. Hatte ich, als junger Mann, über Monate hinweg, Czernys Schule der Geläufigkeit folgend, Tonleitern auf dem Klavier geübt, machte mir der Sequencer klar, dass man die eingespeiste Notenfolge mit der Drehung eines Knopfes auf Hochtouren bringen konnte – ein Umstand, der all meine Fingerübungsexerzitien sinnlos erscheinen ließ. Führte mir diese Erfahrung vor Augen, dass das Virtuosen-Ideal seine große Zukunft hinter sich hat, wartete das Tonstudio mit einer zweiten, vielleicht noch radikaleren Erfahrung auf – der Einsicht nämlich, dass die vollkommene Beherrschung eines Instrumentes eine Engführung darstellt, die das Klang-Sensorium auf ungebührliche, ja sinnlose Weise beschneidet. Denn insofern die Welt der Geräusche sich einem Sampler einverleiben ließ, war alles, ja war selbst der Klang einer Toilettenspülung zu einem Musikinstrument geworden. Darüberhinaus hatte sich auch die Notation des Musikalischen grundsätzlich geändert. Während ich früher, am Klavier sitzend, komponierend mich an meinen Partituren versucht hatte, war das Klangereignis nicht mehr die Note, die in der Partitur verzeichnet war, ein Ereignis auf einem Zeitpfeil, sondern etwas sehr viel Komplexeres. Urplötzlich nämlich hatte der Klang selbst eine Plastik angenommen, die sich in Spektogrammen, Fourier-Wellen-Analysen udgl. niederschlug, und war die Bearbeitung desselben im Symbolischen der Arbeit des Bildhauers vergleichbar, der aus dem amorphen Masse seine Rohmaterials eine Plastik erschafft.

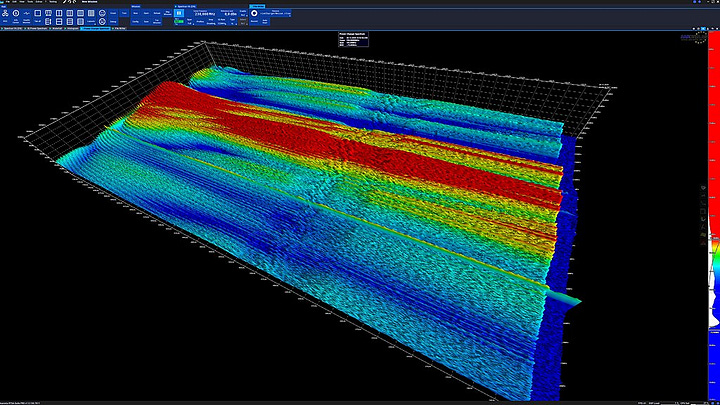
Die Frage ist: Wie reagiert eine Gesellschaft auf derartige, im Wortsinne, einschneidenden Veränderungen? Weil es dauert, bis derlei Veränderungen zur Kenntnis genommen werden, lautet die Antwort darauf: gar nicht. Weil man weitermacht wie bislang, bleibt business as usual die erste Bürgerpflicht – und weil die große Mehrheit der Trägheit des Wandels folgt, fällt es nicht schwer, die Veränderungen im Weichbild zu übersehen. Konsequenterweise nahmen die Tonmeister, die in den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten mit digitalem Gerät bestückt wurden, die neuen Arbeitstechniken gar nicht erst in Betrieb – oder sie gaben mir, der ich als Fremdkörper ihre heiligen Hallen betrat, zu verstehen, dass a) man sich nicht eingearbeitet habe, b) das Gerät des defekt und c) diese ganze Computerei überhaupt eine Seelenlosigkeit darstelle. Nimmt man all diese Ausreden in den Blick, ist unübersehbar, dass hier jene psychologischen Abwehrmechanismen am Werk sind, welche die Psychoanalyse seit einem guten Jahrhundert katalogisiert hat: die Abspaltung (das Nicht-zur-Kenntis-Nehmen), die Entwertung (der seelenlose Computer), die primitive Idealisierung (welche das Machine Learning zu einer gottähnlichen, transhumanistischen Intelligenz aufbauscht), die Verleugnung, die umso überzeugender ausfällt, wenn sie sich der Gruppe und des chorischen Sprechens bedient.
Nun stellt die Digitalisierung keine graduelle Veränderung dar, sondern nachgerade so etwas wie ein seismisches Beben: einen Fremdkörper, der in unserem Denken einschlägt wie ein extraterrestrischer Komet. Damit aber unterliegt das ganze Feld des Wissens dieser Erschütterung, bricht sich ein neuer Geisteskontinent Bahn. Sind die meisten Zeitgenossen als Konsumenten der Meinung, dass dies ein überaus begrüßenswerter Zustand ist, so beschleicht sie überall dort, wo ihnen dieses neue Denken nicht als Gewinn, sondern als Rationalitätsverlust auf den Leib rückt, ein tiefes Unbehagen. Hier kommt eine Problematik ins Spiel, welche über die üblichen Rationalisierungsmaßnahmen weit hinausweist. Denn insofern der Computer eine universale Maschine ist, die ihrerseits Programme nach ihrem Bild entlässt, ist die von ihm ausgehende Drohung uferlos – und der Erfahrung vergleichbar, dass sich die ganze Welt, ja, dass sich jedes noch so bescheidene Geräusch zum Musikinstrument gewandelt hat. Folglich vermögen die Opfer dieser Rationalitätsdrohung die Gefahr nicht zu orten, sondern müssen stattdessen konstatieren, dass ihnen das eigene Geistesgebäude unheimlich geworden ist (eine Form des Befremdens, die im Horrorfilm mit dem Einsetzen eines untergründigen Rumorens, eines amorphen Sounds einhergeht). Weil, wie Freud gesagt hat, der Einzelne nicht mehr „Herr im eigenen Hause“ ist, wird das Eigene fremd, findet so etwas wie eine Evakuierung des Selbstverständnisses statt. In diesem Sinn verliert der Virtuose seine virtù, muss er gewärtigen, dass in der Virtualität eine ganze Armada von Instrumenten hinzugekommen ist. Erinnern wir uns an den Ausgangspunkt dieses Textes, könnte man sagen, dass man es mit einem ortlosen Phantomschmerz zu tun hat, einem Schmerz, der kein bestimmtes Körperglied, sondern den Kern des Bei-sich-selber-Seins affiziert. Dabei ist es wenig beruhigend, dass das Inventar des Hauses und die Äußerlichkeiten noch weitgehend unverändert erscheinen. Denn das Umheimlichwerden des Geistesgebäudes stellt eine Form des horror vacui dar. Und dieser ist schon deswegen so furchterregend, weil sich dem Schrecken kein Übeltäter zuordnen lässt, sondern weil man weiß, dass diese Instanz auf breiter Front, nein, allüberall zuschlagen kann. Was ja nichts anderes als die Verheißung des Digitalen ist: Anything. Anytime. Anywhere.
Fasst man das Unheimlichwerden des überkommenen Geistesgebäudes ins Auge, werden die Schutz- und Absicherungsmaßnahmen verständlich, zu welchen seine Bewohner Zuflucht nehmen. Ja, es lässt sich sagen, dass ein Großteil unserer gegenwärtigen Diskurskalamitäten von einem solchen Phantomschmerz gespeist zu sein scheint. In jeden Fall wird nachvollziehbar, dass und warum der Kulturkrieg sich auf Fragen der Identität und der Identitätspolitik kapriziert, und warum man sich, anstatt über konkrete Probleme zu sprechen, beständig ins Feld des Moralischen verirrt. Denn wenn man Marshall McLuhans Bemerkung, wonach moralische Empörung eine Methode ist, um auch dem Idioten Würde zu verleihen, weniger als boshafte Charakteristik denn als Ausdruck eines Privationsgeschehens, ja einer tiefen Entwürdigung begreift (wohlgemerkt: der altgriechische idiotes geht auf das Eigene, Persönliche zurück), wird nachvollziehbar, dass die Moralisierung einen Versuch darstellt, des Unheimlichen Herr zu werden. Über das ad hominem Argument nämlich hat man dem horror vacui aus der eigenen Psyche verbannt – hat man einen Gegner dingfest gemacht. Aber weil dieser Gegner nichts weiter als ein invertiertes Spiegelbild ist und weil er, wie man selbst, nicht mehr Herr im eigenen Hause ist (oder wie Theodor Däubler gesagt hat: Der Feind ist meine eigene Frage in Gestalt), muss der perhorreszierte Andere nachgerade phantastische Statur annehmen, wird er zum diabolon, zum Erzwidersacher und zum Feind des Menschengeschlechts aufgebauscht.
Dieser Gang ins Phantasma führt uns zum Anfang zurück, zu der Frage nämlich, wie sich der Phantomschmerz im Symbolischen einhegen lässt? Denn während mein Vater, in der offenkundigen Abwesenheit seines verlorenen Körperglieds, genötigt war, sich mit dem Verlust abzufinden, gestattet der im Symbolischen empfundene Phantomschmerz dem Betreffenden, sich über die Unwiederbringlichkeit des Verlustes hinwegzutäuschen. Man zieht sich ein makelloses Identitätskostüm über und macht für alle Unstimmigkeiten den aushäusigen Gegner verantwortlich. Wäre er unschädlich gemacht – so die Lehre –, dann wäre das Elend vorüber, dann wäre alles wieder wie zuvor. Weil aber die Quelle des Unbehagens (der digitale Geisteskontinent) nicht aus der Welt zu schaffen ist, lassen sich die Phantomschmerzen nur dadurch betäuben, dass man sich einem stärkeren Sedativ, einer Form der Phantomlust hingibt. Hier könnte man an Marx’ berühmte Bemerkung erinnern:
Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes.
Nimmt man die zeitgemäßen Ideologeme in den Blick, fällt auf, dass sie allesamt eine Form der Phantomlust darstellen und sich in der Sedierung ortloser Ängste erschöpfen. Von daher ist die zeitgemäße Apokalyptik, die sich an der Angst vor der dräuenden Klimakatastrophe entzündet, das perfekte Phantasma. Auf diese Weise nämlich schlägt das innere Leeregefühl in eine Form der Selbstwirksamkeit um, mag man sich als Prophet und Missionar wähnen, welcher der verblendeten Welt (mit all ihren Fossilen) die Umkehr predigt. Und mit der Reinheit der Lehre, die keinen Widerspruch duldet und ihre Kritiker als Leugner und Apostaten geißelt, ist auch das Moment der Gemeindebildung gegeben – mag die letzte Generation sich als Schar der Berufenen wähnen, welche die Welt vor der Katastrophe bewahren. Dass es bei alledem weniger um die Sache, als um die eigene Befindlichkeit geht, macht klar, dass man hier nicht im Felde der Ratio agiert, sondern dass es allein darum geht, den Phantomschmerz der versehrten Identität zu betäuben. Und wie einfach dies ist: Man geht ins Museum und beschmiert die Mona Lisa mit Suppe, oder man zieht sich einfach ein T-Shirt über, auf dem in großen Lettern zu lesen ist: I’m Number One. Why try harder! Hat man diesen Impuls im Blick, versteht man, dass und warum die postmoderne Gesellschaft sich in Identitätspolitik, Oikophobie und Klimaapokalypse ergeht – und warum man umgekehrt nicht die geringste Mühe unternimmt, sich den Rationalitätsgewinnen der digitalen Welt zu verschreiben. Denn der Gang in die Produktivität hieße, dass man, statt ein Orchester liebgewordener Teufel dirigieren zu wollen, sich mit dem Unerhörten beschäftigen müsste.
Themenverwandt
The Identity Trap
This is a translation of a conversation which was being held in German. The video can be seen here: Martin Burckhardt: Your book The Identity Trap reminded me a little of Susan Neumann's last book, with whom I had a long conversation about on Ex nihilo. Her book, like yours, deals with an ideology commonly referred to as
Im Gespräch mit ... Klaus Vondung
Wie gestaltet sich ein Gespräch über die Apokalypse? Wie könnte es anders sein? Heiter. Denn wenn man sich nicht im mysterium tremendum ergeht, in Heulen und Zähneklappern, zeigt sich, dass die Apokalypse ein intellektuell höchst anregendes Feld ist – und weil man sich hier keine göttliche Offenbarung, sondern Aufklärung über die sonderbare…
Tat ohne Täter
Wenn Meister Eckhart den schönen Gedanken formuliert hat, dass Gott einfach sei, so ist damit gemeint, dass jedes komplexe System auf grundlegende Einsichten zurückgeht – und sich damit als das entpuppt, was Thomas Bernhard in einem wunderbaren Titel zusammengefasst hat: einfach kompliziert. Aus dieser Warte betrachtet wohnt jedem Geda…