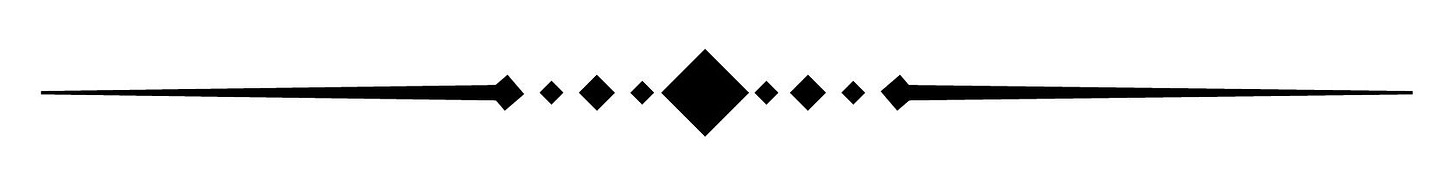Vor nicht allzulanger Zeit rauschte eine Meldung durch den Blätterwald (der sich heutzutage, in Ermangelung des nötigen Papiers, längst zu einem elektronischen Rauschen aufgelöst – oder, wenn man so will, verpixelt hat) – und zwar ging es dabei um das sonderbare Arbeitsverhalten der Generation-Z, jener Alterskohorte mithin, die sich eine Welt ohne Internet gar nicht mehr vorstellen kann. Was also war das Problem? Die Antwort lautet: »Taskmasking«. Damit ist ein Gebaren gemeint, bei dem Arbeitseifer lediglich vorgetäuscht wird – der Arbeitnehmer sich in Wahrheit jedoch dem Studium seiner Dating-App oder seines Live-Feeds widmet. Dass die Praxis weitverbreitet zu sein scheint, ist ablesbar an der Beitrags-Lawine, die auf TikTok nützliche Videotipps für ein solches Produktivitätstheater offeriert. Ein paar Beispiele: So möge der Simulant, um Arbeitseifer zu demonstrieren, möglichst geräuschvoll auf seinem Keyboard herumtippen; ebenso hilfreich sei es, laute Grunzlaute von sich zu geben, mit angestrengtem Gesicht und aufgeklapptem Laptop durch die Flure des Unternehmens zu geistern oder laute Gespräche am Wasserspender oder der Kaffeemaschine zu führen. Zudem ermangelte es nicht an nützlichen Hinweisen, mit denen die eigentliche Beschäftigung der Arbeitnehmer (Check der eigenen Dating-App beispielsweise) mit einem Keyboard-Shortcut maskiert werden kann. Nun ist es ein Leichtes, sich über die mangelnde Arbeitsmoral der »Schneeflocken« zu echauffieren, gleichwohl scheint es, als stünde man hier dem Symptom einer sehr viel tiefer gehenden Verwerfung gegenüber. Denn wenn man etwas simulieren muss, ist es nicht mehr da – und wenn Produktivitätstheater zu einem Desiderat am Arbeitsplatz wird, scheint es mit der Produktivität selbst nicht mehr weit her zu sein – ist man genötigt, zur Vortäuschung falscher Tatsachen zu schreiten.
Tatsächlich schlägt sich die Krise der Produktivität längst in den Statistiken nieder. Seit geraumer Zeit schon haben die Industriegesellschaften zur Kenntnis nehmen müssen, dass, die digitale Welt ausgenommen, das Wirtschaftsleben sich in einem steten Sinkflug befindet. Verzichtete man auf die ökonomischen Interventionen gegen die Zombie-Ökonomie, würde sich dieser in einen jähen Sturzflug verwandeln. So besehen hat sich das Produktivitätstheater längst im Alltag eingehaust, ist ein jeder bestrebt, das Potjemkinsche Dorf namens Normalität aufrechtzuerhalten. Und hält man sich vor Augen, dass ein Großteil der heutigen Arbeitsplätze, einmal digitalisiert, kurzerhand verschwinden könnte, ist das Produktivitätstheater der Generation Z durchaus nachvollziehbar. Von daher könnte man darin nur den jugendlichen Überschwang jener Verhaltensänderung erblicken, welche die Soziologen die stille Kündigung (quiet quitting) genannt und als fundamentalen Wertewandel begriffen haben. Als Begründung dafür wird angeführt, dass die Arbeit – so wie man zu praktizieren sie genötigt ist – nicht das Leben ist, ja, dass der Wert eines Menschen sich nicht über seine Produktivität definiert. Nun sind diese Widerstandsformeln, die, je nachdem, eine Work-Life-Balance oder eine abstrakte Menschenwürde beschwören, wenig hilfreich, wenn man die Gründe analysieren möchte, die zur allgemeinen Produktivitätskrise geführt haben. Denn wechselt man die Perspektive und schlägt sich, für einen Moment nur, auf die Seite des Konsumenten, so muss man zur Kenntnis nehmen, dass jeder Bequemlichkeitszuwachs mit Genuss zur Kenntnis genommen wird – und dass der Konsument nicht das Geringste an einer Perfektionierung des Angebots einzuwenden hat. In diesem Sinne findet es niemand moralisch entwürdigend, wenn man, statt selbst einen Vortrag zu verfassen, eine solche Arbeit der Künstlichen Intelligenz von ChatGPT überlässt. Tatsächlich ist das copy-paste in einem solchem Maße gesellschaftsfähig geworden, dass einzelne Hochschulen wie die Karls-Universität in Prag die Lektüre von Bachelor-Arbeiten kurzerhand als obsolet deklariert haben, wissend, dass man letztlich nur computergenerierte Texte zu lesen bekommt. Und nimmt man diese Perspektive ein, könnte man geradezu zu einer paradoxen Schlussfolgerung kommen – nämlich dass die Krise der Produktivität mit einer Entfesselung der digitalen Produktivkraft einhergeht.
In Anbetracht eines solchen Befundes wäre die Frage zu stellen, ob das, was man als Produktivitätskrise diagnostiziert, nicht das Symptom einer sehr viel tiefer gehenden Erschütterung ist, nein, mehr noch: ob unsere Bewertungsmaßstäbe den neuen Verhältnissen überhaupt angepasst sind. Dies wird deutlich, wenn man, der alten Kapitalismusformel „Zeit ist Geld“ eingedenk, sich die Frage vornimmt, ob die Stunde noch das Metrum ist, mit dem sich Produktivität messen lässt – oder man es bei diesem mechanischen Zeitmaß nicht mit einem vollständig obsoleten Konzept zu tun hat. Wenn ich, vor mehr als dreißig Jahren, den Computer als einen Zeitspeicher, ja, als Museum der Arbeit begriffen habe, so hat dieser Gedanke unterdes eine gesellschaftliche Virulenz angenommen. Wie problematisch dieses Grundmetrum ist, wird sichtbar, wenn man etwas so Simples wie eine Schulstunde als Beispiel heranzieht. Einerseits hat sich hier seit Dekaden so gut wie gar nichts geändert, andererseits entlässt das Bildungssystem eine wachsende Zahl funktionaler Analphabeten – versagt also in der Vermittlung von Fähigkeiten, die vor einer oder zwei Generationen eine Selbstverständlichkeit gewesen sein mögen. Wie also sah die Welt aus, als der Schulunterricht seiner Aufgabe noch nachkommen konnte? Vorn an der Tafel stand der Lehrer (der sich, dieser herausgehobenen Position als Repräsentant der Wissensordnung begreifen konnte) und vor ihm saßen die Schüler, genauer: eine ganze Klasse. Übersetzt man dieses Setting in eine informationstheoretische Begrifflichkeit, so haben wir einen Sender und eine ihm zugeordnete Empfängerschar, one-to-many. Streng genommen bringt dieses Setting die gesellschaftliche Logik der Zentralperspektive auf den Punkt, eine Triangulation, bei der der Lehrer, als eine Art Imago, die Schüler hinaus ins Leben, oder genauer: in den Wissensraum führen soll. Folgen sie dem vorgegebenen Pfad, so eröffnet sich ihnen, von Universitäten ordiniert und mit den entsprechenden Scheinen versehen, ihrerseits die Möglichkeit, als Experte eine ähnliche Position einzunehmen. Nun ist, wie das Lehrpersonal unserer Tage bezeugt, dieses Setting tief gestört. Denn wenn der Lehrer – wenn wir die informationstheoretische Begrifflichkeit bemühen wollen - auf Sendung gehen will, kann er keineswegs sicher sein, dass seine Schüler empfangsbereit sind. Dies hat nicht zuletzt damit zu tun, dass sich mit dem Smartphone ein konkurrierender Sender eingestellt hat. Selbstverständlich kann man zu Maßnahmen wie einem allgemeinen Handy-Verbot schreiten, jedoch ist damit nur die zugrundeliegende Problematik nur verdrängt, nicht gelöst. Dies wird sehr viel deutlicher noch, wenn wir die Begriffe ins Lateinische zurückübersetzen: Hier ist die Sendung als emissio, der Empfang als acceptio begriffen. Und letzteres macht deutlich, dass eine Botschaft ihren Empfänger dann und nur dann erreicht, wenn dieser sich empfangsbereit zeigt. Ist er anderweitig beschäftigt (»auf Sendung«) oder erscheint ihm das Angebot als nicht akzeptabel, ist jeder Informationsübermittlungsversuch zum Scheitern verurteilt. Von daher ist das intermittierende Smartphone nur das Stellvertreterprinzip einer kommunikativen Störung, die unseren gesamten Wissensraum erfasst hat. Und dieser betrifft nicht bloß die Schule allein, sondern erstreckt sich auch auf jene Bereiche, die höchste Expertise verlangen. Wenn der Wissenschaftsphilosoph Nicholas Murray Butler die Engführung des Wissens mit dem trockenen Diktum begleitet hat:
Eine Experte ist jemand, der immer mehr über immer weniger weiß, bis er alles über nichts weiß.
so macht dieser Gedanke deutlich, dass die Spezialisierung mit einer Form des Weltverlusts einhergeht – und dass man die Elaborate der Fachidioten mit höchster Vorsicht genießen muss. Wird der Spezialist damit zur Inkarnation eines atomisierten, auf ein Nichts zusammengeschrumpften Wissensraums, stellt das Smartphone einen Gegenpol dar – denn in Gestalt des Internets schließt es einen jeden Einzelnen, virtuell jedenfalls, an das Weltwissen an.1 Fortan kann ein jeder, der ein Smartphone in der Tasche hat, sich im Besitz desselben wähnen. Diese Verfügbarkeit des Wissens bewirkt eine gleich doppelte Entwertung: Zum einen wird das Wissen damit als beliebig und letztlich überflüssig erlebt, zum anderen kann auch derjenige, der seinen sozialen Status darauf aufgebaut hat, nicht mehr auf eine breite Akzeptanz rechnen. In diesem Sinn löst die Digitalisierung die über Jahrhunderte etablierte Ordnung der Repräsentation auf. Wie die Feudalfürsten ihrer Privilegien verloren, gehen auch die Repräsentanten (die Wächter der Bildung, des guten Geschmacks etc.) ihrer Vorrechte verlustig. Es kommt zu einer emissio ohne acceptio – während umgekehrt der Einzelne, auch dort, wo es ihm an der nötigen Expertise ermangelt, ein ungeheures Empowerment erlebt. Und weil der Copy-Paster sich nach Belieben aufrüsten kann, ist er nicht mehr auf Empfang, sondern auf Sendung gepolt. Dass er die Welt hinter dem Bildschirm nicht mehr zu lesen versteht, ficht ihn dabei nicht im Entferntesten an. Denn wie die beiden Sozialpsychologen Dave Dunning und Justin Kruger im Jahr 1999 festgestellt haben, neigen zutiefst inkompetente Menschen dazu, die eigenen Fähigkeiten maßlos zu überschätzen:
Wenn man inkompetent ist, kann man nicht wissen, dass man inkompetent ist […]. Die Fähigkeiten, die Sie benötigen, um eine richtige Antwort zu geben, sind genau die Fähigkeiten, die Sie benötigen, um zu erkennen, was eine richtige Antwort ist.
Wenn diese Krankheit unterdessen auch Landesherren und Bildungspolitiker angesteckt hat – so sehr, dass sie sich ihrer in aller Öffentlichkeit rühmen -, wäre zu schlussfolgern, dass der digitale Analphabetismus sich zu einer Zivilisationskrankheit ausgewachsen hat. Nur dass selbige nicht als solche begriffen wird, sondern als normaler Wahnsinn daherkommen kann. Wenn es reicht, die Expertise bloß zu simulieren, auf die gleiche Weise, wie die Gen-Z ihren Arbeitseifer vortäuscht, ist man der Verlegenheit enthoben, einzugestehen, dass man, als digitaler Analphabet, die Gegenwart nicht mehr zu lesen vermag.
Aber kommen wir noch einmal auf die Frage der Schulstunde zurück – und fragen uns, was vonnöten wäre, um ein zutiefst gestörtes Bildungsprogramm zum Erfolg werden zu lassen. Wenn die Lutherbibel ihren Jesus sagen lässt: Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. (Offenbarung 22,1), gibt dies einen Hinweis darauf, dass die Kenntnis der Schrift das A und O darstellen sollte. Auf unser säkulares Zeitalter appliziert, hieße dies, dass ein Bildungsprojekt dann erfolgreich ist, wenn es den Empfänger zum Sender werden lässt, zu demjenigen, der sich über die Logik der digitalen Schrift im Klaren ist. Dass dies nicht mit der Logik des Wisch-und-weg erledigt ist, versteht sich von selbst – desgleichen, dass hier ein langer und komplexer Bildungsweg im Raum steht. Und weil es bei alledem um eine Alphabetisierungsmaßnahme geht, stellt sich die Frage, wie man einer Schulklasse, die aus lauter unterschiedlichen Kindern besteht, die nicht auf Empfang, sondern auf Sendung aus sind, den Weg von A nach B ermöglicht. Denken wir uns also einmal einen idealen Pädagogen, der willens und fähig wäre, seinen Schüler auf eine solche Reise mitzunehmen. Dieser müsste sich zunächst einmal klar darüber sein, dass die im Smartphone aufgebahrte Wissensmaschine ein Konkurrent erster Ordnung ist – und dass er in seiner Mission nur dann erfolgreich sein wird, wenn er die acceptio seiner Mündel bekommt. Hier kommt eine weitere, grundstürzende Problematik hinzu. Nicht bloß, dass er in diesem Augenblick mit der Faszinationskraft der Computerspiele zu konkurrieren genötigt ist, darüberhinaus hat das Smartphone seine Schülern mit dem Phantasma der Autonomie begabt – nämlich dass ein jeder glauben kann, nach seiner eigenen Façon selig werden zu können. In diesem Sinn hat er nicht mehr eine Klasse gleichgeschalteter Schüler, sondern eine Ansammlung von 30 freien Radikalen vor sich. Nimmt unser Idealpädagoge dies als die eigentliche Herausforderung an, bestünde das Gebot der Stunde darin, alle 30 Kinder von A nach B zu führen – eine Aufgabe, die im Extremfall darauf hinauslaufen könnte, dreißig unterschiedliche Wege zu finden und sie den Schüler auf eine solche Art und Weise zu präsentieren, dass die Aufgabe eine allgemeine Akzeptanz findet. Folgt man dieser Logik, bestünde die Stunde in Wahrheit aus einer Vielzahl höchst unterschiedlicher Wege, die sich nur auf der Seite des Konsumenten als eine Stunde darstellen, auf der Seite des Produzenten als t*n anfallen (wobei das n für die Anzahl der unterschiedlichen Wege steht). Nehmen wir diese Problematik ernst, ist evident, dass das Klassenzimmer, das alle Beteiligten zu einem Empfänger-Objekt gleichschaltet, an dieser Aufgabe scheitern muss. Ärger noch: weil man an der Logik des Frontalunterrichts festhält, gerät nicht einmal die Verschiebung des Wissensraum in den Blick. Nun liegt die Lösung dieses Dilemmas gar nicht fern – hat die Welt der Computerspiele doch demonstriert, auf welche Weise man höchst unterschiedliche Einzelwesen durch komplexeste Räume hindurch führen kann, und zwar ohne, dass man das Ziel aus den Augen verliert. Nehmen wir die Schlagworte der Gegenwart in den Blick (Gleichheit, Diversität, Inklusivität), ist evident, dass man dem nur nachkommen kann, wenn man sich keine Klasse gleichgeschalteter Individuen, sondern den Einzelfall vornimmt. So besehen wird die Stunde in eine Vielzahl von Trajektorien aufgesprengt, wird aus der psychophysischen Einheit – der Stunde in Zeit und Raum – eine Wissenslandschaft, bei der die Nutzer auf unterschiedlichsten Wegen das Ziel erreichen. Es ist evident, dass ein Zugang, der die physische Präsenz des Lehrers für das Allheilmittel hält, hoffnungslos rückständig ist, so sehr, dass er bereits an der Formulierung der Aufgabe scheitert. Sehr viel näher wäre unser Idealpädagoge an der Lösung des Rätsels, wenn er die Stunde als ein Computerspiel-Level begriff, das seine Schülern auf unterschiedlichsten Wegen zum Ziel führt, ja, dass ihre Neugierde zur acceptio werden lässt. Insofern bestünde die Kunst des Pädagogen darin, die Phantasma des Königswegs hinter sich zu lassen und sich auf die Blockaden, Hemmnisse und Vorprägungen seiner Schülerschar einzulassen. Auch hier könnte der Computer, der die Interaktionen der Nutzer speichert, ein großartiges Hilfsmittel sein – würde er unseren Idealpädagogen doch in den Stand setzen, all die Hindernisse in Augenschein zu nehmen, die einem Lehrerfolg im Wege stehen. Wenn die Griechen die Heuristik als ›Findekunst‹ aufgefasst haben, haben wir es hier mit einer Meta-Heuristik zu tun. Denn fortan geht es darum, all die unterschiedlichen Wege dingfest zu machen, die einen Schüler von A nach B führen.
Wenn das Beispiel der Schulstunde eines belegt, so, dass sich die Stunde nicht mehr als psycho-physikalische Einheit begreifen lässt. Wenn sie stattdessen eine Vielzahl von Trajektorien (Stunden-Lesarten) in sich trägt, ist sie eher einem Buch oder einem Film wesensverwandt – einem Kunstwerk mithin, das eine Vielzahl von Lesarten in sich birgt. Ganz abgesehen von dieser hermeneutischen Überdetermination, läuft die Übersetzung in die Virtualität auf eine Form der Abstraktion hinaus – lässt das Programm, das sich nach Belieben abrufen lässt (anytime, anywhere), ganz zwangsläufig Raum und Zeit hinter sich. Damit rückt der eigentliche Sinn der Schulstunde wieder in den Vordergrund: nämlich dass man es mit einem rite de passage zu tun hat, bei dem ein Nutzer einen vormals unbeschrittenen Weg von A nach B hinter sich bringt. In diesem Sinn wäre das Programm als eine Form der verdichteten Aufmerksamkeit zu begreifen, als ein Zeitspeicher, der es einem Nutzer erlaubt, seine Neugierde zu befriedigen. Und weil der Nutzer hier als Einzelwesen angesprochen wird, darüberhinaus seinem eigenen Zeitmaß folgen kann, lässt sich erahnen, dass ein solches Programm (das einen Vorschein auf die personal assistants der Künstlichen Intelligenz gibt) die Rolle eines Privatlehrers einnehmen wird, den sich der vermögende Bürger des 18. Jahrhunderts für seinen Nachwuchs leisten konnte. In jedem Fall löst es ein, was bislang nur ein pädagogischer Wunschgedanke ist: nämlich dass ein jeder dort abgeholt wird, wo er sich gerade befindet. Wenn man diese Forderung bislang nur mit der Herabsenkung des Niveaus beantwortet hat (»simples Deutsch«) , würde es die Individualisierung der Stunde erlauben, die Menschen mit hohe Auffassungsgabe in Hochgeschwindigkeit von A nach B zu befördern, während die Begriffsstutzigeren vielleicht einer intensiveren Betreuung bedürften, aber gleichwohl das erstrebte Ziel erreichen. Nimmt man die Idee des Zeitspeichers ernst, wird sichtbar, dass hier nichts Geringeres auf dem Spiel steht als ein Neu-Begreifen dessen, was man ehedem Produktivität genannt hat. Wenn die Ökonomen darunter den Output verstanden und diesen als Menge pro Zeitspanne definiert haben, ist klar, dass ein solch mechanischer Produktivitätsbegriff die behandelte Logik nicht wiederzugeben vermag. Weil man es nicht mehr mit Logistik, sondern mit Psycho-Logistik zu tun hat, besteht die Aufgabe des Produzenten nicht mehr darin, dass er irgendwo seine Zeit absitzt, sondern darin, zu jener Firm der Zeitverdichtung zu gelangen, die es dem Empfänger seiner Botschaft erlaubt, von A nach B zu gelangen – und idealiter, als Omega-Mensch, selbst imstande zu sein, die Gesellschaft mit einem Mehrwert zu beglücken. Ökonomisch besehen geht es nicht mehr um eine Vervielfältigung gleichförmiger Objekte in immer kürzerer Zeit, sondern darum, komplexe Gedankenfiguren weiter noch zu verdichten – und auf diese Weise Zeitspeicher zu programmieren, mit deren Hilfe noch größere, bislang undenkbare Aufgaben zu bewältigen vermag. Wenn der Computer, als Zeitspeicher begriffen, mit einem Lidschlag Prozesse erledigen kann, die, von Menschen erledigt, Abertausende von Zeiteinheiten gekostet hätten, so mag dies als Vernichtung menschlicher Arbeit erscheinen – auf der anderen Seite aber kann die Logik des Zeitspeichers ungeheure Potenziale entfalten. Spätestens hier aber stellt sich die Frage, was denn das Metrum eines solchen Zeitspeichers ist. Die Gedankenfigur, die sich hier einstellt, ist uns hinlänglich vertraut – werden unsere Zeitgenossen nicht müde, so etwas wie nachhaltiges Wachstum einzufordern (eine Forderung, die in der Regel nichts weiter als eine leere, wolkiger Wunschphantasie ist). Ein Zeitspeicher wird dann als produktiv gelten, wenn er Prozesse, die arbeitsintensiv waren, an eine Maschine weg delegiert, zum anderen, wenn er neue und künftige Handlungsoptionen eröffnet, mehr noch, wenn er die Menschen, die sich seiner bedienen, befähigt, ihrerseits an einem solchen Upgrade mitzuwirken.
Kommen wir auf das eingangs aufgeworfene Produktivitätstheater zurück, so ist es kein Zufall, dass die Strategien des Taskmasking sich allesamt auf die Interaktion mit dem Computer beziehen – sei es, dass man sich grunzend und grimassierend durchs Purgatorium der Zahlen hindurch kämpft, sei es, dass man mit einem eleganten Shortcut verbirgt, dass man, anstatt produktiv zu sein, sich seinen Leidenschaften hingegeben hat. Die unfreiwillige Komik, die sich in einem solchen Gebaren artikuliert, macht nur sichtbar, dass die Arbeitswelt (das business as usual) längst die Form eines Potjemkinschen Dorfs angenommen hat. Von daher ließe sich der Übereifer unserer Bürokraten als Versuch begreifen, den Staatsbürgern die eigene Unersetzlichkeit vor Augen zu führen – wäre es vielleicht sinnvoll, sich die metastasierende Staatsmaschinerie als einen etwas übergewichtigen Tölpel vorzustellen, der laut auf seiner Tastatur herumtippt, dann mit aufgeschlagenem Laptop durch die Gänge des Unternehmens geistert, um schlussendlich am Kaffeeautomaten den Umstehenden eine nicht-enden-wollende Volksrede zu halten.
Dies reflektiert, ganz nebenbei, die Genese des Internets. Um der Wissensatomisierung entgegenzutreten und einen verbindenden Wissensraums zu etablieren, setzte sich Vannevar Bush, der wissenschaftliche Koordinator des Manhattan Projects, an die Konstruktion seiner Memex-Apparatur, einer intersubjektiven Wissensmaschine, welche die Pioniere des Arpanet zur Stiftung ihres Wissensraumes anregte.
Themenverwandt
Capitalism - Dead or Alive?
Der Kapitalismus ist tot (Er weiß es nur noch nicht) was published in 2018, the same year as Philosophie der Maschine and Eine kurze Geschichte der Digitalisierung, and is the fifth in the series of Martin’s New Works. Although audible only as background noise in Martin’s earlier works, the debate with Marx was omnipres…
Vom Missbrauchswert
Warum einen Vortragstext hervorkramen, der aus dem Jahr 1999 stammt? Vielleicht, weil er in struktureller Form etwas vorwegnimmt, was sich erst im Laufe der Zeit als soziales Phänomen eingestellt hat. Genau dieser Zusammenhang aber macht die Geschichte interessant: Denn wenn die Aufmerksamkeitsökonomie ihrerseits in eine Welt hineinf…