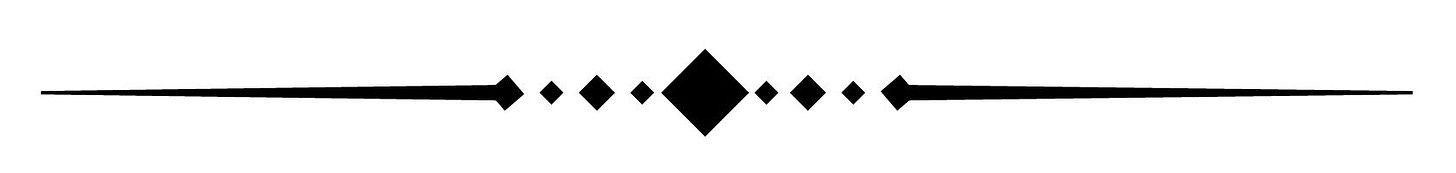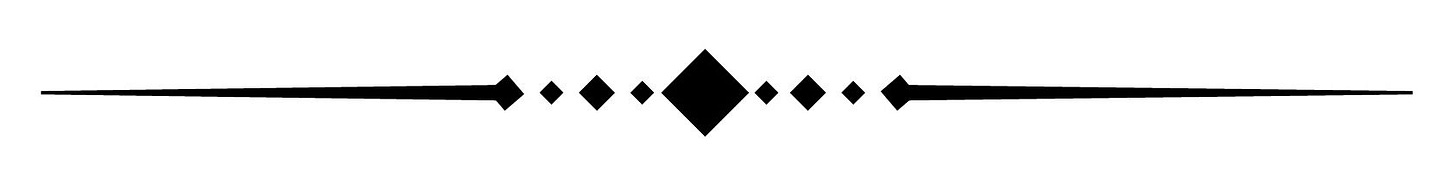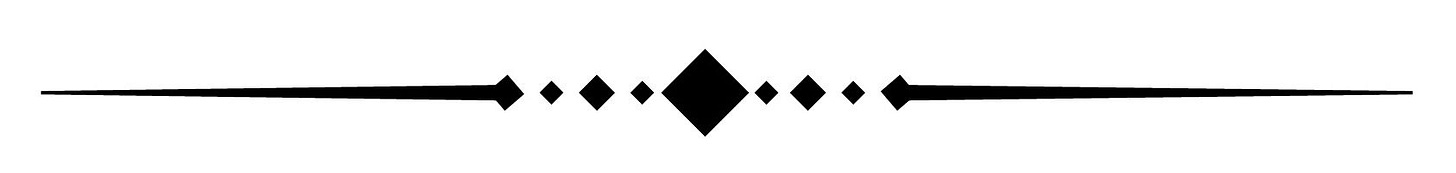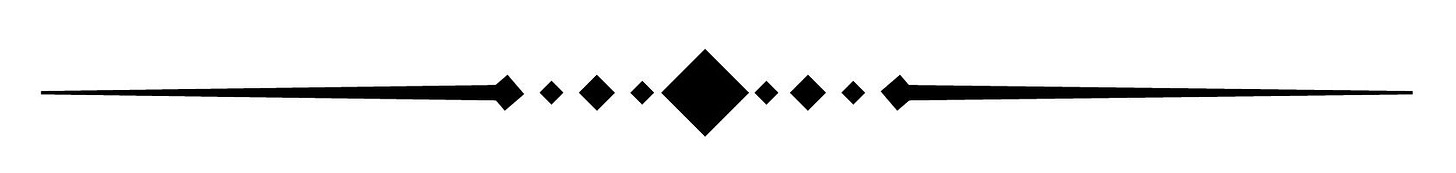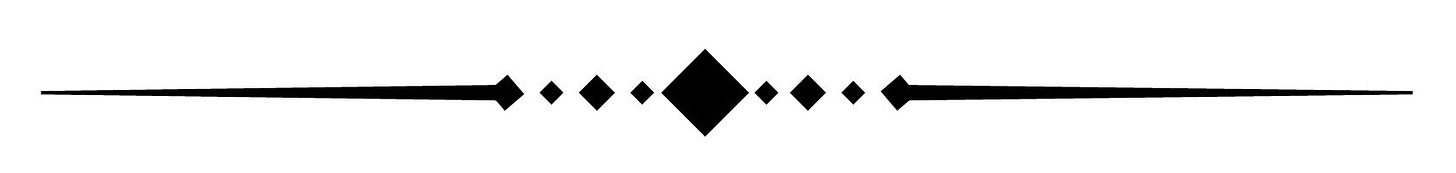Carl Schmitt und seine Erben
Es gibt Verwandtschaftslinien, die bizarr anmuten, zumal, wenn sie sich in ein und derselben Person wiederfinden. Zweifellos gehört Carl Schmitt in ein solches Register, und dies, obwohl er sich persönlich keinen großen Häutungen unterzogen hat, sondern sich in seiner Philosophie, von der Politischen Theologie bis hin zu seinen Spätschriften, weitgehend treu geblieben ist. Mehr als der Denker sind es also seine Anhänger, die den Eindruck einer heillos zersplitterten, ja geradezu multiplen Geistesgröße hinterlassen. Dass Carl Schmitt (der in der Weimarer Republik noch von den Kommunisten hofiert und von Walter Benjamin verehrt wurde), zum intellektuellen Steigbügelhalter der Nationalsozialisten werden sollte, ist eine Wendung, die sich noch mit der Hufeisentheorie erklären ließe, nach der die politischen Extreme einander berühren. Sehr viel sonderbarer aber ist, dass der Kronjurist des Dritten Reichs mit seiner Schrift zum Partisanen zum Stichwortgeber der RAF werden sollte. Denn deren Impuls bestand doch gerade darin, mit der Elterngeneration und dem nationalsozialistischen Erbe abzurechnen – womit sich die Berufung auf Schmitt eigentlich verboten hätte. Dass man ihn gleichwohl wiederentdeckte, hatte mit der geteilten Verachtung für die liberale Demokratie zu tun (die Schmitt als einen Waschlappenstaat verhöhnte) – und der Tatsache, dass die Predigt eines erlösenden Ausnahmezustands der Eskalationslogik der Terroristen durchaus zupass kam. Damit freilich – und dies soll der Gegenstand dieses kleinen Textes sein – hat es nicht sein Bewenden. Denn just zu der Zeit, als Francis Fukuyama das Ende der Geschichte ausrief, geriet ein entschieden postmoderner Geist wie Jacques Derrida in den Bann des Schmittschen Denkens. Man kann sich Derridas Faszination dadurch erklären, dass er (als Philosoph, der die Sprachkonstruktion der Realität lehrt) sich vom Schmitt’schen Dezisionismus angezogen fühlte. Denn:
Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. (Politische Theologie, 1922)
Damit wird die politische Ordnung als Entscheidung begriffen und dem Reich des Geistes zugeordnet. Und weil dies der Eitelkeit des Philosophen schmeichelt, ist es keine Fehlleistung, wenn man Derridas rühmende Erwähnung Schmitts als »letzten großen Vertreter der europäischen Metaphysik der Politik« als eine Form des Selbstlobes begreift. Ganz bizarr aber wird der Bezug auf Carl Schmitt, wenn man sieht, wie ein Denker wie Bruno Latour, der gleichermaßen der Postmoderne wie rechter Umtriebe unverdächtig ist, in seinen Gifford Lectures Schmitts politische Theologie wiederaufleben lässt. Dabei nutzt Latour die berüchtigte Freund-und-Feind-Unterscheidung Schmitts dazu, ein Schisma ganz neuer Art zu errichten, eines, das mit der klassischen Unterscheidung zwischen Links oder Rechts, den Fortschrittlichen oder Konservativen nicht mehr zusammengeht. Denn nunmehr werden die Erdgebundenen (die Gaia-Verehrer) gegen die weltlosen Anywheres ausgespielt. Auf kuriose Weise wird damit die politische Souveränität - der mortall God des Thomas Hobbes – naturalisiert. Und damit schiebt sich Gaia (als State of Nature, wie Latour mit einem kapitalen S schreibt) an die Stelle des weltlichen Leviathan.1 Mit dieser Rückführung der politischen Ordnung in den Naturzustand erweist sich Latour als Stichwortgeber der zeitgemäßen Umweltgbewegung. Jedenfalls verwundert es nicht, dass diese Argumentation von den Klimaaktivisten übernommen worden – womit sich das Schmittsche Denken popularisiert, ja zu einer Apokryphe der Popkultur geworden ist. Ein Dokument, das in diesem Kontext hochinteressant ist, geht auf die amerikanischen Psychologin und Klimaktivistin Margeret Klein Salamon zurück. Denn sie veröffentliche im Jahr 2017 einen Stretagiepapier mit dem Titel Leading the Public into Emergency Mode – ein Strategiepapier, das von Gruppen wie Extinction Rebellion oder der Letzten Generation nach Kräften beherzigt wird und dem auch wir uns in der Folge zuwenden werden.
Zunächst aber stellt sich die Frage: Was ist es, was Carl Schmitt so anziehend macht, dass die unterschiedlichsten Bewegung seinem Denken erlegen sind? Schon die obige Auflistung macht klar, dass sich hier kein bestimmtes Weltbild herausdestillieren lässt, sondern dass das Schmittsche Denken, je nachdem, unterschiedlichen Lehren und Geisteshaltungen zupass kommt. Neben der Radikalität und verbalen Schlagkraft des selbsternannten Begriffsballistikers erweist sich seine Lehre von der Souveränität als das verbindende Glied – eine Selbstermächtigungslogik, mittels derer Kommunismus, Nationalsozialismus, Gegenkultur und Umweltaktivismus ihren Machtanspruch anmelden. Denn wenn die Macht zu einer Frage der Entscheidung wird, zu einem Machtwort mithin, kann dies auch der Unterlegene sprechen – besteht das Desiderat nur darin, dass sein Wille zur Macht so ausgeprägt ist, dass er den Ausnahmezustand ausruft. Ist das Machtwort gesprochen, sind die Verhältnisse klar: Freund und Feind sind voneinander geschieden, die Agenda gesetzt. Natürlich stellt sich die Frage, wer den Betreffenden zu diesem Schisma autorisiert. Hier ist daran zu erinnern, dass der Schmittsche Dezisionismus, der sich als Kritik am saft- und kraftlosen Liberalismus artikuliert, untrennbar mit dem Göttlichen verbunden ist, einer politischen Theologie. Die Quelle dieser Lehre ist nun keineswegs einer besondere Gläubigkeit zuzuschreiben, im Gegenteil. Was ihn dazu veranlasst, ist der Umstand, dass die liberale Demokratie auf einem höchst fragilen Vernunftglauben beruht. Und wirklich gelingt es Schmitt mit einem einzigen Satz, die liberale Staatsauffassung aus den Angeln zu heben: Alle prägnanten Begriffe der modernen Staatslehre sind säkularisierte theologische Begriffe.2 Und weil diese Erinnerung an die religiöse Herkunft des neuzeitlichen Staates absolut präzise ist, bringt dieser Satz das Unbewusste des Liberalismus zutage. Diese aber ist nicht viel mehr als eine vornehme Illusion, ein Pseudorationalismus, der die Bedingung seiner Möglichkeit nicht wahrnehmen will. Wenn sich das Diktum des Schmitt-Schülers Ernst-Wolfgang Böckenförde zunehmender Beliebtheit erfreut (»Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann«), so ist damit nichts anderes gesagt, als dass der liberale Staat einem religiösen Umfeld entspringt, ja, dass die Säkularisierung keine Entzauberung, sondern nur eine Umwidmung ist – hin zu einer politischen Theologie. Weswegen Schmitt seiner Erinnerung an die historische Genealogie sogleich eine Parallelsetzung nachfolgen lässt: »Der Ausnahmezustand hat für die Jurisprudenz eine analoge Bedeutung wie das Wunder für die Theologie«.3 Hier allerdings stellt sich eine Frage, die von Schmitt nicht beantwortet wird, nämlich: Wie konnte sich der Glaube in eine diesseitige Vernunftordnung übersetzen? Ein wunderbares Beispiel, wie sich über die imitato Christi eine neue Vernunftordnung etabliert, ist die Entstehung des europäischen Fiskus. So hatten die Scholasten, die spin doctors des Mittelalters, ein hohes Interesse daran, die Börse der römischen Kaisers (den Fiskus) zu einer gleichsam göttlichen Instanz aufzuwerten. Wenn der liebe Gott, so ihre Argumentation, allüberall und allgegenwärtig sein kann, so muss dieses Charakteristikum auch seinem Stellvertreter auf Erden eigen sein. Mit dieser Gleichsetzung ist der Präzedenzfall von der Unsterblichkeit und Allgegenwart des Fiskus etabliert. Mehr noch: Mit diesem Diktum ist zugleich der Prototyp der juristischen Person geschaffen, die, wie man weiß, Unsterblichkeit besitzt (solange jedenfalls, solange sie nicht pleite geht). Verfolgt man die Geschichte des Leviathan, so finden sich derlei Umbesetzungen zuhauf, entspricht die Schmittsche Diagnose, was die Entwicklung des europäischen Staatsgebildes betrifft, durchaus dem historischen Wandel. Wie allerdings diese Transformation abgelaufen ist und was die Gründe für diese Verwandlung sind, davon findet sich bei Schmitt kein einziges Wort. Und dies mit gutem Grund. Denn hätte er sich auf diese Vorgeschichte eingelassen, hätte er sich mit den Fragen der konkreten Staatsmaschine beschäftigen müssen: Wirtschaft und Technologie. Damit aber hätte sich die Pointe der politischen Theologie in heiße Luft aufgelöst – wäre es ihm unmöglich gewesen, die Macht mit jener göttlichen Aura auszustatten. Statt mit einer triumphalistischen Geste, also der Macht über den Ausnahmezustand aufzuwarten, wäre er im Gegenteil dazu verdammt gewesen, die Ohnmacht und Impotenz der politischen Theologie darzulegen. Denn tatsächlich stellen die europäischen Institutionen keineswegs triumphalistische Geiststiftungen dar, sondern lassen sich vielmehr als Kompromissgebilde bergeifen - wie das Gewaltmonopol des Staaten, die erst nach endlos langen Auseinandersetzungen, Bürgerkriegen hat Wirklichkeit werden können. Wenn Carl Schmitt die Komplexität, die mit der Wirtschaftsweise und der Technologie einhergeht, unter den Tisch fallen lässt, bleibt allein die politische Theologie übrig. Alles ist politisch - und folglich eine Sache der Entscheidung (so als könne man sich entscheiden, fortan keine Uhren oder Computer mehr zu benutzen). Wirft er dem Liberalismus vor, dass er sich mit der Ausblendung der Religion ein Unbewusstes einhandelt, verfährt er selbst gar nicht anders – nur dass seine Lösung darin besteht, dass er das Primat des Politischen behauptet: Gesagt! Getan!
Mit diesem Befund ist das Faszinosum der Lehre präzise erfasst. Letztlich geht es um eine Form der Selbstermächtigung – und diese wiederum geht mit einer Verleugnung der Realitäten einher. Von daher wäre Derridas Kompliment auf eine psychologische Ebene hin zu verschieben. Was er die ›Metaphysik der Politik‹ nennt, ist nur ein anderes Wort für die narzisstische Selbstermächtigung: eine Politik des Himmelssturms, mit der man sich, je nachdem, einen überirdischen Anstrich oder einen göttlichen Auftrag erteilt. Auf diese Weise hat man eine Warte erklommen, auf deren Höhe thronend man sich nicht mehr mit den Mühen der Ebene auseinandersetzen muss (frei nach der Hegelschen Einsicht: »Wenn die Tatsachen nicht mit der Theorie übereinstimmen – umso schlimmer für die Tatsachen!«). Weil man durch eine höhere Macht ordiniert und zu Höherem bestimmt worden ist, ist die Welt aufs Wunderbarste geordnet. Nicht bloß, dass die Verhältnisse geklärt, Freund und Feind voneinander geschieden sind, zudem ist man, erfüllt von der Wichtigkeit der Mission, davon befreit, sich mit der eigenen Macht- und Hilflosigkeit auseinandersetzen zu müssen. All die Selbstzweifel, die sich aus der Unübersichtlichkeit der Moderne ergeben, sind vergessen. Wenn man im Machtgefühl schwelgt, so deswegen, weil man im Gegensatz zum Feind einen tieferen Einblick in die Verhältnisse besitzt. Von daher ist die manichäische Schisma geradezu eine psychologische Voraussetzung - was Schmitt in das von Theodor Däubler übernommene Zitat gekleidet hat:
Der Feind ist unsere eigene Frage in Gestalt.
Man klammert sich an den Feind, weil seine Blindheit die Voraussetzung dafür ist, zumindest als Einäugiger als König gelten zu können. Dieses Abhängigkeitsverhältnis ist ein markanter Beleg dafür, dass die behauptete Souveränität eine ausgeborgte ist, ja, dass hier etwas am Leben gehalten wird, was längst nicht mehr existiert. Verpflanzt man die Schmittsche Lehre in ihren Kontext zurück, so ist man vor allem mit der Erfahrung einer tiefen Ohnmacht konfrontiert. Da ist ein Land, das überzeugt war, die Welt erobern zu können, aber einen Weltkrieg verloren und darauf in eine tiefe Werte- und Identitätskrise verfallen ist. Historisch besehen ist die Batterie, aus der sich der Schmittsche Machtanspruch speist, das reine Gegenteil. Tatsächlich zeigen seine Tagebücher einen kleinen Mann, der vor allem mit rasendem Antisemitismus und Alkoholsucht zu kämpfen hat, einer Art des Weltekels, bei der alles Nichteigene zu einem toxischen Gebräu zusammenläuft: »Ekel vor der Vergiftung durch Juden. Abends weder Bier noch Wein. Gott sei Dank, unbegreiflich dieser Zwang zum Alkohol«.
Ganz offenkundig ist das Souveränitätsversprechen, das Schmitt verheißt, nichts anderes als der Beweis seines Gegenteils: Beleg einer tief verwurzelten Ohnmachtsempfindung. Schmitts Kunstgriff – seine Genialität, wenn man so will – besteht nun darin, diese Ohnmachtsempfindung in ein Dunkel herabsinken zu lassen, während auf der anderen Seite, wie von selbst, eine Aureole der Macht erglänzt. Dass Schmitts Lehre eine solch intensive Resonanz erlebt hat, ist allein dieser Selbstermächtigungslogik geschuldet. In der Verschmelzung mit der Bewegung erlebt das atomisierte Individuum Sinn und Zugehörigkeit. Genau darin drückt sich das Wesen aller Identitätspolitik aus: Empowerment! Um ein zeitgemäßes Exempel zu geben, sei nun die bereits erwähnte Streitschrift der Klimaaktivistin Margaret Klein Salamon herangezogen: Leading the Public into Emergency Mode. Wie man die Öffentlichkeit in den Notstandmodus versetzt.
Obschon sich hier kein einziger direkter Hinweis auf Schmitt findet, lesen sich die Argumente doch wie eine popularisierte 1:1-Übertragung: eine Art Schmitt-für-die-Massen. Der Einwand, den sie gegen die Mehrheitsgesellschaft erhebt, ist, dass sich diese einer Normalitätsillusion hingibt – dem Glauben daran, dass man einfach weitermachen könne wie bislang. Andererseits diagnostiziert die Autorin, als Psychologin, eine weit verbreitetes Gefühl der Hilflosigkeit. Was an der Argumentation auffällt, ist der Umstand, dass die Perspektive des autonomen, zumindest aber selbstverantwortlichen Individuums aufgegeben ist – und der Einzelne stattdessen in einem Zustand des Herdenverhaltens erscheint. Dieses aber gelte es sich zunutze zu machen. Weil auch der Katastrophenmodus eine Art Herdenverhalten evoziert, müsse man eine Art Pearl Harbour-Moment herstellen – und der Gesellschaft jenes Gemeinschaftsgefühl vermitteln, wie es sich beim Eintritt in den Krieg hergestellt hat. Versucht man der Argumentation der Autorin mit Wohlwollen zu folgen, ist zu sagen, dass die amerikanische Kriegsökonomie, namentlich das beständig herbeizitierte Manhattan-Projekt – wenn man es denn nur aus einer reinen Effizienzperspektive betrachtet – eine beispiellose kollektive Kraftanstrengung darstellt. Nun besteht das Dilemma der gegenwärtigen Klimakrise darin, dass die Katastrophe (also der von der Autorin fraglos vorausgesetzte Ausnahmezustand) keineswegs selbstevident ist. Im Gegenteil: Weil die Zeichen der Zeit von der Öffentlichkeit nicht erfasst werden, macht sich statt sich eine Art träger Ignoranz breit. Dem gilt es, sich entgegenzustellen. Was Klein Salamon predigt, ist, in Kurzform, Alarmismus und Massenpsychologie – Techniken, derer sich (wie sie nicht würde wir zu behaupten) alle erfolgreichen sozialen Bewegungen bedient haben.
Als Erstes und Einfachstes muss die Klimabewegung die Sprache der unmittelbaren Krise und der existenziellen Gefahr vollständig übernehmen. Wir müssen darüber sprechen, dass der Klimawandel den Zusammenbruch der Zivilisation, den Tod von Milliarden von Menschen und Millionen von Arten zu verursachen droht. Diese schrecklichen Folgen erwarten uns noch in diesem Jahrhundert, möglicherweise sogar noch in der ersten Hälfte, wenn die Dinge wirklich außer Kontrolle geraten. Es geht nicht darum, "den Planeten für künftige Generationen zu schützen", sondern unser eigenes Leben und das der Menschen, die uns wichtig sind, zu schützen. Wir sind jetzt und in den kommenden Jahren und Jahrzehnten in Gefahr. Die Klimakrise ist bei weitem die größte nationale Sicherheitsbedrohung, die größte Bedrohung für die öffentliche Gesundheit und die größte Bedrohung für die Weltwirtschaft.
Mag diese Einschätzung selbst bei gebildeten, eher bedächtig agierenden Zeitgenossen mittlerweile Common Sense sein, ist die Art und Weise erstaunlich, wie die Klein Salamon den Ausnahmezustand zu einem psychologischen Idealzustand aufbaut. Denn dieser sei dem psychologischen Flow-Zustand verwandt, den der ungarischen Psychologe Mihály Csíkszentmihályi als ›optimalen Bewusstseinzsustand‹ beschrieben hat, als einen Zustand, »in dem wir uns am besten fühlen und unsere beste Leistung erbringen«. Ganz im Sinne Steven Kotlers, der sich aus dieser Einsicht das Manifest des postmodernen Selbstoptimierers zusammengebastelt hat, The Rise of Superhuman, zeichnet Klein Salamon das Leben im Ausnahmezustand als Paradies der Sinnstiftung, des Zugehörigkeitsgefühls und der gesellschaftlichen Effizienz – nur dass man dazu eben erwachen und in den geistigen Kriegszustand (den WWII-State) eintreten muss.
Diese psychologisierende Argumentation ist aus mehreren Gründen bemerkenswert. Dass man das neuzeitliche Projekt des aufgeklärten Individuums einer Massenpsychologie opfert, ja, dass man den Ausnahmezustand als eine Form der Gesellschafts- und Sinnstiftung begrüßen kann, ist schon bemerkenswert – bezeugt es doch, dass diese Form der Mobilmachung vor allem den Zweck hat, einen inneren Notstand zu einem äußeren zu machen, ein ›dünn besiedeltes Innenleben‹, wie Christopher Lasch diese psychischen Zustand genannt hat, mit einem Gefühl von Bedeutung und Zugehörigkeit zu erfüllen. In diesem Sinn erweist sich das Objekt des Begehrens (das Klima) vor allem als Wunscherfüllungsmaschine – zeigt sich, dass es hier um eine Form der Schmittschen Selbstermächtigung geht. Wenn die Welt aufwachen soll, so deswegen, weil dieser Schlachtruf den Einzelnen in eine Form der Selbstgewissheit versetzt. Folglich zitiert die Psychologin jenen seelischen Flow-Zustand herbei, der vor allem Hochgeschwindigkeitsathleten charakterisiert, die ganz in ihrer Sache aufgehen. Genau daran aber ermangelt es den Einzelnen, die der gesellschaftlichen Erregung bedürfen. Es ist von daher kein Zufall, dass sich Klein Salamon nicht im Mindesten mit konkreten Umweltfragen auseinandersetzt, sondern ihre ganze Betrachtungsweise der Frage widmet, wie man die Logik der Viralität als Waffe einsetzen kann, um die Bewegung zu mobilisieren. Wie Carl Schmitt seine politische Theologie nur zu errichten vermag, indem er an der Sache vorbeigeht, hat man es hier mit einem Wiedergänger seines Denkens zu tun – nur dass der Leviathan durch einen apokalyptischen State of Nature, durch die vergewaltigte Gaia ersetzt worden ist.
Damit aber rundet sich das Bild ab. Dass Margaret Klein Salamons Climate Emergeny Fund Gruppierungen wie Letzte Generation unterstützt – und dass diese nach der Störung der Straßenverkehrs dazu übergegangen sind, Kunstwerke wie Monets Getreideschober zu attackieren (nach da Vincis Mona Lisa, Vincent van Goghs Sonnenblumen oder der Sixtinischen Madonna), zeigt, dass der eigentliche Sinn dieses Bildersturms in der Selbstermächtigung liegt – darin also, sich über eine als fossil deklarierte Vergangenheit zu erheben. Dass man sich insbesondere von Angriffen auf Kunstwerke eine Mobilisierung der Sympathisanten erhofft, ist nur zu einem gewissen Teil der Aufmerksamkeitsökonomie geschuldet, die derlei Aktionen in den sozialen Medien viral gehen lässt.
Über die kollektive Ekstase hinaus, weisen diese Aktionen auf die geistige Leerstelle hin: hat man es hier mit dem Exorzismus jener inneren Stimme zu tun, die allein den Zweifel laut werden lässt. Denn fragt man danach, wem sich die Neuerungen der Moderne verdanken, so hat man es nicht mit Kollektiven zu tun. Es sind Einzelne, die im blinden Fleck der Gegenwart Neuerungen gesucht und bewirkt haben – und die vor allem den Preis für diese Abweichung bezahlt haben. Und so wie Carl Schmitt der gescheiterten Literatenkarriere seinen Ausnahmezustand hat nachfolgen lassen, folgt auch die Ausrufung des Klimanotstandes einem totalitären Drehbuch; und wie immer, wenn es um Große Ganze geht, steht nicht die Welt auf dem Spiel, sondern der Himmel. Dass man ihn dazu apokalyptisch hat verfinstern müssen, ist ohne jede Bedeutung. Wie sagt Greta? Ich bin so glücklich wie niemals zuvor.4
Bruno Latour: Facing Gaia. Sex Lectures on the Political Theology of Nature. Edinburgh 2013.
Carl Schmitt: Politische Theologie. Berlin 1934, 2. Aufl., S. 49.
Ebenda, S. 49.
Wirklich hinreißend aber ist ihre Erläuterung, warum größere Entscheidungen überhaupt einfacher fallen: „Das Spannende aber ist: Je größer die Entscheidungen, umso einfacher ist es. Was mir mehr Probleme macht, sind die kleinen Entscheidungen. Zum Beispiel, welche Socken ich morgens anziehen soll.“