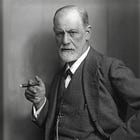Schnee von gestern
Wie sich im geistigen Heimatmuseum Geistesgegenwart bewahren lässt
Die Rückkehr des Don Quixote
Über die Notwendigkeit, das kollektive Unbewusste neu zu vermessen
Wo Moral sich zur Hypermoral wandelt, ein unbedachter Tweet Empörungswellen generiert, ja, wo sich, der identitären Versuchung folgend, eine bedenkliche Neigung zum Tribalismus bemerkbar macht, ist es an der Zeit, sich der Psychologie der Massen zuzuwenden – genauer: der Frage eines kollektiven Unbewussten. Mag Gustave Le Bons Massenpsychologie, gerade ihrer methodischen Unbedarftheit wegen, noch immer eine halbwegs gegenwärtige Beschreibung des Phänomens bieten, ist die Rede vom kollektiven Unbewussten vom stillen Niedergang der Psychoanalyse überschattet. Folglich stellt sich die Frage: Warum sollte man einen bejahrten, gründlich diskreditierten Gedanken wieder aufwärmen? Denn egal wie man sich hier orientiert, man gerät umstandslos in ein gedankliches Dilemma hinein. Folgt man der Freudschen Variante, so hat man es mit einer verborgenen Triebkraft zu tun, einer vis abscondita, folgt man der Jungschen Façon, so handelt man sich damit Archetypen und Geschlechterstereotype ein (à la animus und anima) – und beiden Spielarten wiederum ist gemein, dass sie die Bedeutung der konkreten historischen Situation einer vorab gesetzten psychischen Matrix unterordnen. Dass sich das Unbewusste, noch vor einer Generation als Universalwerkzeug allgegenwärtig, in einem solchen Schwächezustand zeigt, muss nicht von Nachteil sein; ebensogut kann es den Weg für ein neues Verständnis frei machen, das von den lange übersehenen philosophischen Apriori dieser Gedankenfigur frei ist. Denn beim genauen Hinschauen gibt sich das klassische Unbewusste als invertierte Metaphysik zu erkennen. Dabei hat der verborgene Teil des psychischen Apparats die Funktion des Hegelschen Weltgeistes übernommen, nur dass er nicht im Sinne der Aufklärung, sondern im Sinne einer schwarzen Sonne operiert.1 Auch die Soziologie läuft Gefahr, sich in diesem Geisteslabyrinth zu verirren. Konnte Emile Durkheim noch von einem positiven »Kollektivbewusstsein« sprechen, operieren alle sozialen Großentwürfe mit einer Figur, die, weil in die Negativität übersetzt, eine gewisse Verwandtschaft zum Unbewussten verrät. Spricht Adorno vom „Verblendungszusammenhang“, findet sich das Unbewusste bei Niklas Luhmann in der Triebkraft seiner selbstzeugenden, autopoietischen Systeme – und auch der poststrukturalistische Diskurs ist nicht davon gefeiert. Bei Foucault trägt das Unbewusste den Namen „Dispositiv“ und meint jene Kraft, die alle gesellschaftlichen Diskurse, Normen und Institutionen durchwirkt. Historisch betrachtet, könnte man sagen, dass sich das Unbewusste zunehmend von der individuellen Psyche entfernt und sich der Außenwelt einschreibt – eine Verschiebung, die die Frage evoziert, in welchem Maße man es hier mit einer kollektiven Dunkelheit zu tun hat.
Dämonologie der Maschine
Zwar bewahrt die Verschiebung ins Gesellschaftsaggregat davor, in jeder Mode das ödipale Drama wiederentdecken zu müssen, jedoch ist sie mit neuen Schwierigkeiten verbunden. Denn spricht man vom System, so läuft die Rede Gefahr, ins Unscharfe auszuflocken; zudem passiert es nicht selten, dass diese Größe, als Abgespaltenes, zum Problem eines Anderen wird. Dann sind die Macht, das böse Kapital oder die toxische Männlichkeit das Problem (und der eigene Anteil fällt kurzerhand unter den Tisch). Schon von daher ist es geboten, der Frage die größte Aufmerksamkeit zuzuwenden. Was genau ist gemeint, wenn von einem System die Rede ist? Merkwürdigerweise bleibt in den verschiedenen Diskursen die naheliegendste Antwort unerwähnt: die Möglichkeit, dass das Unbewusste – als psychischer Apparat – mit der Maschine verknüpft ist. Auf die Gegenwart bezogen, hieße dies, dass man jenen Dämon ins Auge fassen muss, dem man das Schlagwort der Digitalisierung auf die Stirn graviert hat. Solcherart zugespitzt, wird die Problematik sehr viel fasslicher. Unübersehbar nämlich hat man es beim Computer mit einer Größe zu tun, von der eine dunkel schillernde Projektionskraft ausgeht. Selbst wenn man den transhumanistischen Messianismus beiseite lässt, ist nicht zu übersehen, dass der Diskurs über die Digitalisierung beständig zwischen Fluch und Segen, Apologie und Dämonologie oszilliert. Hier artikuliert sich ein merkwürdiges, noch zu entschlüsselndes Paradoxon. Denn einerseits hat man es mit der nackten Ratio zu tun, anderseits haftet dieser eine unheimliche Seite an. Gerade dieser dunklen Seite kann die Maschine als Psycho-Reaktor Gefühlsaufwallungen hervorrufen, die man ansonsten einem religiöses Register zuschlägt – was genau der Grund ist, hier von einem Dämon zu reden. Ursprünglich meint der Daimon den Zuteiler, dessen Gabe schützend oder verderbend ist, der aber in jedem Falle eine unwiderstehliche Macht vorstellt. Wissen die User, dass sie sich in der Benutzung eines Programms oder einer Plattform einem Provider überantworten, ruft diese Übermacht einen geradezu viszeralen Widerstand auf den Plan. Folglich beharrt man auf Datensouveränität oder phantasiert, dass sich der altbewährte technische Überwachungsverein zu einem Algorithmen-TÜV wandeln könne, einer Gegenmacht, die dem dunklen Souverän Einhalt gebietet. Nun belegt derlei Pfeifen nur, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, oder anders gesagt: dass die Macht, vor der man sich zu schützen sucht, in ihrer Beschaffenheit nicht erfasst wird.2
Anything, Anywhere, Anytime!
Warum aber ist das so? Warum wirkt die Maschine als kollektiver Psycho-Reaktor? Vielleicht am merkwürdigsten ist die Spaltung, die sich zwischen individualpsychologischer und kollektiver Besetzung auftut. Wirkt die Maschine als Selbstermächtigungsapparatur, die dem Einzelnen ein Kingsize-Ego verheißt, verwandelt sie sich in dem Augenblick, da sie der Gesellschaft gegenüber in Stellung gebracht wird, in eine geradezu hinterhältige Macht. Eine Macht, die kalt und berechnend auf die Abschaffung der Menschen hinausläuft. Dabei ist die ihr innewohnende Rationalisierungsdrohung durchaus real: denn jede Arbeit, die, digitalisiert, in den Arbeitsspeicher übergeht, läuft Gefahr, im Museum der Arbeit unterzugehen. Was sich in den Brexit-Turbulenzen als Schisma zwischen den Somewheres und den Anywheres abgezeichnet hat (einer landgängerischen, lokal verhafteten Bevölkerung einerseits, einer weltläufigen und kosmopolitischen Elite andererseits), markiert eine ernste Erschütterung der politischen Ökonomie, eine Erschütterung, die erst in Ansätzen durchbuchstabiert worden ist. Nicht bloß, dass sich soziale Praktiken aus ihrer lokalen Verhaftung herauslösen, darüber hinaus entwinden sich die Programme auch der Zeit. Denn hat ein Algorithmus eine Frage gelöst, kann ein solcher Mechanismus jederzeit und überall reanimiert werden: anywhere, anytime! Bedeutet die Entfernung von Raum und Zeit schon einen grundstürzenden Wandel, greift die Digitalisierung auch auf Bereiche über, die sich ehedem der symbolischen Ordnung entzogen haben. Kurzgefasst: Was immer elektrisiert werden kann, wird zur Schrift – mögen dies die Schwingungen einer menschlichen Stimme, die Positionsdaten eines Wals oder ein komplexer Arbeitsprozess sein. Und in Lichtgeschwindigkeit kopiert, analysiert oder exekutiert, übersteigt das Digitalisat jedes menschliche Maß. Von daher geht die Umwälzung der politischen Ökonomie deutlich über die Antinomie von Somewheres und Anywheres hinaus, müsste ihr Schlachtruf vielmehr lauten: Anything, anywhere, anytime! Dekliniert man die Konsequenzen dieser Umwälzung durch, gewinnt man eine Ahnung, dass der Gesellschaft eine Revolution bevorsteht, welche die Beschleunigungserfahrung der sich industrialisierenden Moderne weit hinter sich lässt. In Anbetracht der drohenden ökonomischen und sozialen Erschütterungen verwundert der vergleichsweise nachlässige Empfang, den man der neuen Technologie bereitet hat: als könne man weitermachen wie bislang, als gäbe es dringlichere Dinge als die, sich über die grundlegende Bedeutung von Arbeit, Bildung und gemeinsamer Wertschöpfung im digitalen Zeitalter im Klaren zu werden.
Geisterarmee
Dass ein längst überfälliger Diskurs ausbleibt, lässt auf ein gerütteltes Maß an Verdrängung schließen. Um dieses Verdrängungsmoment in den Griff zu bekommen, könnte man an Freuds Vorstellung vom Unheimlichen erinnern. Denn das Unheimliche bezieht sich nicht auf eine monströse Fremde, die dem Einzelnen in Gestalt eines übermächtigen Monsters entgegentritt, sondern auf die entfremdete Heimlichkeit – genauer: ihren Umschlag in eine bedrohliche Fremde. Was eben noch Heimat, die Heimstatt alles Selbstverständlichen war, hat sich, von einem untergründigen Störgeräusch begleitet, in eine ortlose Drohung verwandelt – und genau dieser Umschlag löst das Gefühl des Unheimlichen aus. Das Unheimliche ist folglich eine Spielart der Xenophobie, mit dem Unterschied, dass es sich nicht am Anderen, sondern an einer Veränderung im Innern entzündet. Als paradigmatischen Fall des Unheimlichen zitiert Freud den »Zweifel an an der Beseelung eines anscheinend lebendigen Wesens und umgekehrt darüber, ob ein lebloser Gegenstand nicht etwa beseelt sei« – ein Eindruck, der von Wachsfiguren, kunstvollen Puppen und Automaten hervorgerufen wird. Verrät diese Beschreibung, dass Freud noch im Feld des Mechanischen beheimatet ist, so ist evident, dass dieser Zweifel heute von digital gesteuerten Prozessen genährt wird. Lassen sich Roboter, die Roboter fertigen, noch als geistige Nachfahren des Automaten auffassen, geht der Zweifel dort, wo Bots und Algorithmen geistige Operationen bewerkstelligen, ans Eingemachte. Nunmehr nämlich weitet sich die Einfluss-Sphäre der Maschine ins Geistige aus, begegnet man mit der künstlichen Intelligenz einer Ratio, die man bis dato nur einem lebendigen Wesen zugetraut hat. In welchem Maße diese Auslagerung menschlicher Intelligenz zu einem Gefühl des Sich-selber-fremd-Werdens führt, mag ein Beispiel aus der Medizin verdeutlichen. So hat im Falle der Brustkrebsfrüherkennung ein durch machine learning trainierter Algorithmus die Expertise geschulter Experten annehmen und – seiner Geschwindigkeit wegen – ganze Kohorten von Medizinern freisetzen können. Dieser Vorgang ist gleich im doppelten Sinne unheimlich. Denn einerseits vermag der Bot menschliches Wissen zu inkorporieren – was ihm, als unbeseelter Intelligenz, ein Zwitterwesen verleiht –, zum anderen geht mir diese Übertragung ein Privationsakt einher. Dabei erschreckt nicht nur, dass das Bewegungszentrum dieses Diagnoseaktes in den Bereich der Maschine hinüberrutscht, sondern auch das stupende Missverhältnis: dass die Arbeit hunderter, hochgradig ausgebildeter Spezialisten mit einem Lidschlag erledigt werden kann, und zwar ein-für-alle-Mal. In jedem Fall sind sich die Bewohner des Hauses, die einen solch unheimlichen Gast bei sich wissen, darüber im Klaren, dass sie über kurz oder lang unbehaust sein werden. In diesem Sinn ist der Liste der großen Kränkungen eine weitere hinzuzufügen. Neben der kosmologischen, der biologischen und der psychologischen Kränkung kommt eine anthropologische Kränkung hinzu: das Bewusstsein, dass das Mängelwesen Mensch, um seine Intelligenz beraubt, von einer Geisterarmee aus lichtgeschwinden Bots ersetzt werden kann.
Wie man mit dem Hammer philosophiert
In Anbetracht dieser Privationsdrohung versteht man durchaus, dass und warum das Grundverhältnis der Maschine gegenüber stets das der Kontrolle ist: Man behauptet tapfer, dass man die Maschine im Griff hat, so wie man einen Hammer im Griff hat. Indes ist dieser Werkzeugbegriff gleichbedeutend mit dem Akt der Verdrängung. Denn der Computer fällt aus dem Ensemble der Werkzeuge vollständig heraus. Dies wird deutlich, wenn man nach dem Zweck des Computers fragt. Ist beim Hammer das Um-zu eindeutig zu definieren (ein Hammer ist zum Hämmern da), wird man mit der Frage nach dem Um-zu eines Computers in eine tiefe Geistesverlegenheit hineinkatapultiert. Wozu ist ein Computer da? Zum Computern? Dazu, dass man sein Tinder-Profil pimpt, sich auf einer virtuellen Karte einen GPS-Zaun errichtet oder das körperliche Wohlbefinden mit einer Fitness-App trackt? Wie man es auch dreht und wendet: Man kann den Zweck eines Computers nicht fixieren, sondern hat es mit einer uferlosen Fülle von Möglichkeiten zu tun (wie Steve Jobs schon gesagt hat: Der Computer ist die Lösung, was wir brauchen, ist das Problem). Dieses Paradox löst sich auf, wenn man den Computer nicht als Werkzeug begreift, sondern als Werkstatt, als Raum, in dem alle erdenklichen Werkzeuge aufgebahrt liegen. Wie groß kann dieser Raum sein? Begreifen wir unseren Planeten als elektromagnetischen Schriftkörper (und denken uns Satelliten hinzu), sehen wir, dass dieser Raum die ganze Welt umfassen kann. Man hat es also mit einer universalen Maschine zu tun. In Anbetracht einer solchen universalen Maschine, die jeden Nutzer in ein Verhältnis der Immersion hineinzwingt (und damit als sub-iectus unterwirft), ist es eine flagrante Unterkomplexität, einen Werkzeug- oder Medienbegriff in Anschlag zu bringen. Merkwürdigerweise jedoch zieht sich diese Gedankenblockade durch sämtliche Medientheorien hindurch. Dass man in in rascher Folge von der Multi-, Hyper- und Transmedialität gesprochen hat, zeigt nur, wie hartnäckig sich das Denken gegen die übermächtige Kraft in Stellung zu bringen versucht. Der Sinn dieser Widerstandsgeste ist eindeutig. Denn wenn man sich im Kollektiv einredet, noch immer mit dem Hammer philosophieren zu können, hat man die unheimliche Dimension der Maschine verdrängt – den Umstand, dass man mit der Digitalisierung in einen neue Gedankenwerkstatt, eine neue symbolische Ordnung eintritt.
Wunschmaschine
Spricht man von einer universalen Maschine, so folgt daraus, dass jeder, der sich davor positioniert, seinem eigenen Begehren Gestalt verleiht. Mithin wirkt die Maschine als Projektionsapparatur, als Zauberspiegel, welcher alle erdenklichen Wünsche einzulösen vermag. Mit der Verheißung des Anything, anytime, anywhere übernimmt die Wunschmaschine das Transzendenzversprechen der Zentralperspektive, das dem Einzelnen in der Tiefe des Bildes einen Fluchtpunkt in Aussicht gestellt hat. Konnte dieses Plus-ultra in der Ordnung des Bildes nur der Vorschein eines Künftigen sein, so hat der Nutzer, der sich seinem Smartphone oder seinem Computerbildschirm gegenübersieht, tatsächlich Gelegenheit, in diesen Raum einzusteigen. Und weil er nun selbst im Bilde ist, wird er (resp. seine digitale Imago) an einen anderen Ort der Welt teleportiert, mit übermenschlichen Attributen versehen und dauerhaft auf Empfang geschaltet. Das Größenselbst ist mithin keine bloß vorgestellte Entität mehr, sondern wird zu einem tätigen Stellvertreter, der Blicke auf sich zieht, die Wünsche seines Urhebers exekutiert und ihn zu einem Objekt des Begehrens verwandelt. Das Ende der Repräsentation markiert die Hochzeit der Simulation – und zwar nicht im Sinne einer Vortäuschung, sondern als strukturell ausgelagerter Persönlichkeitsanteil. So besehen steht der Avatar, der als soziale Membran jede Form der Berührung registriert, für eine Form der Persönlichkeitsspaltung. Kann dies gelegentlich dazu führen, dass jemand, um seinem Profil zu entsprechen, sich einer Schönheitsoperation unterzieht, wird die Spaltung in der Regel gar nicht wahrgenommen. Voraussetzung dafür, dass die Übertragung (= die Identifikation mit dem Social-Media-Profil) gelingt, ist die Intimität der Begegnung: dass man hier nicht einem strafenden oder versagenden Über-Ich, sondern einer idealen, leeren Projektionsfläche begegnet. Deswegen kann die Maschine wie ein Zauberspiegel narzisstische Größenphantasien auf sich ziehen. Wenn Freud den kindlichen Narzissmus als Allmacht der Gedanken [bezeichnet hat], in der der Gedanke in magischer Weise Neues schafft, versteht man leicht, dass die narzisstische Aufladung gerade dort funktioniert, wo die Maschine als magisches Instrument in den Dienst genommen wird. Dabei ist es gerade die Weltlosigkeit der Maschine, ihre semantische Leere, die sie zur idealen Projektionsapparatur macht. Hier kommt eine sonderbare Dialektik ins Spiel. Denn welcher Art sind die Projektionen, die in der digitalen Welt Urstände feiern? Die digitalen Medien werden vor allem dazu genutzt, um Ansprüche aus der alten Welt zu befriedigen. In diesem Sinn ist ein Selfie ein Selbstportrait unter Einkaufspreis. Mit Selfiestick und Instagram-Account an die ikonographische Batterie der Neuzeit angeschlossen, erlaubt die instantane Reaktion des Publikums, dass sich die innere Leere mit einem digitalen Größenselbst füllt. Wo alles zum Kinderspiel wird, liegt der Regress ins Infantile nicht fern – und er wirkt just in dem Maße, in dem sich der Betreffende über die digitale Ordnung nicht im Klaren ist. Mag sich der Einzelne, eingesponnen ins Netz, als eine Art Königskind imaginieren, so übersetzt sich diese Verführung, gesamtgesellschaftlich betrachtet, in eine identitäre Versuchung. Wie keiner vor ihm, hat der amerikanische Präsident diese Form der Selbstermächtigung für sich nutzbar gemacht. Jedoch führt der Präsidentendarsteller zu der ernüchternden Einsicht, dass der Spiegel nicht die Weltintelligenz fördert, sondern die Wirklichkeit zur Scripted Reality verwandelt, einem Reich, in dem zuvörderst die Fiktionen gedeihen. Entbindet sich mit diesem Regress ein unterkomplexes Größenselbst, wird die Maschine selbst zum Unbewussten.3 Nehmen wir den netzinduzierten Strukturwandel unserer Öffentlichkeit in den Blick, so zeigt sich, dass die Heraufkunft populistischer Strömungen ohne die Verstärkung der sozialen Netzwerke undenkbar gewesen wäre. Haben zuerst die Ränder des politischen Spektrums von diesen Selbstermächtigungsprozessen profitiert, belegt die Affäre Relotius, dass auch das Juste Milieu nicht davor gefeit ist, den eigenen Phantasmen aufzusitzen.
Voodoo-Ökonomie
Von außen besehen mag der progrediente Wirklichkeitsverlust einer stärker werdenden ideologischen Polarisierung geschuldet sein, psychohistorisch jedoch artikuliert sich hier eine Problematik, die man als Epochenwechsel deuten kann. So wie sich der Einzelne in ein unbewaffnetes Selbst und eine Größenphantasie spaltet, ist die Zeit eingeklemmt zwischen zwei heteronome Ordnungen – eine Vergangenheit, die nicht weichen will und eine Zukunft, die sich nur schemenhaft artikuliert. Nun bewirkt die stete Doppelbelichtung nicht bloß, dass die Welt unlesbar wird, sie schlägt sich vor allem in einer Störung des symbolischen Tausches nieder. Denn die Konsumenten, der sich auf digiphile Weise ermächtigen, sind außerstande, der als übermächtig empfundenen Instanz irgendetwas zurückzugeben. Was sie als Konsumenten über sich selber erhebt, degradiert sie als Produzenten. Die Unfähigkeit der Widergabe wiederum markiert eine Störung der Reziprozität. Weil man genötigt ist, die Asymmetrie dieses Verhältnisses zu verdrängen, kehren jene Gespenster wieder, die Marcel Mauss in seinem Werk über die „Gabe“ beschrieben hat. Ist hier der Empfänger einer Gabe nicht in der Lage, dem Spender einen gleichwertigen Gegenstand zurückzugeben, beginnt der Geist des Spenders (sein Mana) im Geist des Beschenkten zu spuken. Das Gefühl der Nicht-Satisfaktionsfähigkeit erzeugt ein Gefühl von Scham und Ungenügen – und dieses Ungenügen wiederum lässt den Beschenkten im Limbo widerstreitender Gefühle zurück (Aggression, Verleugnung, Verdrängung, Identifikation mit dem Feind). Strukturell übersetzt sich die ausbleibende Erwiderung in eine Stockung des Dialogs: einen Verlust an Diskurs-und Gestaltungsfähigkeit. Die symbolische Ordnung, an der der Beschenkte nur passiv teilhaben kann, erscheint als dunkle und zunehmend feindliche Ordnung. Dieser Zustand ist umso bedrohlicher, als man es hier mit Gespenstern zu tun hat, die der Kapitalismus eigentlich dispensiert hat. Ersteht man einen x-beliebigen Gegenstand, ist man mit der Geldzahlung seiner Pflichten ledig – es gibt keinerlei Verpflichtung dem Produzenten gegenüber. Indes ist die Störung des symbolischen Tauschs kein Problem, dem man individualpsychologisch begegnen kann. Mauss insistiert immer wieder darauf, dass der Tausch nicht als Segment von Gesellschaft zu begreifen ist, sondern die Totalität, die „gesellschaftliche[n] Systeme in ihrer Gesamtheit“, betrifft. Tatsächlich muss man nicht weit schauen, um das Unbehagen im real existierenden Kapitalismus dingfest zu machen. Denn die Konsumenten trauen der Quittung, dem Freiheitsversprechen des Kapitalismus, nicht mehr, sondern werden von einem diffusen schlechten Gewissen heimgesucht (das sie in Fair trade-Initiativen oder kompensatorischen Gesten aller Art zu besänftigen suchen). In diesem Sinne könnte man Pascal Bruckners „Schluchzen des weißen Mannes“ nicht bloß als Ausdruck politischer Romantik verstehen, sondern als Folge einer sehr viel tiefergehenden Unbehagens: einer veritablen Wertekrise des Kapitalismus. Nicht bloß im psychischen Sinn, auch im Ökonomischen ist die Rückkehr der Voodoo-Ökonomie eine Tatsache, und zwar insofern, als die Mehrwertbildung auf die Seite der Konsumenten hinübergerutscht ist. Ihre Aufmerksamkeit allein verbürgt den Wert einer Sache, während umgekehrt die Position des Produzenten eine Leerstelle geblieben ist – oder genauer: der technischen Ratio überantwortet ist. Dass die Geschäftsmodelle der Internetwelt allesamt auf die Ökonomie der Gabe zurückgehen, ist keineswegs zufällig. Der Nutzer wird mit einem Modell angefüttert, „geteastert“ oder beschenkt, bis er, hoffnungslos in das Angebot eingesponnen, sich dem Netz nicht mehr zu entwinden weiß. Damit aber kehrt das do-ut-des wieder, betritt der Dämon die Bühne – jener Mega-Provider, dessen Angebot nicht abzulehnen ist. Und jeder Like, jeder Klick lässt das „Escalation of Commitment“ nur weiter skalieren. Wie kann man einen Facebook-Account löschen, wenn man Hunderte virtueller Freunde erworben hat, ja, wenn sich ein Großteil der sozialen Aktivitäten dieser Plattform verdankt?
Geisterbahn
Ein Ausweg aus der Beschämung ist die Identifikation mit dem Aggressor. Diese fällt umso leichter, als man die Maschine, als Introjekt, in sich hineinnehmen kann. Weil die Nutzung ein Kinderspiel ist, das zudem (wie ein eleganter Macintosh) zur Selbsterhöhung beiträgt, mag sich im Nutzer so etwas wie Digiphilie einstellen – eine Begeisterung für jene Wunderkräfte, mit denen sich der Betreffende zu erhöhen vermag. Dabei inkorporiert der Betreffende die Werte und Verhaltensweisen der symbolischen Ordnung und macht sie zu Anteilen des eigenen Selbst. Wie mächtig dieses Introjekt ist, wird deutlich an der Bezeichnung der digital natives, jener digitalen Eingeborenenschar, denen schon deswegen, weil sie in diese Welt hineingewachsen sind, eine Art überlegener Sprachfähigkeit attestiert wird. Zweifellos trifft dies zu, was die konsumtive Seite betrifft, dennoch stellt sich die Frage: Ist man automatisch, nur weil man die neue Technologie nutzt, in den Zustand der Sprachfähigkeit versetzt? Die Antwort lautet zweifellos: Nein. Und damit kommt es zu jener Schizophrenie, bei der sich sich eine symbolische Ordnung gegen den Geist ihres (namenlosen) Erfinders in Stellung bringen lässt. Ein Rückblick auf die Zeit des Buchdrucks mag dies verdeutlichen. Denn was passierte wohl, als die Gutenbergsche Presse das 15. Jahrhundert mit der Möglichkeit der Massenproduktion ausstattete? Man druckte die Phantasien, die sich im 12., 13. und 14. Jahrhundert herausgebildet hatten – und die in heroischer Weise um die Gestalt des Ritters kreisten.Der Effekt war (so erzählen es Henri-Jean Martin und Lucien Febvre in ihrem „L‘apparition du livre“), dass die Zeit des Buchdrucks vertrauter mit den Phantasmen des Mittelalters war, als dieses je mit sich selber sein konnte. Und so kommt es zu jener Transformation des Realen, wie sie Cervantes für seinen Helden beschreibt: »so fest setzte es sich ihm in den Kopf, jener Wust hirnverrückter Erdichtungen, die er las, sei volle Wahrheit, dass es für ihn keine zweifellosere Geschichte auf Erden gab.« Mag das Phänomen, dass das Leben die Gestalt einer retroaktiven Fiktion annimmt, schon befremdlich genug sein, so ist die Kluft zwischen dem Phantasma und der Realität die eigentliche Verrücktheit. Wenn Don Quixote nicht gegen Windmühlen, sondern gegen Riesen anzureiten glaubt, so gelten ihm die „hirnverrückten Erdichtungen“ als die eigentliche Realität, indes das Triebwerk der Zeit (die Räderwerkordnung, die das Mittelalter so radikal umgestaltete wie dies der Computer heute für unsere Gegenwart besorgt) vom Phantasma gänzlich aufgesogen wird. Diese Kluft wiederholt sich zwischen dem Stoff und dem Leben des Dichters. Denn das Leben des Miguel Cervantes, dieses heruntergekommenen Adligen, der sich als Kammerdiener, Soldat und Steuereintreiber verdingte, in einer Schlacht gegen die Türken die Beweglichkeit eines Arms verlor, als Sklave in Algier schuftete und wegen Betrugs eingekerkert wurde, ist voll von den Zeichen der Neuzeit, während umgekehrt die Ritterträume seines lesehungrigen Helden so unzeitgemäß sind, wie es der Hexenwahn des Heinrich Kramer in den Zeiten der Renaissance war. Gemäß dem schönen Bonmot von John Lennon, dass das Leben das ist, was passiert, während man eifrig dabei ist, andere Pläne zu machen, könnte man sagen, dass die Geistesgegenwart unter Fiktionen begraben wird – und dass sich genau darin das Unbewusste der Maschine artikuliert.
Ramsch
Die Entfesselung der Fiktion hat einen Preis – und dieser besteht darin, dass sich die Phantasmen immer weiter von dem entfernen, was sie doch eigentlich begehren. Dieser Entkernungs- und Bedeutungsverlust betrifft zuallererst das Selbstbewusstsein selbst. Bewirkt das Selfie, geschossen und auf Instagram hochgeladen, eine kurzfristige Stärkung des Ichgefühls (I me and myself on the Dopamine bus!), bedeutet es langfristig eine Form der Verstrahlung. Ein aussagekräftiges Exempel eines solchen Entwertungsprozesses hat das 19. Jahrhundert zu bieten. Und zwar beobachtete man hier unter Studenten eine befremdliche Epidemie von Duellforderungen. Weil die Ehrverletzungen fast durchweg auf nichtige Gründe zurückgingen, stufte man sie dementsprechend als Ramsch ein, und denjenigen, der ein Duell unter Einkaufspreis einforderte, als Ramscher. Der Ramsch steht mithin für einen im Sinkflug begriffenen Ehrbegriff – und zwar nicht weil die Frage der Ehre und der Satisfaktionsfähigkeit in Vergessen geriete, sondern weil sie inflationär in Stellung gebracht wird: Tod durch Overkill. Demgemäß ist das ins Ehrpusselige übersteigerte Ehrgefühl geradezu Indikator seines Verschwindens – lässt sich in der verramschten Ehre ein allgemeiner Verlust an Satisfaktionsfähigkeit ausmachen. Auf analoge Weise wohnen wir nun einer Verramschung der Werte bei, die sich in der symbolischen Ordnung der Repräsentation ausgeprägt haben. Weil die Digitalisierung Menschen mit Segnungen versieht, die sie sich zuvor nicht leisten konnten, erscheint die Limbo-Ordnung nicht als das, was sie ist, als race to the bottom, sondern als ein höchst erstrebenswertes, ökonomisches Rationale. In diesem Sinn wird der entleerte Wert nicht als solcher erfasst, sondern bläht sich, auf nachgerade groteske Weise, nur weiter auf: larger than life. Demgemäß sind die Filterblasen, die sich in den sozialen Medien aufbauen, Orte der Bedeutungshypertrophie. Dass sie, obwohl dem Untergang geweiht, sich gleichwohl größter Beliebtheit erfreuen, hat mit einem Phänomen zu tun, das Gustave le Bon als „Religiosität der Massen“ tituliert hat.4 Damit ist gesagt, dass die Masse sich in einem höheren Maße als der Einzelne dem Realitätsprinzip entwinden kann. Die entsprechende soziale Rückkopplung vorausgesetzt, kann dies dazu führen, dass sich ein Kollektiv in eine Potkemkinsche Kulissenlandschaft einhaust und einem Wahnsystem zu huldigen beginnt. Die Verführung dazu ist umso größer, wenn das, was man etwas behauptet, in einer vergleichbaren Form bereits existiert hat, man also auf eine glorreiche Vergangenheit zurückschauen kann. Wie auch immer der Slogan ausschauen mag (Great aigain!, Take back control! etc.), nunmehr setzen sich Wörter (Bilder und Memes) an die Stelle von Realitäten, gilt die unverdrossene Behauptung schon als Realitätsbeweis.5 Mag die Skepsis des Einzelnen ihre Fadenscheinigkeit durchschauen, so fühlt er sich, dem ökonomischen Stressor folgend, genötigt, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Wenn in der Aufmerksamkeitsökonomie eine Aussage die entsprechende Aufmerksamkeit erlangt, erscheint sie als monetarisierbarer Wert, folglich als sozial akklamierte Tatsache. Mit der Aufmerksamkeitsökonomie ist der Weg ins postfaktische Zeitalter vorgezeichnet, oder genauer – ist der Weg für das Auseinanderklaffen von Wahrnehmung und Realität bereitet. Wahr ist, was gefällt!
In der Blase
Das Internet, als kollektive Wunschmaschine in den Dienst genommen, souffliert weit mehr der Weltabschirmung, als dass es als Träger des Neuen in Erscheinung träte. So kommt es zur paradoxen Situation, dass im technisch entfesselten 21. Jahrhundert die Phantasien einer untergehenden Welt wiederbelebt werden – ja, dass eine kollektive Don Quixoterie Raum greifen kann. Wie der Ritter von der traurigen Gestalt reitet man gegen Windmühlen an, genauer: lässt die Gespenster der Vergangenheit wiederaufleben. Dass diese Fantasy-Gebilde ihrerseits eine stupende Überzeugungskraft annehmen, ist dem kollektiven Projektor geschuldet – der Leichtigkeit, mit der sich Wünsche als Realitäten ausgeben lassen. Ein solches Weltverhältnis, das sich in eine Blase aus vertrauten Wörtern, Bildern, Symbolen und Kommunikationsakten hüllt, hat jedoch seinen Preis. Fortan wird die Wirklichkeitsvermeidung zum Programm, die Prokrastination zur Kunstform erhoben. In einem solchen Geistesklima verwundert es nicht mehr, dass Regierungshandeln sich nicht mehr an einem Zukunftsentwurf orientiert, sondern dass man – auf Sicht fahrend – sich zunehmend dem Blindflug überlässt. Wo der Erwartungshorizont schwindet, kommt es zur geistigen Schubumkehr. Folglich begnügt man sich mit vertrauten Kostümen, bekannten Problemen und bewährten Lösungen: Zurück in die Zukunft! Mag der Fundus den Vorzug besitzen, dass er die verkürzte Aufmerksamkeitsspanne mit leicht verständlichen Narrativen versorgt, geht die Reduktion von Komplexität mit dem Schwindel des Fiktiven einher. Denn wo allein die Erzählung über den Realitätsgehalt einer Sache befindet, läuft man unweigerlich Gefahr, auf bewährte dramaturgische Muster zurückzugreifen: das Schurkenstück, die Heldenreise, die Moral von der Geschicht‘. Während sich das Narrativ in eine imaginäre Vergangenheit einspinnt, ist ihre faktische Restitution schon deswegen unmöglich, weil die Computerwelt einer heteronomen Gesetzmäßigkeit folgt. Mit jedem Tweet und jedem Like arbeitet man einer symbolischen Ordnung zu, welche die tradierten Begriffe von Identität, Arbeit und Kapital atomisiert. Insofern befindet man sich, auch wenn man es sich mental im Heimatmuseum bequem gemacht hat, im Zustand einer steten kognitiven Dissonanz. Denn was man begehrt, ist erreichbar nur mit Mitteln, die das Objekt des Begehrens zerstören. Gewiss kann man die störenden Kognitionen verdrängen (sie rationalisieren oder relativieren), zudem lassen sich konsonante Stimmen (Deckerinnerungen) hinzufügen. In jedem Fall aber ist die Psyche genötigt, sich als Fiktionsproduzent zu betätigen – mit dem Ziel, die Störgeräusche aus dem harmonischen Weltgefüge herauszufiltern. Dieser Ausblendungsprozess bedeutet nichts anderes, als dass man sich blind für den Projektionsprozess stellt – oder, metaphorisch gefasst, die Windmühlen für Riesen hält. Man redet von Werten, weil man sie nicht mehr besitzt, man pocht auf Identität, weil sie sich atomisiert hat, und man bedarf der Hypermoral, um die eigene Moral aufrechtzuerhalten. In der Simulation löst sich der Diskurs von den faktischen Triebkräften – und wird zu einer freischwebenden Begriffswolke, einer Weltsicht, die sich nurmehr über die Evokation eines hypertrophen Symbols, eines Mega-Objekts, ein Gefühl von Gültigkeit zu verschaffen vermag. Kein Wunder, dass sich Idiosynkrasien ausbreiten, Empfindlichkeiten, bei denen das Selbstbewusstsein dahinschmilzt wie eine Schneeflocke in der offenen Hand. Wenn die Selbstbeschreibung der Epoche sich mit dem Gefühl der Ermüdung begnügt (postmodern, postdemokratisch, postfaktisch), kündet dies von einer schleichenden Entkernung des Weltbildes – einer Evakuierungslogik, die kein Segment von Wirklichkeit ausnimmt. Auf diese Weise anästhesiert, gleitet man in eine zunehmend behauptete, fiktive Weltsicht hinein, gewöhnt sich daran, Bilder und Wörter für bare Münze zu nehmen. Wo das Wunschdenken regiert, keimt die Hoffnung, dass sich das unerbittliche wiederholte Mantra sich auf mirakulöse Weise schließlich doch realisiert. Wie lautet das Motto der Silicon Valley-Gründer? Fake it, till you make it!
Was will die Maschine von mir?
Was aber, wenn das Medium die Botschaft wäre? Was, wenn die Simulation nicht dazu ist, einer längst untergegangen Welt zu neuer Blüte zu verhelfen, sondern wenn man die Werkstatt der universalen Maschine als kollektiven, psychischen Apparat auffassen müsste, als geistige Matrix, die ihrerseits einen eigenen Wertekanon entbindet? Historisch betrachtet, arbeitet sich im kollektiven Unbewussten die Triebkraft der Maschine heraus – nicht zufällig hat sie Europa mit der Vorstellung des Takts, der Pünktlichkeit und einem Sinn für die gesellschaftliche Polyphonie ausgerüstet, ganz zu schweigen von den Ordnungsbildern, die man für die Staatsmaschine und ihre Institutionen gebildet hat. Dass dies hinterrücks, ja gegen den Willen ihrer Nutzer geschehen ist, ist ein Beleg für die Gewalt dieses Prozesses – und ein Grund dafür, den vorherrschenden Diskursen mit Vorsicht zu begegnen. Demgemäß wäre zuerst die Frage zu stellen, ob eine Behauptung über die Welt mit diesem Triebwerk übereinstimmt – oder ob man es nicht mit bloßem Wunschdenken, Phantasmen und Projektionen zu tun hat, einer kognitiven Dissonanz, welche die Gesetzmäßigkeit ihres Projektors verleugnet. Hier kommt ein Konflikt aufs Tapet, der mit der neu hinzugekommenen anthropologischen Kränkung zu tun hat, also der Tatsache, dass das Denken mit einer symbolischen Ordnung konkurriert, die ihrerseits – als historisch wirksame Triebkraft – in eine andere Richtung weist als sie das eigene Wunschdenken vorgibt. Konkret bedeutet dies, dass die Frage, was kann die Maschine für mich tun, ersetzt werden müsste durch die Frage: Was kann ich für die Maschine tun? Oder präziser noch: Was will das kollektive Unbewusste von mir? Diese Frage markiert die Terra incognita eines noch unerschlossenen Selbstbewusstseins. Wie unheimlich diese kulturelle Metempsychose ist, wird deutlich im apokalyptischen Denken, das sich im Zeichen des Anthropozäns breit gemacht hat. Trägt der Begriff der dominierenden Praxis der menschlichen Spezies Rechnung, öffnet er doch auch die Tür zum Sündenstolz, dazu, dass man es sich im Katastrophenzustand bequem macht. Dabei erweist sich das fortifizierte Selbst, das sich in Weltzerstörungsphantasien ergeht, als eine Form der invertierten Megalomanie. Denn nähme man die Problematik ernst, könnte die einzige plausible Remedur nur darin bestehen, dass man die Nachhaltigkeitsfrage aufs Intelligenteste angeht – und das heißt, die Digitalisierung, welche die Symbolmanipulation in den letzten siebzig Jahren um einen Milliardenfaktor beschleunigt hat, zur Lösung der selbstgeschaffenen Probleme heranzieht.6 Merkwürdigerweise klafft hier eine Lücke. Denn die begriffliche Selbstermächtigung hat nicht einmal den Versuch zur Folge, sich der Frage mit den Mitteln der Technik zu nähern. Ganz im Gegenteil: Man ist bemüht, den Geist der Digitalisierung zurück in die Flasche zu stopfen, ohne zu begreifen, dass es die eigene Geistesgegenwart ist, die man auf diese Weise entsorgt. Begreift man die Maschine als kollektives Unbewusstes, sind vier Neukonfigurationen des Unbewussten vorzunehmen. Erstens hat man es hier nicht mit einer unveränderlichen Größe zu tun, in der es, wie Freud sagt, keine „Zeit und keine Verneinung“ gibt, sondern mit einer historisch wandelbaren Größe. Und wie die Geschichte der digitalen Revolution zeigt, kann es hier zu beträchtlichen, disruptiven Umcodierungen des psychischen Apparats kommen. Zweitens ist dieses Unbewusste nicht als individualpsychologische Größe fassbar, sondern zieht sich durch die gesellschaftlichen Institutionen hindurch. Drittens zeichnet sich dieses Unbewusste durch eine Doppelnatur, genauer: eine Doppelkultur aus. Denn der phantasmatischen Seite entspricht auf der anderen Seite die nackte Rationalität. Es und Über-Ich, das Reale und das Symbolische sind auf das Innigste miteinander verknüpft. Daraus folgt nichts anderes als das, was bereits Freud als das Programm der Psychoanalyse ausgegeben hat: Wo Es war, soll Ich werden. In ein Aufklärungsprogramm übersetzt, hieße dies, dass man sich über die Implikationen der symbolischen Ordnung aufklärt, dass man, um Kant zu paraphrasieren, kein Räderwerk oder Computer mehr für sich denken lässt. Statt die Technik, je nachdem, zu dämonisieren oder zu verklären, gilt es, die universale Maschine als Materialisierung eines kollektiven Begehrens zu begreifen: als theo-, sozio- und psychoplastische Größe. Grundbedingung jedoch ist, dass man sich der Vorstellung entschlägt, noch immer mit dem Hammer philosophieren zu können. Nur unter dieser Bedingung entkommt das Denken der identitären Versuchung, lassen sich die grundstürzenden Veränderungen in den Blick nehmen, die mit der Veränderung des psychischen Apparats einhergehen (was ein Gut, was Arbeit, ja, was Gesellschaft überhaupt ist). Dass all dies auf eine Metempsychose des kulturellen Selbstbewusstseins hinausläuft, mag schmerzhaft sein, so schmerzhaft wie der Umstand, dass man sich darüber liebgewordener Praktiken und Grundüberzeugungen entledigen muss. Das ist der Preis: Der Auszug aus einem lang bewohnten Gedankengebäude. Mag sein, dass das früher einmal ein durchaus herrschaftliches Anwesen war. In letzter Zeit freilich wird es von Klopfgeräuschen und Flüsterstimmen heimgesucht, Vorzeichen, mit denen ein künftiger Horrorfilm aufwartet.
Ich habe an anderer Stelle über die Freudsche Konstruktion des Unbewussten geschrieben. Vgl. Martin Burckhardt: Vom Geist der Maschine. Eine Geschichte kultureller Umbrüche. Frankfurt/New York 1999.
Allein der Umstand, dass der Dämon der Digitalisierung erst jetzt die Rede von der Globalisierung abgelöst hat, ist Beleg für ein langanhaltendes Missverständnis. Denn natürlich war, was eine ganze Generation unter dem Rubrum der »Globalisierung« gefasst hat, nur ein Epiphänomen der Digitalisierung (was sich heutzutage daran zeigt, dass sich die Globalisierung durchaus rückabwickeln lässt, etwa dadurch, dass nun Roboter an die Stelle von billigen Arbeitssklaven treten).
Timothy Snyder hat in seinem lesenwert Buch „The Road to Unfreedom“ deutlich gemacht, dass und wie der Verlust an Bodenhaftung dazu führt, dass politische Fiktionen die Bühne erobern. Ins Politische übersetzt, lässt sich das, was hier als Unbewusstes in den Blick genommen wird, als Machtvakuum deuten, das nicht zufällig von politischen Mächten ausgebeutet wird: wie etwa Putins Internet Research Agency, die seit 2013 eine Art Cyberwar gegen die Ukraine, die EU führt und auch bei der Wahl Trumps eine entscheidende Rolle gespielt hat.
Le Bon schreiobt: »Nicht nur dann ist man religiös, wenn man eine Gottheit anbetet, sondern auch dann, wenn man alle Kräfte seines Geistes, alle Unterwerfung seines Willens, alles Gluten des Fanatismus dem Dienst einer Macht oder eines Wesens weiht, das zum Ziele und Führer der Gedanken und Handlungen wird.«
Ein schönes Beispiel dafür ist der Umstand, dass die Verschwörungstheorien im Twitter-Milieu zunehmend ohne theoretischen Unterbau auskommen, Verschwörungen ohne Theorien mithin.
Der Transistor, der die Basis für den integrierten Schaltkreis darstellt, ist nicht zufällig auch eine Photozelle, ebenso wie der Begriff der Nachhaltigkeit, wie er seit Dennis Meadows „Grenzen des Wachstums“ durch die Köpfe geistert, sich vor allem Computersimulationen eines Jay Forrester verdankt.