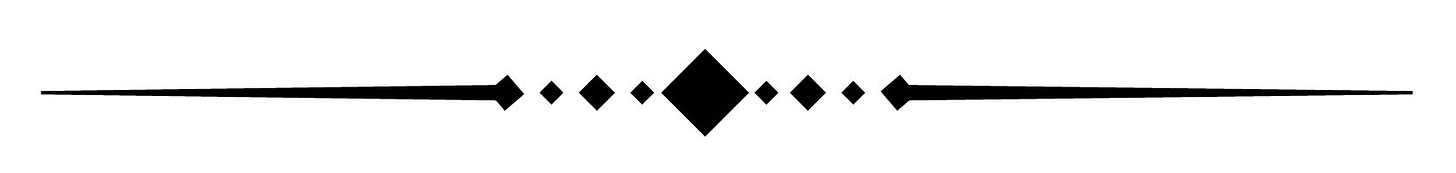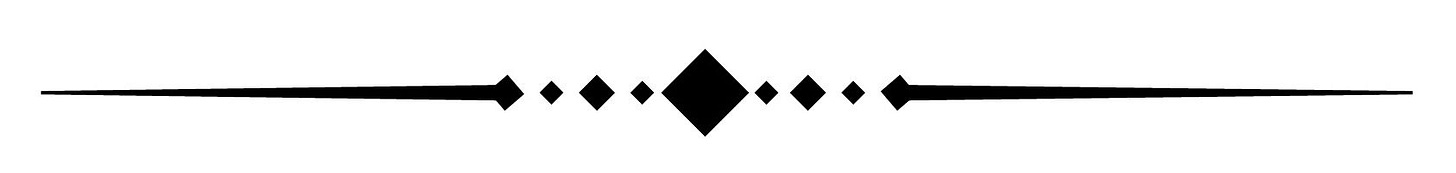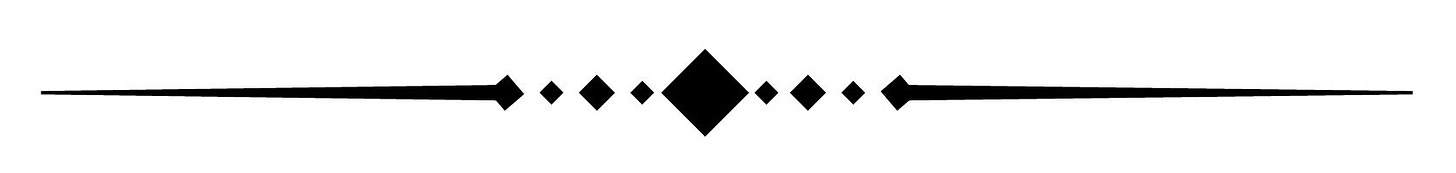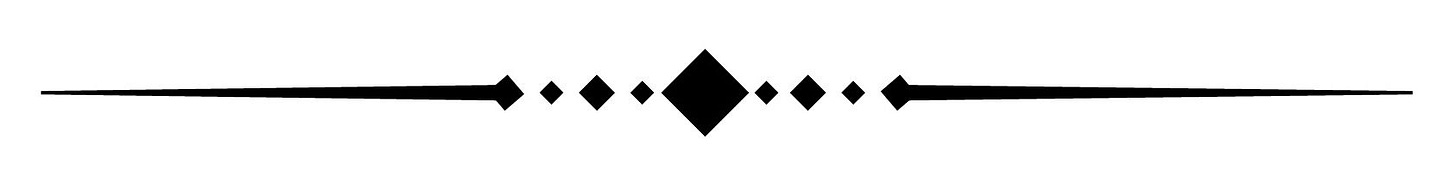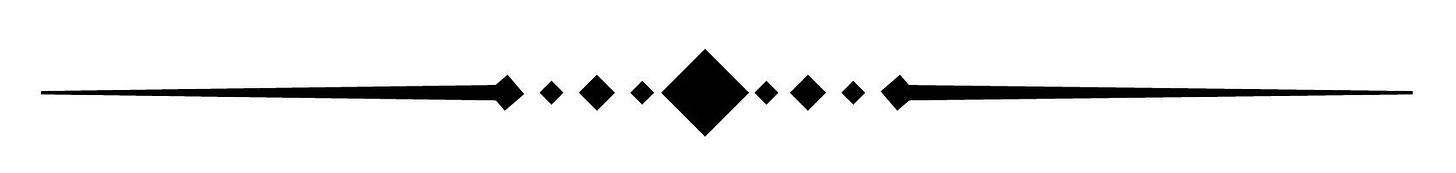Zur Einführung
Manchmal haben Texte ein sonderbares Schicksal. So wie der folgende, bei dem einer Einladung eine Ausladung folgte – ganz offenkundig, weil sein Inhalt dem Herausgeber-Team, das mit meinem Namen sein Buch hatte zieren wollen, so unerträglich war, dass, obschon das Thema des Buches die Bürgergesellschaft sein sollte, man alle bürgerliche Rücksichten über Bord zu werfen geneigt war. Es war die Zeit, da die Dotcom-Blase geplatzt war (und der sogenannte ›Dummen-Bonos‹ keinen geldwerten Vorteil mehr darstellte). Simplify your life, war das Gebot der Stunde, und weil die Intellektuellen bei alledem nicht abseits stehen wollten, hatten sie sich auf die Idee einer Bürgergesellschaft gestürzt. Hatte Ulrich Beck den Diskurs mit dem Credo eingeläutet: »Wir leben zweifellos in einem anti-hierarchischen Zeitalter«, so konstatierte er »eine Distanz gegenüber beidem: traditionellen Autoritäten und der Autorität des Staates«. Und weil man seine Zukunft nicht mehr in den Institutionen, sondern außerhalb sah, nahm der lange Marsch der 68er eine neue Wendung – und ließ das private Glück mit der Privatisierungslogik verschmelzen. Hier begann hier der Diskurs jenes Juste Milieu, den wir heute in Gestalt einer moralischen Ökonomie gegenüberstehen. Oder noch nüchterner gesagt: Es war der historische Augenblick, da die Ethik die Institutionen des Staates verließ und in die NGOs überging. Meine Haltung dazu war nicht unfreundlich, aber doch skeptisch. So unzweifelhaft es mir erschien, dass mit dem digitalen Zeitalter eine neue, post-bürgerliche Welt heraufdämmerte, so schien mir das Vertrauen in die hohe Moral der Bürgergesellschafter wenig begründet – ja, kam mir das ganze zivilgesellschaftliche Pathos wie eine Variante der neolibleralen Privatisierungslogik vor. Dabei musste man nicht weit schauen, um sich davon zu überzeugen, dass sich dahinter höchst fragwürdige Praktiken verbargen. Dass sich jedermann über die Schwerfälligkeit staatlicher Institutionen aufregte, ließ sich vielleicht noch nachvollziehen; aber dass der Kämmerer einer Stadt das Elektrizitäts- oder Wasserwerk seiner Gemeinde an ein New Yorker Anwaltskonsortium verkauft, um es anschließend selbst anzumieten (oder zu leasen, wie der Neologismus lautete), war schon weit weniger plausibel - umso mehr, als dieses Abschreibungsgeschäft nur deswegen geschah, weil sich damit der New Yorker Steuerzahler schröpfen ließ. Vor diesem Hintergrund klang das hochtönende Pathos der Bürgergesellschaft eher hohl. Ein weiterer, sehr viel tieferer Grund für meine Skepsis war, dass ich im Rückstieg in die europäische Geistesgeschichte gelernt hatte, dass für selbstverständlich genommene Institutionen höchst fragile Gebilde sein können. So hatte die Verwandlung des christlichen Mittelalters in ein modernes Gemeinwesen gut drei Jahrhunderte andauernden Bürgerkriegs mit sich gebracht und den Zeitgenossen jene geistige Schizophrenie aufgenötigt, die Shakespeares Hexen in ein konzises Motto übersetzt haben: Fair is foul, and foul is fair. Und weil ich die Geschichte des Geldes und der Zentralbank studiert hatte, lag der Gedanke nahe, die Idee der Bürgergesellschaft nicht für bare Münze zu nehmen, sondern als Auftakt einer Bewegung zu begreifen, die sich vielleicht am treffendsten als psychische Inflation charakterisieren lässt.
Hier also der Text aus dem Jahr 2000, noch in der alten Rechtschreibung verfasst.
Protect me from what I want
Oder: warum man sich eine Bürgergesellschaft lieber nicht ausmalen sollte
Was ist eine Bürgergesellschaft? Ein Sympathiebegriff, wie man lesen kann? Oder wie ich, in Anbetracht eines solchen Werbeschilds, sogleich mutmaßen würde: ein Begriffsungeheuer, eine lächelnde Monstrosität? Vielleicht ist das eine Frage, die positiv beantworten zu wollen man sich gar nicht erst anheischig machen sollte. Denn der Begriff ist von einer merkwürdigen Aura umhüllt, einem Lichtdunst von Freiheit und Künftigkeit, den man früher, als Ideologien noch als solche kenntlich waren, mit einiger Wahrscheinlichkeit ideologisch genannt hätte. Was aber wäre die dahinterstehende Ideologie? Hier wird man mit einer Kuriosität konfrontiert, die nicht bloß daher rührt, daß man wähnt, über jeglichen Ideologieverdacht erhaben zu sein. Das eigentliche Merkwürdige ist, daß den umlaufenden Vorstellungen zur Bürgergesellschaft keinerlei Rückstand von bürgerlicher Ideologie und Tradition innewohnt, sondern daß sie historisch gerade dort entstehen, wo die bürgerliche Epoche, der bürgerliche Habitus längst und durchaus nicht unfröhlich zu Grabe getragen worden ist. In diesem Sinn mag die Bürgergesellschaft alles erdenkliche verheißen (Bürgerarbeit, Bürgergeld, Bürgerverantwortung etc.), aber der Bürger, auf den sie sich bezieht, ist ein Mann ohne Eigenschaften, MannFrau, BürgerIn ohne Bürgerlichkeit. Damit bleibt die Bürgergesellschaft (in ihrem Kern) die Antwort schuldig, auf welchem Fundament sie zu ruhen, oder vielmehr: initiativ zu werden gedenkt. Genau dieser Leere wegen aber könnte man auf die Idee verfallen, hier nicht einem positiven Gedanken, sondern vielmehr einer semantischen Sonnenfinsternis zu begegnen, bei der wir lediglich die Corona des Gedankens, nicht aber seinen energetischen Kern zu Gesicht bekommen.
Mag diese Kernlosigkeit in den Debatten des Tages einen Positionsvorteil bedeuten (der Geschmeidigkeit des Arguments wegen, das endlich, vom Gewicht der Welt befreit, zur Volatilität des freien Gedankens gefunden hat), so ist sie doch Ausweis einer gründlichen Verlegenheit – könnte man zu der Einschätzung gelangen, daß es wesentlich darum geht, die conditio humana in post-bürgerlicher Zeit nicht zur Kenntnis zu nehmen, also um einen Abwehrzauber. Nicht zufällig tritt, wenn man einen zeitfremden Blick auf die Gegenwart wirft, die Ähnlichkeit zu anderen, hochproblematischen Übergangsepochen deutlich zutage. So wie die Gesellschaft des 14. Jahrhunderts den sich regenden Kapitalismus mit der Beschwörung der »prezzi christiani« und des gerechten Tausches zu bannen und zu bändigen versuchte (ohne großen Erfolg, wie man weiß), so sucht eine offenkundig post-bürgerliche Zeit den sich abzeichnenden Konflikten der Gegenwart mit einem Rückgriff auf eben jene Gedankenfigur zu begegnen, die es schon längst nicht mehr gibt. Ein solches Strategem aber scheint mir ein Präludium für eben jene philosophische Simulationstechnik zu sein, die man der Scholastik vorgeworfen hat: in Gedankenhohlformen zu Hause zu sein, nicht aber dort, wo die Wirklichkeit pulsiert (»Die Wahrheit liegt auf der Straße«, sagt Nicolaus von Cusa). Und weil dies auch für die Gegenwart gilt, mag man, ein post-bürgerliches Straßenbild vor Augen, fragen, warum noch immer vom Bürger, nicht aber vom Teilnehmer und Partizipanten gesprochen wird (der doch der eigentlich Adressat der Bürgergesellschafts-Konstruktion ist).
Ganz offenbar – und dies ist eine Antwort darauf – bedarf es einer emphatischen Verheißung, um eine Gesellschaft formieren zu können, ist die Zusage der formellen Teilhabe allein keineswegs hinreichend. Genau hier tritt der Bürger der Bürgergesellschaft auf den Plan, und genau hier wird seine Mission offenbar. Sie besteht – nicht mehr und nicht weniger – darin, den unerläßlichen Gesellschaftsklebstoff zu liefern. Er liefert, was dem Neuen fehlt: die Selbstverständlichkeit des Tradierten, Legitimation; und er liefert darüber hinaus (wenn auch als Hohlform) die Idee eines politischen Subjekts: also Identifikation. Wenn man sich an die alten Beschreibung des Menschen als zoon politikon erinnert fühlt, so liegt dies durchaus in der Absicht, sind die Fundamente der abendländischen Demokratie doch ein gutes Sprungbrett für ihre Umgestaltung. Diese Absicht aber für die Sache selbst zu halten, ist irrig. Denn man würde, im Blick auf das Kontinuum, die revolutionäre Konterbande des Konzepts verpassen. Denn das Bemerkenswerte an der Bürgergesellschafts-Formel ist, daß nicht mehr ein übergeordneter Rahmen (Religion, Königreich, Nation oder Sprache) als Gesellschaftskonstitutivum gilt, sondern vielmehr der einzelne. Dies aber bedeutet einen Riß ersten Ranges. Dieser Riß betrifft die Sprache der Macht: und er verläuft zwischen dem tradierten, zentralperspektivischen Herrschaftssystemen zur dezentrierten Gesellungsform, vom monolithischen Herrschaftsblock zur dissipativen, translokalen Struktur, vom Baum zum Rhizom. Der Formeln, um diesen Riß zu beschreiben sind viele, die Botschaft ist eindeutig: Der Bürger, das freigesetzte, zugleich bündnisbereite Subjekt, soll an die Stelle des nationalstaatlichen Souveräns treten. In diesem emphatischen Sinn könnte der Bürger, an dem nichts Bürgerliches mehr haftet, das endlich erwachte Subjekt der Geschichte sein, Weltseele, Weltgewissen, Weltbürger. Folglich ist es auch keineswegs zufällig, daß der Begriff besondere Wirkung dort entfaltet, wo die tradierten, d. h. immer auch: die zentralperspektivisch verfaßten, dem Repräsentationsmodell Verpflichteten Gesellschaftsformen, zunehmend gelöchert und fragwürdig werden. Weil in den Visionen der Bürgergesellschaft das antiautoritäre, antihierarchische Moment Motor ist, ist nicht Ruhe, sondern Initiative und Intervention erste Bürgerpflicht. Freilich macht die Negation als solche noch keinen Staat, stellt sich vielmehr die Frage, wie die unterschiedlichen Standpunkte sich auf ein Gemeinsames hin verpflichten können. Wie wird, so fragt Ulrich Beck, eine postnationale und zugleich politische Bürgergesellschaft möglich? Aber so wagemutig diese Fragestellung den Fortfall der tradierten Institutionen voraussetzt, so blaß und farblos bleibt sie doch, was die Physiognomie ihres Helden anbelangt – kommt man hier kaum über das Idealbild des aufgeklärten Weltbürgers hinaus. Wishful thinking oder: Der Aufstand der Anständigen.
Anders gesagt, von der Wirkkraft des Wortes aus betrachtet: Nicht in dem, was das Wort sagt, liegt seine Bedeutung, sondern in dem, was es verheißt. Erst im Drumherum, im Lichtschein der Eklipse entfaltet es sich. In diesem Sinn appelliert die Rede von der Bürgergesellschaft nicht an den Realitäts-, sondern an den Möglichkeitssinn. Wenn sie Anziehungskraft besitzt, so gerade deswegen, weil sie kein präzises Bild als vielmehr wolkiger Zukunftsentwurf ist, verschleierte, aber deswegen überaus begehrte Zukunft. So besehen, um dem Konzept Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und es nicht als bloßes Ideologem abzuqualifizieren, wären die Träume zu untersuchen, die hier hinein spielen. Worin besteht die Verheißung, worin besteht auch die alltägliche Praxis, die sich den Titel der Bürgergesellschaft auf die Fahnen geschrieben hat?
Da steckt, zunächst einmal, die Romantik des Citoyens darin (der bereits der Bürgerbewegtheit der siebziger und achtziger Jahre souffliert hat). Vor diesem Hintergrund besehen wäre das Bild der Bürgergesellschaft nichts weiter als die logische Fortschreibung des alten Aufklärungsprogramms: Befreiung aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Freilich ist zu bemerken, daß in dem Maße, in dem die politische Botschaft sich gleichsam verflüchtigt hat, das Revolutionspathos – das ehedem einem kollektivistischen Impuls frönte – sich ins Private zurückgezogen hat. Es ist der einzelne Bürger, der hier sein politisches und moralisches Wolkenkuckucksheim begrünt und sich, gesellschaftlich alimentiert, überaus komfortabel darin eingerichtet hat (womit er der Formel der »gelebten Utopie« eine wenn auch nicht überzeugende, so doch physiognomisch prägnante Wirklichkeit verliehen hat). Man mag dies als Hypokrisie, als postmodernes Philistertum abtun. Mit einem grundfremden, historischen Blick betrachtet macht dieser Typus des Zeitgenossen deutlich, an welcher Batterie des Revolutionspathos des 18. Jahrhunderts eigentlich hin: nicht an einer dezidierten, politischen Lehre, sondern an der Unmittelbarkeits-Religion eines Jean-Jacques Rousseau.1 So besehen wäre Politik der Moderne immer schon (auch dort, wo sie sich kollektivistisch verbrämt hätte) Identitäts- und Selbstverwirklichungspolitik gewesen.
Ein anderer, vielleicht bedeutsamerer Energiespender des Bürgergesellschaft-Phantoms ist nicht so sehr theoretisch verwurzelt, als vielmehr in zeitgenössischen Praktiken und Lebenserfahrungen begründet. Es ist die Erfahrung der grenzüberschreitenden Mobilität, die Erfahrung, daß der Bewegungsradius des Einzelnen weit über die Grenzen der tradierten Großräume hinausgeht. Daß die Rede vom »Ende der Nationalstaaten« heute so leichtfüßig, leichtfertig daherkommen kann, beruht darauf, daß sich mit dem Internet eine Kommunikationsmaschine neuen Typs eingestellt hat, ein Gebilde, das nicht von ungefähr neue Leviathans-Gedanken auf sich zieht. Der entgrenzte Einzelne, so könnte man sagen, wächst jener imaginären Körperschaft, die bislang die Grenze seines Handelns bestimmte, über den Kopf. So ist es nur folgerichtig, daß er sich als Souverän wähnt, als diejenige, über dem nichts höheres (supera neus) mehr ist. Nun ist dies keineswegs eine bloß individuell verspürte Regung; der politische Raum ist bereits ein Symptom dieser Machtverschiebung. Wenn Politiker mit dem Argument des Standortvorteils um Investitionen buhlen, so bezeugen sie damit nicht nur Pragmatismus und Realitätssinn, sondern vor allem, wie sehr die lokale Macht vom weltbürgerlich frei flottierenden Kapital abhängt.
Sofern man denn Groß-Formeln liebt, könnte man sagen, daß der Kapitalismus in ein postnationales Stadium übergetreten ist, ein Stadium, in welchem dem einzelnen eine unerhörte, bis dato nicht für denkbar gehaltene Freizügigkeit zukommt. Wo ehedem zentrale gesteuerte Einheiten über das Wohl und Wehe der Bürger verfügten, schalten nun die »Privaten«, die sich ihrerseits nicht als industrielle Warlords, sondern als Provider, Server, dienstbare Geister begreifen wollen. Wenn hier, statt von Bürgern, von den »Privaten« die Rede ist, so ist diese Begriffsverlagerung, der Verschärfung des Gedankens wegen, durchaus beabsichtigt. Tatsächlich ist das Bild des Bürgers (in dem ein Subjekt-Begriff des 18. Jahrhunderts fortwest, mit all seinen romantischen Implikationen) wenig hilfreich, um jener neuartigen Gemengelage zu begegnen. In diesem Sinne würde ich den Privaten eben nicht bloß den einzelnen, sondern auch jene gemeinhin so genannte Körperschaften zuordnen. Tatsächlich liegt hier kein Gegensatz (nach dem bekannten Muster Individuum versus Gesellschaft), sondern bilden Server und Client ein gedankliches und weltanschauliches Aggregat, eine Interessenskoalition, die sich vor allem aus den Arbitragegewinnen speist, die der Privatisierungsakt mit sich bringt. Es sind die Ressourcen eines nicht mehr als bindend erfahrenen Gemeinwohls, die in die Hände einzelner übergehen. Es nimmt nicht Wunder, daß die korrespondierende Ideologie der wirtschaftliche Neoliberalismus ist, der aber – und das ist bezeichnend – die Privation nicht mehr im Register der politischen Ökonomie, als vielmehr im Sinne des shareholder value betreibt. Frech kommt weiter.
Wirklich ist höchst bemerkenswert, in welchem Maße und auf welch breiter Front die »Privaten« staatliches Hoheitsgebiet erobert, klassische Monopole geschleift und aus dem kollektiven Bewußtsein vertrieben haben. Dabei ist der Privations-Impuls nun keineswegs etwas, das dem System allein von außen zustieße. Vielmehr wird er von den Trägern des Systems selbst promoviert und vorangetrieben – was nahelegt, daß über die Notwendigkeit dieses Aktes kein ernsthafter Zweifel besteht. Mag unter den Akteuren dieses Prozesses Einverständnis herrschen, so besteht doch kein Zweifel daran, daß es sich nicht bloß, wie man dies vornehm umschreibt, um einen Akt der Deregulierung, sondern um eine sozialrevolutionäre Bewegung handelt. Tatsächlich wird das sozialrevolutionäre Moment in seiner ganzen Schärfe nur sichtbar, wenn man sich den Einsatz, das quasi-religiöse Pathos vor Augen hält, mit dem die Nationalstaaten des 19. Jahrhunderts die kommunikative Vernetzung betrieben haben, sei es in Form von Telegraphenleitungen, Eisenbahnengleisen oder Industriestandards. Wie die Kathedralen des Mittelalters das himmlische Jerusalem auf Erden zu errichten suchten, so sind die Netzwerke des 19. Jahrhunderts letztlich als spirituelle Bauwerke aufzufassen, Kommunikationskathedralen, die die Gemeinschaft zusammenschweißen sollten. Galt im 19. Jahrhundert die Sorge vor allem der Konstruktion der materiellen Architektur, so setzten die fertiggstellten Netze die Staaten des 20. Jahrhunderts (die Demokratien, aber ebenso die Totalitarismen) in Stand, das Hochamt der Gleichschaltung feiern, womit, in heißer Form, vorweggenommen wurde, was uns heute unter anderen Vorzeichen (und in ungeregelter Form) als Mediendemokratie begegnet. So besehen sind die Gemeinwesen der Moderne immer auch Inszenierungen ihrer selbst, eignet ihnen ein operettenhafter Zug, ein fataler Hang zur Ästhetisierung der Politik. Dies ist keineswegs zufällig so, also keine Aberration, sondern eine Struktur der modernen Gesellschaft. Weil die Simulation der Macht nichts ohne die Macht der Simulation, hängt man unweigerlich an jenen Batterien, die die Gleichschaltung des Gemeinwesens besorgen. Und so folgen die Führerfiguren der Logik des Kommunikationsapparaturen, sind sie erfolgreich nur in dem Maß, in dem sie diese zu bedienen wissen.
Freilich: hier ist ein struktureller Konflikt angelegt. Denn das Netzwerk weist stets über den begrenzten Raum hinaus; in diesem Sinn mag der kultisch inszenierte Nationalstaat als bloßes Interregnum, als Übergangsphase in die Geschichte eingehen. Insofern ist es vielleicht kein Zufall, daß die den Netzen innewohnende Entgrenzungslogik sich in paradoxe Formeln wie dem »Volk ohne Raum« hinein entladen hat (ein Desiderat, das in der postnationalen Bürgerschaft der Netzbürger seine Einlösung gefunden hat). Gleichwohl wäre es doch irrig, die Konstruktion des Netzes von seinem Endstadium her aufzudröseln. Denn genealogisch und in der Perspektive seiner Architekten war stets der nationalstaatliche Rahmen Bezugsgröße, war es ein staatliches Monopol, das, als quasi-transzendentale Instanz, den einzelnen Volksempfänger zu versorgen und je nachdem, fürsorglich oder terroristisch, gleichzuschalten bestrebt war.
Tatsächlich ist der Zusammenhang von telematischer Machtbatterie und moderner Nation, oder um es anders zu sagen: die Elektrifizierung der Politik, ein weitgehend ausgesparter Fleck der Geschichtsbetrachtung. Gleichwohl: folgt man einmal dieser Spur, so wird man mit einer Fülle von Material konfrontiert. Ob man hier der Leninschen Formel begegnet, Sozialismus sei Sowjetmacht plus Elektrifizierung, ob man auf Goebbels stößt, der das Radio zum »braunen Haus«, zur Bundeslade des Deutschen Reiches macht (aber andererseits, überaus medienbewußt, weiß, daß man dem Konsumenten nur zehn Prozent Propaganda zumuten, ihn ansonsten aber nur mit leichter Kost füttern darf), ob man die unamerikanischen Machenschaften der McCarthy-Ära studiert, die eine merkwürdige Verkopplung von Werbezeit und politischer Akzeptanz herstellen, oder ob man schließlich die Seifenblasenproduktion aus dem transpolitischen Reich des Silvio Berluscio in Augenschein nimmt – immer wird klar (und zwar über sämtliche ideologischen Grenzen hinweg), daß sich Herrschaft in der Moderne aus der Herrschaft über die telematischen Ressourcen speist. Der Souverän der Moderne ist ein elektrischer Reiter. So besehen ist der Staatsstreich, der zuallererst das staatliche Fernsehzentrum, das heißt: das Informationsmonopol attackiert, der präzise Indikator dieser Ordnung. Setzt man dies aber als Prätext voraus, so kommt man gar nicht umhin, die Liberalisierung der Telekommunikations-Netzwerke, wie sie sich seit einiger Zeit abzeichnet, als eine Form des kalten Staatsstreichs auffassen. Was aber – und zumal in Anbetracht der Vorgeschichte – erstaunt, ist die Geräuschlosigkeit, ist auch die Widerstandlosigkeit, mit der sich diese feindliche Übernahme vollzieht.
Nun aber sollte man sich hüten, allzuschnell ins Klagelied der neuen Staatsfeinde einzustimmen. Denn immerhin wäre denkbar – und genau diese Hypothese soll im folgenden belegt werden -, daß die Nationalstaaten des 19. Jahrhunderts keineswegs autochthone, naturwüchsige Gebilde waren, sondern sich im Zeichen jenes Medienkomplexes konstituierten, der heutzutage an ihrer Abschaffung arbeitet. Auch dies hätten sie mit den Kathedralen des Mittelalters gemein, die eben nicht nur den Ort der Gemeinschaft, der gemeinschaftlichen Überwölbung stifteten, sondern im Schatten der Kathedrale eben jene Techniken heranzüchteten (Arbeitsteiligkeit, Notwendigkeit des Kapitalverkehrs etc.), an denen die mittelalterlichen Gemeinwesen schließlich zugrunde sehen sollten. In gewisser Hinsicht lautet die Theorie also, daß der Privationsprozeß, dem wir beiwohnen, eine historische Notwendigkeit darstellt. Um diesem Gedanken, der ansonsten kaum mehr als ein bloßes Luftgebilde wäre, die nötige Prägnanz zu verleihen, möchte ich mit einer bizarr anmutenden These aufwarten. Und zwar vertrete ich die These, daß das Internet kein Artefakt unsere Tage ist, sondern seinen Ursprung im Jahr 1746 hat. In diesem Jahr, das sich ansonsten nur durch seine vollkommene Ereignislosigkeit auszeichnet, kommt es zu einer denkwürdigen Szene. Da postieren sich 600 Kartäusermönche in einem großen Kreis, mehrere hundert Meter im Durchmesser, und verdrahten einander mit Eisendraht. Schließlich berührt einen der ihren eine Flasche, die mit Wasser gefüllt ist und aus der eine Art Antenne herausragt. Und was passiert? Alle Kartäusermönche beginnen zu zucken, gleichzeitig. Die Auflösung dieses merkwürdigen Experimentes ist leicht zu bewerkstelligen. Und zwar handelt es sich bei dem mit Wsser gefüllten Behälter um die Leydener Flasche, das heißt: um Elektrizität. Die Frage, die der Versuchsanordnung zugrundelag, lautete: wie schnell ist die Elektrizität? Und die Antwort darauf: Die Elektrizität ist so schnell, daß es hier keine Zeitversatz gibt, alle Mönche zucken in Echtzeit. Fragt man sich, was das Charakteristikum eines Prozessors ist, so besteht es just darin, daß zwischen dem Raumpunkt A und dem Raumpunkt B kein Zeitgefälle besteht, daß sie beide zeitlich gleichgeschaltet und getaktet sind. Vor dieser Folie könnte man den Kreis der zuckenden Mönche einen Humanprozessor nennen. Fragt man nun danach, welche Funktionen der einzelne in diesem Kreis hat, so ist evident, daß hier, wo einer im anderen steckt, der Begriff des Individuums wenig Sinn macht. Sehr viel präziser wäre es, vom Dividuum zu sprechen. Dieses Dividuum ist per se Massewesen, selbst dort, wo das Moment der Verdrahtung in die Unsichtbarkeit oder in bloß symbolische Verhältnisse eingetreten ist.
Das Bedeutsame dieses wissenschaftlichen Versuchs für die politische Theorie liegt darin, daß hier zum erstenmal in der Geschichte ein Menschenhaufen zu einem Bewußtsein seiner selbst kommt, oder genauer vielleicht: weniger zu einem Bewußtsein, als vielmehr zur Sensation seiner selbst, einem viszerären, alle Sinne ergreifenden Gemeinschaftsgefühl. Dieser Menschenhaufen stellt eine Körperschaft neuen Typs dar, die jedoch – das ist das erstaunliche – als Gebilde noch kaum zur Kenntnis genommen worden ist. So gibt es zwar eine reichhaltige Literatur zur Massentheorie, jedoch schweigen sich die klassischen Theorien, von le Bon, Freud, Broch oder Canetti, über die physikalische Masse weitgehend aus. Dieses Schweigen im Falle Freuds etwa ist um so erstaunlicher, als sich Freuds geistiges Instrumentarium ganz eindeutig den naturwissenschaftlichen Begriffen der Elektrizität verdankt (Widerstand, Ladung etc.) – was den Verdacht nährt, daß dieser neue und präzedenzlose Massetypus mit den tradierten Denkformen gründlich bricht. Liest man Freuds »Massenpsychologie und Ichanalyse«, so kann man sehen, daß Freud seinen Massebegriff am Geist des Vaters ausrichtet – daß er in den künstlichen Massen von Kirche und Heer Projektionsmechanismen am Werk sieht, die in Gestalt des geistlichen oder weltlichen Führers einem Vaterersatz folgen. Nun ist es nicht ohne Ironie, daß der Abbé Nollet (dem die Versuchsanordnung der elektrischen Mönche sich verdankt) in seinen beiden Demonstrationen auf eben diese beiden historischen Masseformationen zurückgreift, daß er, mit einem Schlag, die Feldstärke der Soldaten unter Beweis stellt – ebenso wie er seine Kartäuser, man muß wohl sagen, in Verzuckung geraten läßt. Damit aber stellt er machtvoll unter Beweis, daß diese Menschenhaufen, um Masse zu werden, keiner Projektionsgestalt mehr bedürfen. Wenn die Leiber zu einer Masse zusammengeschweißt werden, so geschieht dies nicht mehr über irgendein Idol oder irgendeinen Repräsentanten, es geschieht nicht einmal im Zeichen von etwas, sondern es geschieht unmittelbar. Nein, »Unmittelbarkeit« ist grundfalsch, denn es gibt ein Medium: die Elektrizität. Dies ist in der Tat eine Umcodierung ersten Ranges. Denn es ist nunmehr der nonpersonale Agent, der die Rolle des Vaters einnimmt – oder der sie vielmehr überflüssig macht. So ist es vielleicht kein Zufall, daß die solcherart über sich selbst informierte Masse sich alsbald ihres Königs entledigt, um sich höchst metaphorischen Gebilden zu verschreiben: dem Höchsten Wesen und der Nation. In diesem Sinn könnte man sagen, daß der König lange vor den Wirren der Französischen Revolution schon gestorben ist Denn er ist in einer Welt, wo einer im anderen steckt und alle miteinander an der Batterie der Masse hängen, notwendig Fremdkörper. Und vielleicht ist es das, was die französischen Revolutionäre in Wahrheit feierten, als sie das Fest des Höchsten Wesens inaugurierten: nicht den Menschen, sondern die Batterie, die ihm die Empfindung verleiht, einer im andern zu sein. Liberté. Egalité. Fraternité.
Mag all dies den Akteuren des Geschehens im Jahr 1746 noch kaum bewußt gewesen sein, so ist doch evident (und liest sich retrospektiv nachgerade wie eine Serie von Zwangsläufigkeiten), welcher Art die Phantasien sind, die der in Formation gebrachten Körperschaft entspringen: das, was man heute (zumeist unter Vernachlässigung der historischen Genealogie, aber auch unter Vernachlässigung der Frage, was man unter Informaton zu verstehen habe) Informationsgesellschaft nennt. Da die Elektrizität die Mönche zu einem real time-Aggregat zusammenschweißt, scheint der Raum keine Grenze mehr zu sein, lassen sich virtuelle Gemeinschaften, Gelehrtenrepubliken, Weltbürgerschaften etc. denken, die nicht mehr qua Geburt auferlegt, sondern über freie Wahl konstituiert werden. Zugleich gibt es das Begehren, über die Begrenztheit selbst hinauszugelangen. Der Kreis der Mönche, abstrakter gesprochen: das telematische Netzwerk soll weltumspannend, weltbürgergleich werden. Diese Form der praktischen Transzendentalphilosophie nimmt vorweg, was um die Wende zum 18. Jahrhundert die tiefsinnigsten Geister beschäftigt. In diesem Sinne ist die Rede von der Globalisierung, die seit vielleicht zwei Jahrzehnten die Presse bewegt, in der Geistesgeschichte der Moderne längst vorweggenommen – haben wir es nicht mit einem Novum, sondern mit einer Erbschaft des 18. Jahrhunderts zu tun. Aber nicht nur die Entfernung der Welt steht seither auf der Agenda, sondern auch das Ende der Repräsentation. Die Masse der Moderne formiert sich nicht mehr im Zeichen eines Dritten, nicht mehr in der Logik der Repräsentation, sondern unmittelbar: als eine gleichsam physikalische Größe. Damit aber wird das Stellvertretungsmodell, daß seit dem Mittelalter als Desiderat, seit Hobbes als Herrschaftspraxis Bedeutung besaß, fragwürdig. Paradox formuliert, könnte man zu der Auffassung gelangen, daß dem modernen Nationalstaat von Anbeginn seine Aufhebung, eine postnationale Bestimmung sozusagen eingeschrieben gewesen wäre.
Anders gesagt: das, was sich heute als Bürgergesellschaft geriert, ist seit dem 18. Jahrhundert eine beständige Unterströmung. So besehen sollte man den Subjektentwurf studieren, der hier obwaltet. Freilich: an dieser Stelle wird man mit einer merkwürdigen Absence konfrontiert, einem wenig ausgeprägten Problembewußtsein, was die conditio humana des modernen Dividuums, mit all seinen Spaltungen und Ambivalenzen, ausmacht. Stattdessen begegnet man hier einem schlichten Selbstverwirklichungsmodell, in dem man unschwer die Überbleibsel der Rousseauschen Unmittelbarkeits-Philosophie orten kann. In der Tat – vor der Folie der Repräsentation-Kritik, oder umgekehrt: vor der Verheißung der direkten Demokratie – ist die Beschäftigung mit Rousseau überaus erhellend, und zwar gerade dort, wo man nicht dem Gehalt, sondern vor allem der Leerstelle seiner politischen Theorie begegnet. Als empfindsamer Sensor seiner Zeit spürt er, daß die Idee der Repräsentation an ihr Ende gekommen ist; mehr noch, er brandmarkt sie geradezu als den Sündenfall der Gesellschaft, den Auftakt zur gesellschaftlichen Unfreiheit. Dagegen stellt er sein ideales Gesellschaftsmodell, Clarens, die Gesellschaft der innigen Seelenverwandten, die in frugaler, schöner Weise miteinander Leben. Wie aber finden sie zueinander? Es ist der Gleichklang der Seelen, der sie zusammenführt, eine mirakulöse, durch nichts vermittelte und vermittelbare Übereinstimmung. Wo Rousseau indes der Vermittlung begegnet, argwöhnt er Korruption, Niedergang, Sklaverei. Vor diesem Hintergrund ist es kein Zufall, daß insbesondere das Geld perhorresziert wird: »Das Wort Finanzen ist ein Sklavenwort und in einem wirklichen Gemeinwesen unbekannt.«2 Mit anderen Worten: die empfindsame Seele will Unmittelbarkeit, keinesfalls aber will sie jenes Band der Abstraktion zur Kenntnis nehmen, das die Mönche des Abbé Nollet so schön veranschaulichen.
An dieser Stelle komme ich zum Kern der Problematik: der Frage, den der Begriff der Bürgergesellschaft eher verdeckt denn freilegt, der Frage nach jenem Konstitutivum, das versprengte Menschenhaufen zu einer Gesellschaft formiert. Vor dem Hintergrund scheinbar naturwüchsiger Nationalstaaten, die es vorziehen, sich über Blut und Boden zu definieren anstatt sich als mediale Konstruktion – und damit als Simulationen ihrer selbst – zu begreifen, ist dies kein leichtes Unterfangen. Freilich: betrachtet man die Genealogie des europäischen Nationalstaates mit seinen vornehmsten Privilegien (Gewaltmonopol, Konskription, dem Recht der allgemeinen Steuer), so ist man damit konfrontiert, daß man es mit einem Artefakt zu tun hat – einem Kunstprodukt, das unter unendlichen Mühen und Leiden erst zu jener uns bekannten Form fand. Die Initiale diese Form liegt nun keineswegs, wie man mutmaßen könnte, in einem besonderen Nationalempfinden. Noch im 14. Jahrhundert konnten die Bewohner der Normandie sich daran delektieren, daß die verhaßten Nachbarn (die Bretonen) von solch schwächlicher Konstitution waren, daß sie von der Pest dahingerafft wurden wie die Fliegen. Was viel mehr zur Konstitution des Nationalstaates bei trug, war die Notwendigkeit, zu einem gemeinsamen symbolischen Verkehrsmittel zu finden, eine Notwendigkeit, die durch großräumige wirtschaftliche Transaktionen hervorgerufen worden. Bis ins Mittelalter war die Emission der Münze eine Sache der Souveräns. Als Besitzer der Münze stand es dem Souverän frei, das Substrat des Geldes zu wählen, statt Gold hätte er ebenso gut Leder, Papier oder einen anderen minderwertigen Stoff nehmen können. Als die Gesellschaften nach Goldwährungen verlangten und die ersten Fürsten (wie Ludwig der Heilige) dem nachkamen, lag es nahe, sich über die Prägung einer minderwertigen Münze, also über Fälschung in den Besitz der höherwertigen zu bringen – und nicht wenige Fürsten erlagen dieser Versuchung. Vor dem Hintergrund der daraus resultierenden Währungskriege stellt Nicolas von Oresme, ein Denker des 14. Jahrhunderts, die Frage: Wem gehört das Geld? Anders als die Theologen seiner Zeit, die auf die Idee des gerechten Preises (und damit: auf das ethische Dilemma) fixiert sind, erklärt Oresme, das Geld sei eine Sache der Gemeinschaft, folglich gehöre es allen. Geld, mit anderen Worten, ist ein Omnibus. Aber damit dieser Omnibus laufen kann, muß man die Türen schließen, muß eine gemeinnützige Instanz gewählt werden, welche die Gesellschaft mit der Münze versorgt. Derjenige, der am Steuer dieses Omnibus sitzt und von den Mitfahrer einen Fahrpreis (eine Steuer) entrichtet, ist nicht mehr Souverän im vollen Sinne des Wortes, sondern Repräsentant. Historisch besehen ist das Primat der Ökonomie ein Faktum. Es ist das Dilemma des Geldes, das den Nationalstaat und seine vornehmste Institution: die Zentralbank erzwingt.
In diesem Sinne ist der Nationalstaat nicht nur ein Monopolist der Gewalt, sondern auch des Zeichensystems (was sich in der Figur des »gesetzlichen Zahlungsmittel« niederschlägt, wie in der Drohung, jedes Vergehen gegen dieses heilige Gut strengstens zu ahnden). Da nun aber Geld nur bis zu einem gewissen Grade materiell gedeckt wird – der Ökonom Hajo Riese hat dafür die wunderbare Formel gefunden: Geld sei ein knapp gehaltenes Nichts -, ließe sich die allgemeinere Formel ableiten: die Funktion der Macht ist die Produktion des Scheins. Im Zeichen des Scheins erst findet sich jene Gesellschaft, die wir im Zeichen des Nationalstaates blind voraussetzen, zusammen. Nun stößt man hier auf eine merkwürdige Variante jenes allgemeinen Verblendungszusammenhangs, den die Frankfurter Schule, in kritischer Absicht, beäugte. Merkwürdig deswegen, weil man sagen muß, daß dieser allgemeinen Verblendungszusammenhang (die Geldillusion), das Konstitutivum des neuzeitlichen Staates ist, diesem also eine Form der konstitutionellen Unbewußtheit eingeschrieben ist. Erst in dem Maße, indem sich der Untertan über die Herkunft des Scheins keine Gedanken zu machen hat, gewinnt der Schein Geltung – und vermag als Geld zu zirkulieren. Der Gesellschaftsvertrag, so könnte man auch sagen, beruht letztlich darauf, daß man ihn nicht zur Kenntnis nennt. In diesem Sinne ist – wenn man das Marxsche Konzept einmal einer besseren Verwendung zuführen möchte – das Nationale des Nationalstaates ein Überbauphänomen, also jene notwendige Rauschmittel-Dosis, die notwendig ist, um nicht zur Kenntnis nehmen zu müssen, auf welch unsicherem Grund die Gesellschaft letztlich ruht.
Freilich: gelegentlich bekommt man doch die Grundlagen des Gesellschaftlichen, genauer: ihre Abgründigkeit zu Gesicht. Eines der erstaunlichste Exempel für die Wirksamkeit der Geldillusion ist nicht zuletzt der Prozeß der deutschen Teilung und Wiedervereinigung. Gut 40 Jahre der politischen, gedanklichen und kulturellen Segregation genügten, um zwischen den beiden Teilstücken ein Gefühl gegenseitiger Fremdheit zu erzeugen, die den Gedanken einer sozusagen naturwüchsigen Einheit konterkarierte. Was indes Einheit stiftete, war das erstrebte Zeichensystem (manifestiert in jenen Demonstranten, die 1990 an der Grenze aufmarschierten und skandierten: »Kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, so gehen wir zu ihr!«).
Nun gestaltet sich die Produktion des Scheins keineswegs mehr so unproblematisch, wie dies zu früheren Zeiten (per ordre de Mufti) möglich war. Tatsächlich ist hier, ziemlich genau an jener historischen Bruchstelle, der auch die Vorstellung der Bürgergesellschaft entwächst, eine Revolution ersten Ranges zu orten, eine Revolution, die mit all ihren Implikationen noch gar nicht ins Bewußtsein gedrungen ist – nicht zuletzt deswegen, weil noch immer der Aberglaube vom Primat der Politik in den Köpfen herumspukt. Es handelt sich um das Ende von Bretton Woods (das seinerseits den Schlußpunkt einer Ordnung markiert, die zutiefst mit dem Bestand des modernen Nationalstaates geknüpft, aber schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts einer Zerreißprobe unterstellt war). Zunächst einmal: was ist die Bedeutung jener Ereignisse, die als das Ende von Bretton Woods in die Geschichte eingingen und die Ära des free floating ankündigten? Nach den finanzpolitischen Katastrophen der Zwischenkriegszeit hatten sich die führenden Nationen im Jahr 1944 in Bretton Woods auf ein System fester Wechselkurse verständigt, dessen Basis der Dollar war; dieser wiederum war durch die in Fort Knox gebunkerten Goldreserven gedeckt. Die Vereinbarung sah nun vor, daß jeder ausländische Souverän seine in Schein-Form gehaltenen Dollar-Reserven jederzeit in Gold umtauschen könne, und zwar zum Preis von 35 Dollar pro Feinunze Gold. Im Grunde war dieses Arrangement, grundiert von den Katastrophen des 20. Jahrhunderts, bereits eine Reminiszenz, der Versuch nämlich, das goldene Zeitalter des Nationalstaates zu restituieren. Zu jener Zeit, als die Nationalstaaten die telematischen Batterie monopolisierten und zur Staatsangelegenheit machten (um die Mitte des 19. Jahrhunderts also) schritt das englische Weltreich zur Ausgabe einer eigenen Goldwährung – und die anderen Nationen folgten diesem Beispiel. So kam es zu einem überaus stabilen Weltwährungssystem, das bis zum Ausbruch des 1. Weltkriegs Bestand hatte. Fragt man nach dem Grund für diese erstaunlich haltbare Architektur, zumal in Zeiten, da die herrschenden Nationen sich eifersüchtig um den »Rest der Welt« stritten, so ist die Antwort darauf, daß es den Staaten des 19. Jahrhunderts vor allem auf die internationale Satisfaktionsfähigkeit (also Handels- und Handlungsfähigkeit) ankam und daß sie in diesem Bestreben nicht durch populistische Erwägungen behindert waren.3 Dies änderte sich jedoch gründlich, als mit den sozialen Verwerfungen des Ersten Weltkrieges der Demokratiegedanke Geltung fand und die Neigung wuchs, um der innenpolitischen Pazifizierung oder Profilierung willen die Notenpresse anzuwerfen, die Geldpolitik also der Sozialpolitik zu opfern. Da aber diese unbillige Scheinproduktion wiederum Auswirkung auf die internationalen Finanzmärkte hatte, kam es zu jener fatalen Abwertungsspirale der dreißiger Jahre – bei der ein Land sich durch Abwertung der eigenen Währung einer Fremdwährung gegenüber einen Vorteil versprechen konnte. So produzierte die Massegesellschaft der Moderne, in dem Augenblick, als sie die internationale Satisfaktionsfähigkeit dem Wunschdenken der Masse opferte, ihre jeweiligen Phantasmen – und die korrespondierenden Finanzkatastrophen.
Um eine Wiederholung dieses monetären Katastrophen zu verhindern, schnürte man sich in Bretton Woods, in einem nachgerade orthopädischen Disziplinierungsakt, ins Korsett der Golddeckung. Damit war das Dilemma des Scheins, für gut zwanzig Jahre, zumindest gebannt. Bereits in den frühen sechziger Jahren jedoch wurde sichtbar – und im Grunde war dies nur ein Effekt der fortschreitenden internationalen Verflechtung -, daß die Goldreserven der Vereinigten Staaten keineswegs ausreichen würden, um den Schein länger wahren zu können. Vereinzelt, vor allem von Seiten Frankreichs, kann es zu Attacken auf den Dollar. In dieser Situation, mehr von den Not gedrängt als aus freien Stücken, rang man sich schließlich zu der Entscheidung, oder vielmehr: zur Notstandsmaßnahme des free floating durch. Jedoch hatten die Lenker der Zentralbanken keine wirkliche Vorstellung vom Funktionieren eines solchen Systems; daß es dennoch zustandekam, war allein der Alternativlosigkeit der Lage geschuldet.
Was aber bedeutet der Übergang ins free Floating? Zunächst einmal bedeutet dies eine substantielle Umcodierung des Geldes. Das Geldzeichen löst sich von seinem korporalen Repräsentanten ab, es wird deauratisiert, zur reinen, elektrischen Information. Nun ist diese Umcodierung, die bereits in den Assignaten des 18. Jahrhunderts präfiguriert ist, nur ein, nicht einmal der entscheidende Aspekt des Wandels. Wichtiger vielleicht ist die Tatsache, daß die in den globalen Informationsnetzen zirkulierende Information sich nicht mehr zentral steuern läßt. Zwar wird der Nominal-Wert des Geldes noch vom nationalstaatlichen Emittenten dekretiert, in Wahrheit jedoch entscheidet die Summe aller Marktteilnehmer über den Wert des Geldes. Statt mit einer allgewaltigen zentralperspektivischen Macht hat man es nunmehr mit einem polyzentralen Kommunikationsgeschehen zu tun. Nun könnte man, von der Tatsache dazu verleitet, daß die Nationalstaaten die facto noch immer die alleinige Emittenten des Geldes sind, diese Einschätzung anzweifeln. Sie wird indes sehr viel plausibler, wenn man sich die umgekehrte Situation vor Augen hält: daß nämlich ein Souverän auf seinen vermeintlichen Privileg beharren sollte, daß allein er es ist, der den Wert des Geldes festlegt. Denn dieses Privileg ist, in den Zeiten des freibeweglichen Kapitals, nur um den Preis vollständiger Isolation und Abkopplung vom Weltgeschehen zu realisieren. Der real existierende Sozialismus ist genau daran kollabiert, nicht von ungefähr zu jener Zeit, da die industrialisierte Welt sich massiv zu vernetzen begann.
Die Veränderung, die mit dem free floating einhergeht, ließe sich als ein Akt der Selbstdekapitation auffassen, wenn man so will, als eine symbolische Guillotinierung des modernen Souveräns. Das Kapital ist nicht mehr in den politischen Kapitalen zuhaus, sondern überall, anderswo. Mit einem Rückblick auf die Versuchsanordnung des Abbé ließe sich sagen: erst in diesem Augenblick hat sich der Kreis der elektrisierten Mönche, das Gesellschaftsaggregat, in die symbolische Ordnung übersetzt. Fortan ist es der Markt, genauer: die Summe aller Marktteilnehmer, die über den Wert einer Währung befinden. Nun ist diese Verschiebung des Machtzentrums, auch wenn sie realiter stattfindet und stattgefunden hat, kein Datum, das bereits in die Bewußtseinshelle gedrungen wäre. Ein Beispiel, ein überaus prominentes Beispiel zudem, mag die historische Verwunderung, aber auch die Ratlosigkeit verdeutlichen, die das Geschehen seinen Verursachern bescherte.
Im Jahr 1974, dem Jahr des Ölpreisschocks, ein Jahr, nachdem das Weltwährungssystem endgültig in den Zustand des free floating überging, schrieb der neoliberale Ökonom Friedrich von Hayek einen kurzen Text, Die Entnationalisierung des Geldes betitelt. Dieser Text ist insofern interessant, als hier die doppelte Verwunderung eines alten Mannes (Hayek war zum damaligen Zeitpunkt bereits 75 Jahre alt) deutlich wird, die Verwunderung darüber, warum eine grundlegende Frage der Ökonomie (die Frage nach dem gesetzlichen Zahlungsmittel – oder ex negativo: die Frage, warum der Einzelne nicht das Recht hat, Geld zu drucken?) einen blinden Fleck seiner Disziplin darstellt. Das ist wirklich ein Kuriosum ersten Ranges. Konsultiert man eine Bibliothek und schaut in den Lehrbüchern der Volkswirtschaftslehre nach, sieht man, daß das Geld eigentlich vom Himmel fällt. So entwirft Milton Friedman, neben Friedrich Hayek der andere große Verfechter des Neoliberalismus, das Bild einer Insel, über die Hubschrauber hinwegfliegen und säckeweise Geld abwerfen. Ein Markt entsteht, Preise werden ausgehandelt etc. Und der Nationalökonom, der als strenger Monetarist Geldmengetheorien entwirft, setzt, was er auflösen will, immer schon voraus. Geld, wie gesagt, fällt vom Himmel.
Hayek ist bereits ein alter Mann, als er endlich über den Aberglauben seiner Fachkollegen hinausgeht und die Kinderfrage der politischen Ökonomie neuerlich stellt. Warum steht allein dem Souverän das Recht zu, Geld zu emittieren? Wieso gibt es soetwas wie ein gesetzliches Zahlungsmittel? Ist dieses staatliche Prärogativ im 20. Jahrhundert nicht auf die schrecklichste Art und Weise mißbraucht worden? Hat nicht der Staat – wieder und wieder – die Massen pauperisiert und um ihr Vermögen gebracht? Nun mag sich Hayek, als praktisch denkender Mensch, nicht mit den Abgründen der Psychologie auseinandersetzen. Vielmehr ist er bestrebt, die Vision eines alternativen Modells an die Stelle des dysfunktionalen Zentralbanksystems zu setzen. Seine Lösung ist die Losung des Neoliberalismus, und sie lautet wie stets: daß der Markt es richten wird. Aber was wäre der Markt im Falle des Geldes? In Hayeks Vorstellung sind dies große Banken, die Geld emittieren und miteinander um die Güte ihrer Währung wetteifern. Freilich tut sich hier ein Dilemma auf. Denn ist diese Bastion einmal gebrochen, müßte es jedem Einzelnen freistehen, seine eigene Währung zu emittieren. Aber nicht nur in diesem Fall schreckt Hayek davor zurück, die logische Konsequenz des Gedankens ins Auge zu fassen – auch in der Frage, wie eine solche Währung gedeckt werden könne, fällt er in dunkle Zeiten zurück. Ausgerechnet Gold, das barbarische Residuum der Ökonomie, soll für die Güte des Geldes einstehen.
Hier, im Arcanum des Neoliberalismus, begegnen wir einer Verlegenheit ersten Ranges. Zwar schickt der Neoliberalismus sich an, sämtliche gesellschaftlichen Institutionen zu liquidieren, der Liquidator aber, das Geld, soll von diesem Prozeß ausgenommen sein. Dahinter steht der hilflose Wunsch, daß das Geld eine natürliche Grenze habe möge. Aber Geld haftet nicht mehr am Gold, sondern an der Elektrizität, respektive an den Codes, die es weltweit durch die Telefon- und Satellitenleitungen fließen lassen. Diese materielle Flüchtigkeit steht in einem unaufhebbaren Gegensatz zur Begrenztheit und Territorialität der Nationalstaaten. Denn insofern Geld in weltweiten Datennetzen zirkuliert, ist es zum Weltbürger Geld geworden, also zum Politikum; und ein Kennzeichen dieses Politikums besteht darin, daß der Weltbürger Geld – von jeglichen Rücksichten befreit und infolgedessen gründlich enthemmt – die tradierten, begrenzten Territorium und Körperschaften löchert. (Man trägt diesem Umstand in der Regel mit der Metapher des »scheuen Rehs« Rechnung, was freilich der Wahrheitsfindung nichts nutzt, sondern ihr vielmehr ausweicht – denn es ja keineswegs so, daß es man es mit einem Naturgeschehen zu tun hat). Nun sind, anders als die Gemeinwesen, die spekulativen Märkte nicht an der Stabilität, sondern an der Volatilität interessiert. Da die Spekulation nicht mehr an die natürlich Grenze gebunden ist, wohnt ihr eine Neigung zur überschießenden Phantasie, zur delirierenden Einbildungskraft inne. Geld in den Zeiten des free floating folgt den Gesetzen der Einbildungskraft, es ist hysterisch, phobisch, chaotisch.4
Mit der Dematerialisierung des Geldes tut sich ein neues Dilemma auf, ein Dilemma, das nicht mehr an der elektrischen Substanz des Geldes hängt, sondern an der Form, in der es durch die weltweiten Datenkanäle geschickt wird: am digitalen Code. Man muß sich nur an die mathematische Fundamente der digitalen Logik halten, wie sie George Boole in seinen »Laws of Thought« 1853 formulierte, und da bekommt man die Schwierigkeit vor Augen geführt. Nimmt man Null mal Null mal Null – so bekommt man wieder die Null heraus, nimmt man ein mal eins mal eins – so erhält man die Eins. Formalisiert man dies, so gelangt man zu der Formel, die unsere Gesellschaft zutiefst affiziert: x=xn. Oder konkret gesprochen: ein jeglicher Gegenstand, der digitalisiert worden ist, leidet unter einem Proliferationsverdacht. Oder einer Proliferationsverheißung, je nachdem. Hier hat man die Abbreviatur unserer modernen Produktionsverhältnisse, aber auch eine Formel, die man für das moderne Dividuum, die Figur des Einer-im andern ansetzen könnte. Denn hat man etwas einmal digitalisiert, so gibt es kein Original mehr; die Figur löst sich zur Serie ihrer Transfigurationen auf, das Datum zum Genpool seiner selbst, zum Spender der eigenen Überflüssigkeit. Diese Entfesselung der Produktion bedeutet eine Zäsur ersten Ranges, macht sie doch die Geschäftsgrundlage der klassischen Volkswirtschaftslehre obsolet: wird die Erde, als Stern der Knappheit, ersetzt durch eine Welt des Überflusses, einer grenzenlosen Proliferation, x=xn. Diese Formel, die ja der gedankliche Kern der so genannten Computerrevolution ist, ist der Grund für die phantastischen, man könnte auch sagen: ans Delir grenzenden Hoffnungen, welche die sogenannte neue Ökonomie ausgelöst hat.
Was im Bereich der Produktion eine phantastische Verheißung ist, wandelt sich dort, wo es auf die Problematik des Geldzeichens übertragen wird, zu einer nicht minder phantastischen Drohung. Denn Geld erlangt Geltung nur insofern, als es sich der beliebigen Vervielfältigung widersetzt. In diesem Sinne ist es weniger der Materialwert des Goldes, als vielmehr die Begrenztheit seines Vorkommens, die das Gold zum privilegierten Geldsubstrat gemacht hat. Diese natürliche Grenze ist fortgefallen; und wenn man versuchsweise einen epochalen, das heißt: grundfremden, ethnographischen Blick auf die verflossenen dreißig Jahre werfen, läßt sich notieren, daß die frei flottierende Kapitalströme ungeheuer zugenommen haben, oder abstrakter gesprochen: daß Geld seine Funktion als Metrum der Knappheit nicht mehr zureichend erfüllt.
Wer aber wird, in einer postnationalen Welt, der es an den entsprechenden Regelungsinstanzen mangelt, die Aufgabe übernehmen können, das Nichts, das doch die Grundlage des Gesellschaftlichen ist, knapp halten zu können? Wie wird die Macht beschaffen sein, die den Schein produziert? Und wie wird es gelingen, daß der Schein als solcher kursiert – also jenen allgemeinen Glaubwürdigkeitstest besteht, der ihm erst Kredit und Funktionstüchtigkeit einräumt. Wem diese Aufgabe zufallen wird, ist klar. Tatsächlich hat sich diese Macht schon längst zu erkennen gegeben, strahlt sie uns überall dort entgegen, wo die kommunikative Batterie den Gesetzen der Fernbedienung und damit: der Stochastik folgen, von der Fernsehschirmen und den Anzeigen der Börsenindizes. Jedoch scheint mir fraglich, ob die Verfechter der Bürgergesellschaft in diesen Hervorbringungen der direkten Demokratie jenes Modell der Bürgergesellschaft wiedererkennen mögen, das ihnen vorschwebt; und noch fraglicher erscheint mir, ob der Souverän an der Fernbedienung, die couch potatoe, imstande und auch nur willens sein wird, den Desiderata der »postnationalen und politischen Bürgergesellschaft« zu entsprechen.
Mit diesen Fragen, das ist zweifellos, betritt man den dark room jener feinen Gesellschaft, die sich den Ehrentitel der Bürgergesellschaft verliehen hat. Mag sein, daß man anschließend zur Auffassung geladen wird, daß der Sinn dieser lächelnden Monstrosität vor allem darin besteht, das zu übertönen, was uns bevorsteht: eine fortschreitende Dekomposition des Sozialen, nicht ein Bürger-, sondern eine Bürgerkriegsgesellschaft.
So oder so. Die Wahheit liegt auf der Straße. Sie hat eine Baseballkappe auf, und darauf steht:
PROTECT ME FROM WHAT I WANT.
Vgl. Dazu die erhellenden Ausführungen von Jean Starobinski: Rousseau.
Rousseau: Der Gesellschaftsvertrag, S. 158.
Vgl. Barry Eichengreen: Die Geschichte des Goldstandards.
Man sollte sich hüten, das internationale Kapital als monolithischen Block, vor allem aber als klassegebunden aufzufassen. So sind die ärgsten Stressoren der Aktiengesellschaften die Zusammenschlüsse der Kleinanleger, wenn man so will: der Aldi-Kapitalisten. Das führt der paradoxen Situation, daß ausgerechnet diejenigen, die sich zu den ersten Opfer der anstehenden Rationalisierungen rechnen können, diese am unerbittlichsten betreiben.