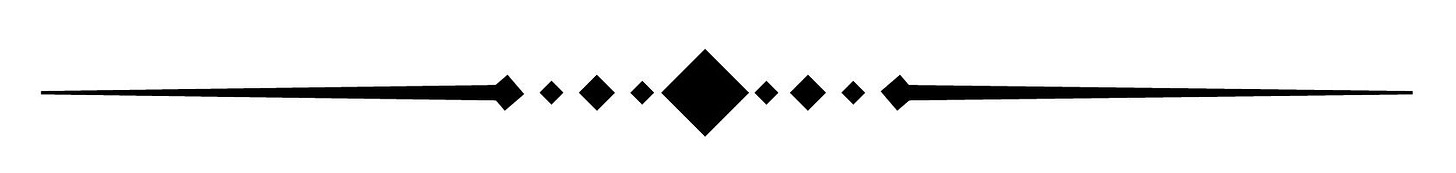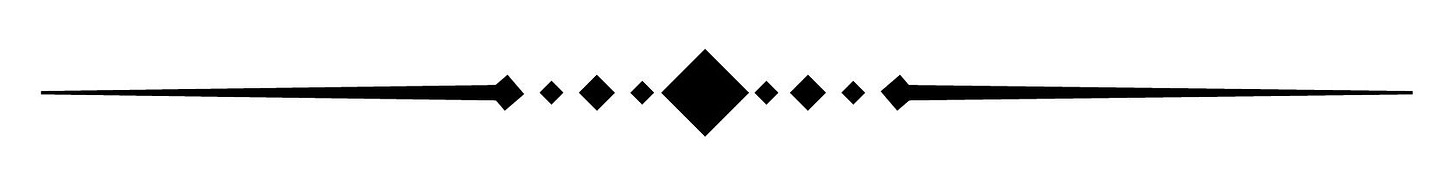Es gibt Bücher, die auf schlafwandlerische Weise von einer tiefen, geradezu abgründigen Geschichte erzählen – und Oliver Bulloughs Der Welt zu Diensten gehört in genau dieses Register. Man könnte Bullough einen Anthropologen des Geldes nennen. In jedem Fall verleiht er jener Geschichte, die man mit dem Wieselwort des Neoliberalismus eher verlegen umschifft wird, eine psychologische Sinnfälligkeit, an der es dort, wo man lediglich nach einem Sündenbock Ausschau hält, gänzlich fehlt. Und zugleich gelingt es ihm (sehr viel besser als manchem Politikwissenschaftler), jenen symbolischen Bürgerkrieg in den Blick zu bekommen, der die Gesellschaften des Westens untergründig destabilisiert hat. Worum aber geht es bei seiner Geschichte? Dazu gilt es ein paar Worte zu jener Vorgeschichte zu sagen, die den Autor sensibilisiert hat. So gelangte der junge Autor, der auf einer Schafsfarm in Wales groß geworden war, dann Geschichte in Oxford studierte, nach dem Ende seines Studiums nach Russland. Und dort konnte er als Journalist aus der Nähe beobachten, wie die Hoffnungen der russischen Gesellschaft auf Wohlstand und Demokratisierung zerstoben – und wie sich eine Oligarchie, ja, eine Kleptokratie breit machte, die sich zur Durchsetzung ihrer Ziele nicht scheute, sich der russischen Mafia zu bedienen, die dort den klangvollen Namen trägt: Diebe im Gesetz. Als Korrespondent für Reuters berichtete Bullough über den Tschetschenien-Krieg und lieferte, nach England zurückgekehrt, ein Psychogramm dieses Niedergangs ab: The Last Man in Russia. The Struggle to Save a Dying Nation. - Was ihm während seiner Jahre in Russland bitter aufstieß, war die Beobachtung, dass die Plünderung des russischen Volksvermögens nicht selten mit Hilfe westlicher, oft britischer Berater gelang. Damit war gewissermaßen das Thema gesetzt, hatte sich Bullough auf die Frage der Geldwäsche kapriziert – und sich der kriminellen Praktiken angenommen, die zunehmend die Finanzgeschäfte beherrschen. Vor diesem Hintergrund ließe sich Der Welt zu Diensten als Versuch begreifen, zu ergründen, warum eine überaus kultivierte, ja, snobistische Schicht – das englische Posh-Milieu - sich dazu herablassen konnte, irgendwelchen Mobstern bei der Geldwäsche behilflich zu sein. Oder wie der Untertitel des Buches mit schöner Klarheit sagt: Wie Großbritannien zum Butler von Oligarchen, Kleptokraten, Steuerhinterziehern und Verbrechern wurde.
Worum es geht, ist also nichts anderes als eine Form des Breaking Bad – nur dass die Protagonisten, wie im Falle der gleichnamigen Serie, nicht als Erzbösewichte, sondern als durchaus angenehme, kultivierte Zeitgenossen in Erscheinung treten. Den Anfang dieser Geschichte ortet Bullough im Untergang des britischen Empire, welcher spätesten mit der Suezkrise offenbar wurde. Auslöser war, dass der General Nasser die vordem in Privatbesitz befindlichen Ölgesellschaften verstaatlicht hatte – was die alten Kolonialmächte nicht hinzunehmen bereit war. Allerdings misslang ihr Versuch, den als Hitler Ägyptens denunzierten General zu stürzen – und dies wiederum machte die Schwäche des britischen Empire sichtbar (wovon die Kolonisatoren vor Ort sich schon längst hatten überzeugen können). War der Untergang des Empires (das sich seinen Hochzeiten ein Viertel der globalen Landmasse beherrscht hatte) eine sozialpsychologische Demütigung ersten Ranges, hatte er durchaus praktische Implikationen. Denn urplötzlich war eine ganze Generation von Administratoren, die es sich, von Butlern und Bediensteten umsorgt, in der Ferne gemütlich eingerichtet hatten, um Status und Privilegien gebracht. Der Bedeutungsverlust dieses Funktionsadels wog umso schwerer, als es keineswegs ausgemacht war, dass daheim im Mutterland eine auch nur annähernd attraktive Stelle auf die überflüssig gewordenen Kolonisatoren wartete – ganz im Gegenteil. Denn das England der fünfziger Jahre schlitterte, trotz des gewonnen Krieges, in eine tiefe Wirtschaftskrise hinein. Worin bestand nun die Antwort dieses überflüssig gewordenen Adels? Hier entfaltet Oliver Bulloughs Buch eine Intelligenz, die sich ganz seinem journalistischen Handwerk verdankt. Denn anstatt sich in postkolonialen Theoriewolken zu verlieren, folgt er den Lebenswegen seiner Protagonisten – und lässt auf diese Weise jene sonderbare Metamorphose hervortreten, welche seine Protagonisten durchliefen. Ein erstes Exempel ist die Geschichte jenes Anwaltes, der von einem tiefen postkolonialen Schock erfasst wurde. In Tansania geboren, in Kenia zur Schule gegangen, hatte er gerade zwei Jahre seines Lebens in England verbracht – und nichts zog ihn dorthin zurück. Andererseits war die Situation in seinem afrikanischen Heimatland wenig verlockend – und so nahm er, als er die Einladung erhielt, auf den Britischen Jungferninseln Teilhaber einer Anwaltskanzlei zu werden, diese mit Frohlocken an. Die Geschäftsgelegenheit, die sich hier bot, ließe sich als eine Form der imperialen Insolvenzverwaltung auffassen. Denn der Funktionsadel des britischen Empire hatte sich in Übersee, wo die Kontrollen nicht so arg waren, eine laxe Steuermoral angewöhnt – und folglich waren diejenigen, die sich die Ausnahme zur Regel gemacht hatten, keineswegs geneigt, sich der strengen Steuergesetzgebung des Mutterlandes zu unterwerfen. Dies führte zu einem Phänomen, das als Funk Money in die Geschichte eingehen sollte – Kapital, das aus den Kolonien abgezogen wurde und nach einem sicheren Hafen suchte, der es vor dem Zugriff der britischen Steuer bewahrte. Genau dies war die Aufgabe jener Anwaltskanzlei, die sich auf den britischen Jungferninseln niedergelassen hatte. Zwar gab es keinen rückständigeren Ort im gesamten Kolonialreich als diesen, jedoch bot die Teilautonomie, die das Mutterland den Kolonien gewährte, eine gewisse Freibeweglichkeit – und diese ließ sich ideal zur Geldwäsche nutzen. Weil die Geschäfte glänzend liefen, verfielen die findigen Anwälten auf allerlei neue Geschäftsideen. Denn mit einem Faxgerät ausgerüstet, konnte man auch mit dem amerikanischen Kontinent in Verbindung treten, war es ein Leichtes, nun auch dem zahlungsunwilligen amerikanischen Steuerzahler eine sicheren Hafen zu bieten, eine Adresse, wo er sein Geld einfach auf das Konto einer karibischen Briefkasten einzahlen konnte. In gewisser Hinsicht wog das moralische Problem nicht allzu sehr. Hatte man sich in Übersee bereits an laxere Sitten gewöhnt, ließen sich auf diese Weise die Privilegien des Empires fortführen – und konnte man sich auf der anderen Seite versichern, dass, wann man denn selbst nicht in diesem Register tätig werde, es schon ein anderer tun werde.
Und genau dies ist die Geschichte, die Oliver Bullough in verschiedenen Wendungen und am Beispiel verschiedener Protagonisten erzählt. So erfährt der Leser, wie Gibraltar, der Fels im Mittelmeer, sich von einem überflüssig gewordenen Militärposten zum Online-Spielerparadies hat mausern können – ein Eldorado, das nach dem Muster der karibischen Steuerparadiese konzipiert worden war. Zwar stand hier nicht das funk money zur Disposition, wohl aber die Frage, wie man die hohe Steuerlast britischer Wertbüros abmindern könnte. Und so gelang es, das gesamte britische Wettgeschäft an Land zu ziehen, auf einen Flecken, der gerade einmal 20.000 Einwohner zählte. Weil dieses Angebot mit der Virtualisierung des Spiels, sc. des Online-Glückspiels, koinzidierte, befand sich Gibraltar bald schon in der glücklichen Situation, fast die gesamten britischen Wettbüros (und nicht nur sie) im Lande zu haben. Umgekehrt hatte die Verbreiterung der Angebots zur Folge, dass sich die Wettsucht in Großbritannien weiter noch ausbreitete – und fortan jeder britische Bürger (Säugling, Greise und Demente einbezogen) gute 2000 Pfund seines Einkommens p.a. für Wetten draufgehen ließ. Folgt man dieser Logik, begreift man durchaus, warum im Jahr 2008, als die Finanzkrise ausbrach, gut 35% der englischen Bruttosozialprodukts über Finanzdienstleistungen erwirtschaftet wurde. Denn dass die Londoner Börse, neben der Wall Street, zum Weltfinanzzentrum hatte werden können, hatte damit zu tun, dass sich im Mutterland jene höchst fadenscheinigen Praktiken breit machten, die man in Übersee bestens erprobt hatte. Folglich konnten die Außenposten auf die tatkräftigen Unterstützung gut ausgebildeter, soignierter Herren rechnen, und selbige gingen ihrem Tagewerk mit unerschütterlichem Pragmatismus nach und im festen Bewusstsein, dass all dies, wenn man es nicht selber tue, von jemandem anderen bewerkstelligt würde. Nun will diese kleine Buchbesprechung sich nicht anheischig machen, Oliver Bulloughs Finanzkrimi in Kurzform nachzuerzählen. Dies kann der Autor sehr viel besser – und er erzählt damit eine Geschichte, die im Diskurs über die Exzesse des Neoliberalismus gänzlich unerwähnt bleibt, eine Geschichte, in der Kleptokraten, Wirtschaftsberater und Steueranwälte einander die Hand reichen,
Der einzige Kritikpunkt, den man gegen dieses journalistisch großartig recherchierte und spannend erzählte Buch erheben könnte, liegt auf einer theoretischen Ebene – und könnte der Gegenstand einer neuerlichen Unterhaltung sein, die wir mit Oliver Bulloughs führen werden (nachdem die letzte, bedauerlichweise, einem technischen Fehler zum Opfer gefallen ist). Hier geht es um ein fehlendes Bindeglied, genauer: es geht um die Technik, die das erratisch anmutende Verhalten seiner Protagonisten erklärt und steuert zugleich. Es ist kein Zufall, dass die Gründung der ersten Steueroasen mit dem Ende von Bretton Woods einherging, genauer: der Stiftung eines Weltfinanzsystems. Dass die Abkopplung vom Goldstandard sich im Schatten des Arpanets, des integrierten Schaltkreises und der Unix-Zeit abspielt (1.1.1970), ist ein Umstand, der von den Größen der ökonomischen Zunft übersehen worden ist - und in diesem Sinn eine gedankliche Leerstelle markiert. Die Folgen jedoch sind sattsam bekannt, ja, sind uns auf geradezu alltägliche Weise vertraut. Fortan nämlich ist das Kapital nicht mehr in den Kapitalen zuhause, sondern wird von gesichtslosen Weltfinanzmärkten evaluiert, und diese wiederum bedürfen dazu eines technischen Netzwerks. Dies wäre die Parallelerzählung, welche die Lektüre des Buches noch aufregender machte. Denn man begriffe, dass der Gang in die neoliberale Limboökonomie nicht bloß der moralischen Flexibilität oder der postkolonialen Schockerfahrung sich verdankt, sondern mit einer technischen Verführung einhergeht. Ausgehend von der Faxmaschine, über das Internet der frühen 90er Jahre, bis hin zur Echtzeitkommunikation, der Herausbildung von Avatarren und Phishing-Praktiken, lässt sich hier verfolgen, wie die klassischen Institutionen zunehmend ausgehöhlt werden – und wie der Pragmatismus der Helfershelfer Gefahr läuft, ins Halbseidene, wenn nicht gar ins Kriminelle abzurutschen. Und folgt man dieser Spur, lässt sich das psychologische Paradoxon auflösen, das Oliver Bullough in seinen Porträt und Geschichten mit großem Einfühlungsvermögen schildert. Damit nämlich wird klar, dass seine Protagonisten, die auf ihrer abschüssigen Bahn in die Tiefe gerutscht sind, keine Erzbösewichte sind – sondern Menschen wie du und ich, Realisten, die sich den Verhältnissen angepasst haben, im Wissen darum, dass die Gelegenheit, die man selber nicht nutzt, der Profit eines anderen sein wird. Hier jedoch, im Menschlich-Allzumenschlichen, wird das Skandalon fühlbar, dem Bulloughs mit seinem Buch beikommen möchte - aber an der die Metapher des Butlers, der seinem Herrn und Meister jeden Wunsch von den Lippen abliest, versagt. Zweifellos mag diese Rolle für die in die Jahre gekommenen Administratoren des britischen Empire zutreffen, aber sie verkennt die historische Wirkkraft, die hinter alledem steht. Gelegenheit macht Diebe, wie der Volksmund weiß. In diesem Sinn ist, was wir ›Neoliberalismus‹ nennen, nichts anderes als gnadenloser Opportunismus. Denn hier werden die Waffen der digitalen Revolution gegen die alten Institutionen in Stellung gebracht - und dies fällt umso leichter, als man sich dabei hinter einem Avatar verstecken und beim Fernhandel von den Folgen des eigenen Handelns verschont wähnen kann.